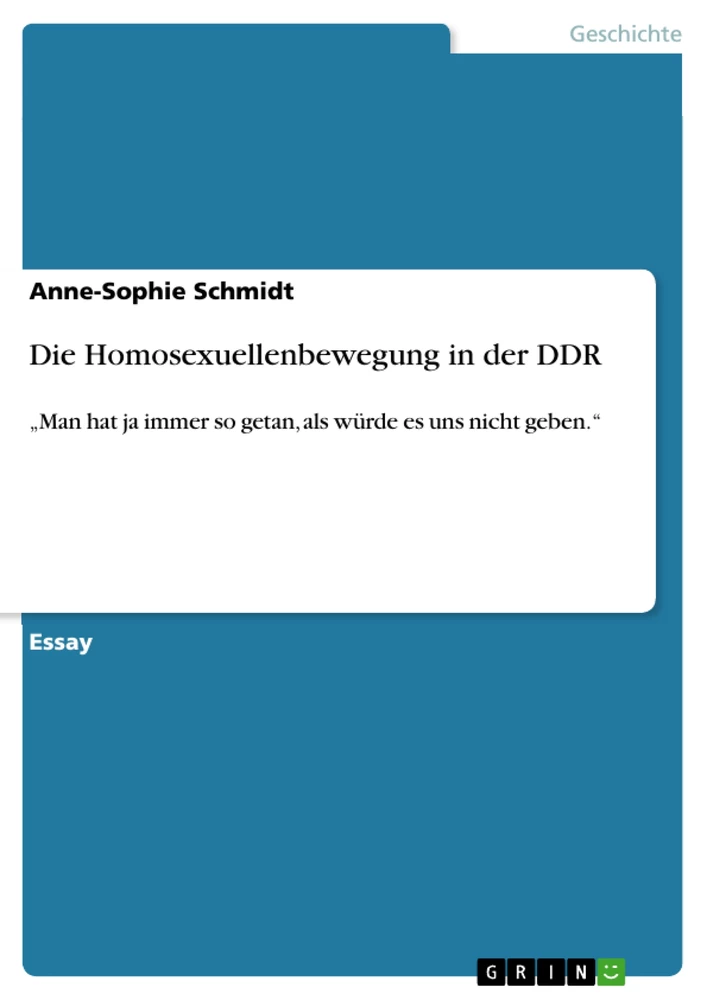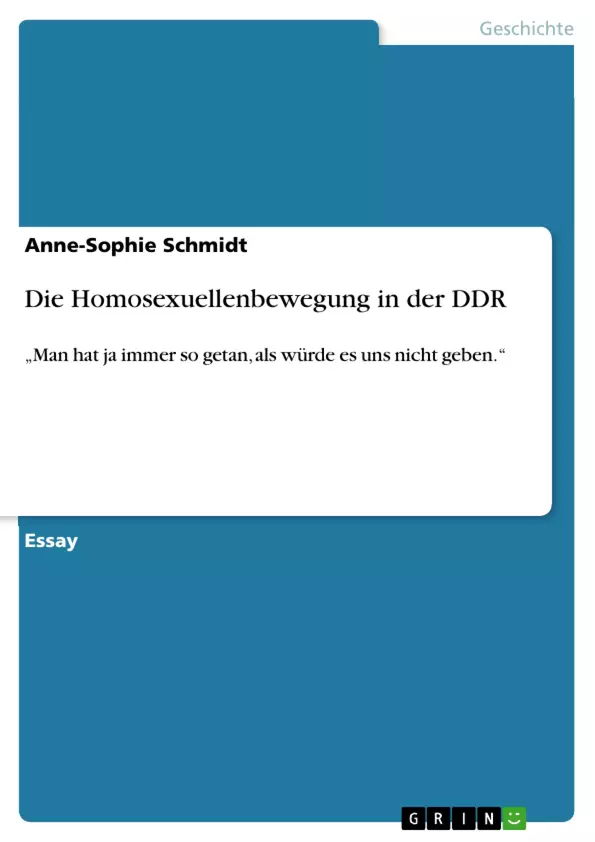Die Hausarbeit behandelt die juristische und tatsächliche Situation von Schwulen und Lesben in der DDR sowie ihre Selbstorganisation unter dem Dach der Kirche bzw. als "weltliche" Gruppen.
„Der Sozialismus braucht jeden. Er hat Platz und Perspektive für alle.“ Für alle! Das klingt gut! In der DDR gab es also keinerlei Randgruppen, keine Benachteiligten. Dass da jemand am Rande steht, gar von ˈVater Staatˈ vergessen wird, das wiederspräche ja der grundlegenden These der Parteifunktionäre, dass alle ˈGenossenˈ gleichberechtigt und gestaltend am Aufbau der sozialistischen Gemeinschaft mitwirken können.
Was den Umgang mit Sexualität betraf, war die DDR tatsächlich toleranter und liberaler als die frühere Bundesrepublik – zumindest auf dem Papier. Mit der Gründung der DDR wurde die verschärfte Nazi-Fassung des Paragraphen 175 außer Kraft gesetzt. Man kehrte zur etwas milderen Weimarer Version zurück. Lesbische Handlungen wurden gar nicht geahndet – es sei denn, es waren Jugendliche involviert.
Die Jugend wollte der Arbeiter- und Bauernstaat besonders vor Homosexualität schützen, so dass das sogenannte Schutzalter für gleichgeschlechtlichen Sex weiterhin höher als für gegengeschlechtlichen angesetzt wurde. Nach 1957 wurden homosexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern im Osten kaum noch bestraft und 1968 strich man den Paragraphen 175 ganz aus dem Strafrecht – im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo die Fassung aus dem Dritten Reich bis 1969 gültig blieb. 1988 schaffte die letzte unfrei gewählte Volkskammer dann auch den Paragraphen 151 betreffend des höheren Schutzalters ab.
Inhaltsverzeichnis
- Isolation und Unsichtbarkeit
- Raum für Lesben und Schwule
- Impulse von außen
- Die 80er Jahre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation der Homosexuellenbewegung in der DDR. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen sich Homosexuelle im Alltag gegenüber sahen, trotz der formalen Abschaffung des Paragraphen 175. Die Arbeit analysiert die Versuche der Selbstorganisation und den Einfluss externer Faktoren auf die Entwicklung der Bewegung.
- Soziale Diskriminierung und Isolation Homosexueller in der DDR
- Versuche der Selbstorganisation und die Herausforderungen im Umgang mit dem Staat
- Der Einfluss der internationalen Homosexuellenbewegung
- Die Rolle der Kirche und anderer Institutionen
- Entwicklung der Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren
Zusammenfassung der Kapitel
Isolation und Unsichtbarkeit: Das Kapitel beschreibt die soziale Isolation und Diskriminierung, der sich Homosexuelle in der DDR ausgesetzt sahen, trotz der rechtlichen Gleichstellung im Vergleich zum Westen. Es wird die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz und das Tabu der Homosexualität in Alltag und Medien hervorgehoben. Der Ausruf einer lesbischen Frau, die zum ersten Mal Kontakt zu anderen lesbischen Frauen hatte, veranschaulicht die jahrelange Isolation und Unsichtbarkeit, die das Leben vieler Betroffener prägte. Die fehlende Möglichkeit, sich offen zu ihrem Begehren zu bekennen, und die daraus resultierende soziale Ausgrenzung werden detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Erfahrung der Unsichtbarkeit und des Mangels an gemeinschaftlicher Zugehörigkeit.
Raum für Lesben und Schwule: Dieses Kapitel analysiert den Mangel an Räumen und Möglichkeiten für Lesben und Schwule in der DDR. Die Abwesenheit von Kontaktanzeigen, Zeitschriften und Treffpunkten wird im Vergleich zur Situation in Westdeutschland beleuchtet. Die begrenzte Anzahl an Lokalen und die geringe Anzahl an Publikationen zum Thema Homosexualität unterstreichen die gesellschaftliche Ausgrenzung. Das Kapitel verdeutlicht die Schwierigkeit, sich in der sozialistischen Gesellschaft zu organisieren und zu vernetzen, ohne die offizielle Anerkennung durch den Staat zu erhalten. Es wird gezeigt, wie das marxistische Klassensystem und die Ideologie der ehelichen Gemeinschaft die Homosexualität ablehnten und zu Konflikten bei den Betroffenen führten.
Impulse von außen: Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss der internationalen Homosexuellenbewegung und insbesondere der Stonewall-Aufstände von 1969 sowie den Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von Rosa von Praunheim auf die Entwicklung der Homosexuellenbewegung in der DDR. Der West-Fernsehempfang und die dadurch ermöglichte Kenntnis von westlichen Initiativen und Organisationsformen wird als wichtiger Impuls für die Selbstorganisation im Osten betrachtet. Der Bericht über die Erfahrungen von Eduard Stapel verdeutlicht, wie der Film zur Überwindung der Isolation und zur Entwicklung eines Selbstverständnisses beitrug. Die zunehmende Vernetzung mit Aktivisten in West-Berlin erlaubte es den ostdeutschen Homosexuellen, ihre eigenen Wünsche und Forderungen zu formulieren.
Die 80er Jahre: Dieses Kapitel beschreibt die sich verändernden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der 80er Jahre und die daraus resultierenden Bemühungen um Selbstorganisation und Sichtbarwerdung. Es wird das anwachsende Engagement der evangelischen Kirche und die Beharrlichkeit der Aktivisten trotz der Auflösung der HIB hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines Selbstbewusstseins als Lesbe oder Schwuler in einer repressiven Umgebung, und die fortgesetzten Bemühungen um die Bewusstseinsveränderung in der Gesellschaft werden betont. Die kontinuierliche Arbeit der Aktivisten, trotz der Schwierigkeiten und des Risikos von staatlichen Repressalien, wird detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Homosexuellenbewegung, DDR, Selbstorganisation, Repression, Paragraph 175, soziale Diskriminierung, Isolation, Stonewall-Aufstände, Rosa von Praunheim, Evangelische Kirche, Identität, Sichtbarkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Homosexuellenbewegung in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Situation der Homosexuellenbewegung in der DDR, insbesondere die Herausforderungen, denen sich Homosexuelle trotz der formalen Abschaffung des Paragraphen 175 im Alltag gegenüber sahen. Sie analysiert die Versuche der Selbstorganisation und den Einfluss externer Faktoren auf die Entwicklung der Bewegung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die soziale Diskriminierung und Isolation Homosexueller, die Versuche der Selbstorganisation und den Umgang mit dem Staat, den Einfluss der internationalen Homosexuellenbewegung, die Rolle der Kirche und anderer Institutionen sowie die Entwicklung der Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren.
Wie wird die soziale Isolation Homosexueller in der DDR dargestellt?
Das Kapitel "Isolation und Unsichtbarkeit" beschreibt die soziale Isolation und Diskriminierung, der sich Homosexuelle trotz rechtlicher Gleichstellung im Vergleich zum Westen ausgesetzt sahen. Die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz, das Tabu der Homosexualität und der Mangel an gemeinschaftlicher Zugehörigkeit werden detailliert dargestellt.
Welche Schwierigkeiten hatten Lesben und Schwule bei der Selbstorganisation in der DDR?
Das Kapitel "Raum für Lesben und Schwule" analysiert den Mangel an Räumen und Möglichkeiten für Lesben und Schwule in der DDR. Die Abwesenheit von Kontaktanzeigen, Zeitschriften und Treffpunkten wird im Vergleich zur Situation in Westdeutschland beleuchtet. Die Schwierigkeit, sich in der sozialistischen Gesellschaft zu organisieren und zu vernetzen, ohne staatliche Anerkennung, wird hervorgehoben.
Welchen Einfluss hatte die internationale Homosexuellenbewegung?
Das Kapitel "Impulse von außen" beschreibt den Einfluss der internationalen Homosexuellenbewegung, insbesondere der Stonewall-Aufstände und des Films "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Der West-Fernsehempfang und die zunehmende Vernetzung mit Aktivisten in West-Berlin ermöglichten den ostdeutschen Homosexuellen, ihre eigenen Wünsche und Forderungen zu formulieren.
Wie entwickelte sich die Bewegung in den 1980er Jahren?
Das Kapitel "Die 80er Jahre" beschreibt die sich verändernden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Bemühungen um Selbstorganisation und Sichtbarwerdung. Das anwachsende Engagement der evangelischen Kirche und die Beharrlichkeit der Aktivisten trotz der Auflösung der HIB werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Homosexuellenbewegung, DDR, Selbstorganisation, Repression, Paragraph 175, soziale Diskriminierung, Isolation, Stonewall-Aufstände, Rosa von Praunheim, Evangelische Kirche, Identität, Sichtbarkeit.
Welche Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis enthalten?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst die Kapitel: Isolation und Unsichtbarkeit, Raum für Lesben und Schwule, Impulse von außen und Die 80er Jahre.
- Arbeit zitieren
- Anne-Sophie Schmidt (Autor:in), 2015, Die Homosexuellenbewegung in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334416