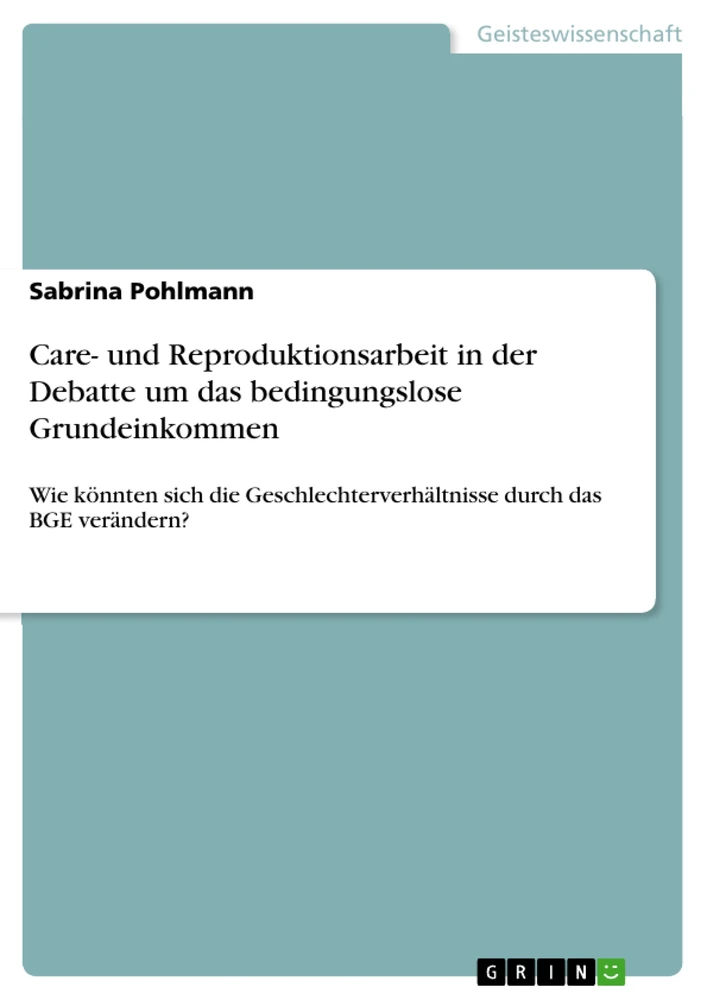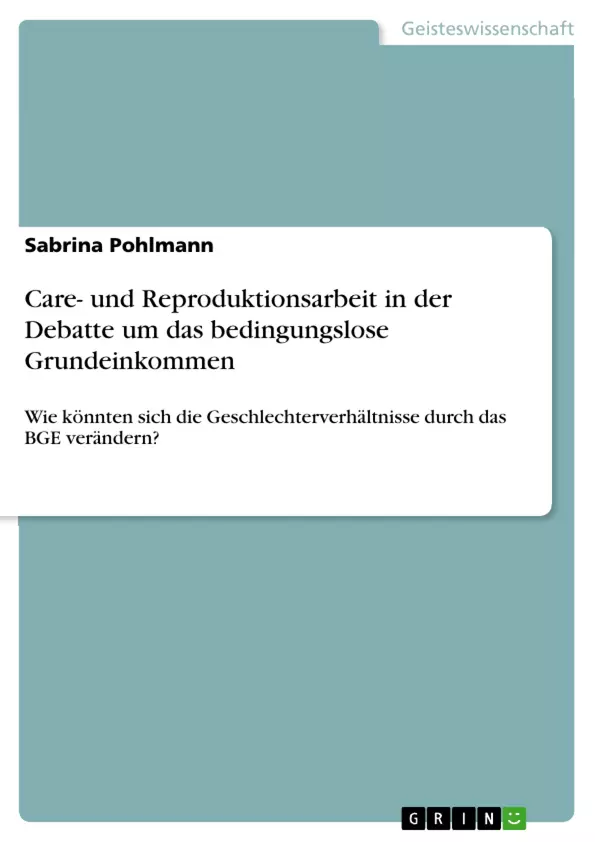Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens hat an politischer Aktualität gewonnen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird sowohl in der Partei Die Linke als auch bei den Grünen die Idee des BGE intensiv diskutiert. Die Debatte wird also auch innerhalb der Parteien geführt. Befürworter des Grundeinkommens argumentieren, dass eine Entkopplung von Arbeit und Einkommen, zu mehr gesellschaftlichem Fortschritt und Verteilungsgerechtigkeit führen kann.
Ein bisher in den Überlegungen um das BGE eher vernachlässigter Aspekt ist die Frage, wie sich die Geschlechterverhältnisse durch das BGE verändern könnten. Unter Feministen ist die Bewertung des BGE umstritten, neben engagierten Fürsprechern gibt es auch harsche Kritiker – eine allgemeine Tendenz, gar Einigkeit innerhalb der Frauenbewegung existiert nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Das bedingungslose Grundeinkommen
- 1.2 Ein feministischer Blickwinkel
- 2. Auswirkungen des BGE auf Frauen
- 2.1 Mögliche positive Auswirkungen
- 2.2 Mögliche negative Auswirkungen
- 3. Grundsätzliches
- 3.1 Der Sozialstaat und das Grundeinkommen
- 3.2 Wie viel kann Sozialpolitik bewirken
- 4. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse. Der Fokus liegt auf einer feministischen Perspektive, die bisherige Lücken in der BGE-Debatte schließt. Es werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen analysiert und in den Kontext bestehender sozialer Strukturen eingeordnet.
- Auswirkungen des BGE auf die Reproduktionsarbeit von Frauen
- Veränderung der Geschlechterrollen und -verhältnisse durch das BGE
- Die Rolle des BGE im bestehenden Sozialstaatssystem
- Positive und negative Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit von Frauen
- Bewertung des BGE aus feministisch-ökonomischer Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die aktuelle Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ein, die durch die Wirtschaftskrise und Kritik an Hartz IV verstärkt wird. Sie betont den bisher vernachlässigten Aspekt der Auswirkungen des BGE auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse und stellt fest, dass innerhalb der feministischen Bewegung keine Einigkeit über die Bewertung des BGE herrscht. Das Konzept des BGE wird als Mindesteinkommen definiert, das unabhängig von Bedürftigkeitsprüfung an jeden Menschen ausgezahlt wird. Der feministische Blickwinkel wird als Fokus der Arbeit auf die möglichen Auswirkungen auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse vorgestellt. Reproduktionsarbeit wird als zentraler Begriff eingeführt, der die unbezahlten Arbeiten von Frauen wie Hausarbeit und Kindererziehung umfasst. Die Arbeit beschränkt sich hauptsächlich auf westliche Wohlfahrtsstaaten, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
2. Auswirkungen des BGE auf Frauen: Dieses Kapitel befasst sich mit den potenziellen Auswirkungen des BGE auf Frauen. Es hebt die bisherige Geschlechterblindheit in der BGE-Literatur hervor und präsentiert verschiedene Ansichten und Analysen von Autor*innen, die sich mit dem Thema aus feministischer Perspektive auseinandersetzen. Es wird die Frage nach möglichen positiven und negativen Auswirkungen des BGE auf die Erwerbstätigkeit, die Lohnentwicklung und die gesellschaftlichen Rollenbilder diskutiert, wobei verschiedene Szenarien und deren Konsequenzen beleuchtet werden.
3. Grundsätzliches: Dieses Kapitel widmet sich grundsätzlichen Überlegungen zum BGE im Kontext des Sozialstaats. Es behandelt die Frage, inwieweit das BGE die bestehenden Strukturen des Sozialstaates verändern würde und welche Rolle es für Migrant*innen spielen könnte. Weiterhin wird die Frage nach dem Wirkungsgrad von Sozialpolitik im Allgemeinen und die damit verbundenen Grenzen diskutiert. Die Komplexität des Themas und die unterschiedlichen Einflüsse werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit, Feministische Ökonomiekritik, Geschlechterverhältnisse, Sozialstaat, Frauen, Erwerbsarbeit, Lohnentwicklung, Geschlechterblindheit, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse aus feministischer Perspektive. Sie analysiert sowohl positive als auch negative Auswirkungen und betrachtet den Kontext bestehender sozialer Strukturen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Auswirkungen des BGE auf die Reproduktionsarbeit von Frauen, die Veränderung von Geschlechterrollen und -verhältnissen, die Rolle des BGE im Sozialstaatssystem, positive und negative Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit von Frauen sowie eine Bewertung des BGE aus feministisch-ökonomischer Sicht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Eine Einleitung, die das BGE und den feministischen Blickwinkel einführt; ein Kapitel zu den Auswirkungen des BGE auf Frauen mit Diskussion verschiedener Szenarien; und ein Kapitel zu grundsätzlichen Überlegungen zum BGE im Kontext des Sozialstaats und der Sozialpolitik.
Wie wird das BGE in dieser Arbeit definiert?
Das BGE wird als ein Mindesteinkommen definiert, das unabhängig von Bedürftigkeitsprüfung an jeden Menschen ausgezahlt wird.
Welche Rolle spielt die feministische Perspektive?
Die feministische Perspektive bildet den zentralen Fokus der Arbeit. Sie dient dazu, die bisherigen Lücken in der BGE-Debatte zu schließen und die spezifischen Auswirkungen des BGE auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse zu analysieren. Die Arbeit hebt die bisherige Geschlechterblindheit in der BGE-Literatur hervor.
Welche Aspekte der Reproduktionsarbeit werden betrachtet?
Reproduktionsarbeit, also unbezahlte Arbeiten wie Hausarbeit und Kindererziehung, wird als zentraler Begriff eingeführt und in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen des BGE auf Frauen diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Ansichten und Analysen von Autor*innen, die sich mit dem Thema aus feministischer Perspektive auseinandersetzen. Sie diskutiert mögliche positive und negative Auswirkungen des BGE auf die Erwerbstätigkeit, die Lohnentwicklung und die gesellschaftlichen Rollenbilder und beleuchtet verschiedene Szenarien und deren Konsequenzen.
Welche Kritikpunkte werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert die bisherige Geschlechterblindheit in der BGE-Debatte und betont die Notwendigkeit einer feministischen Perspektive, um die komplexen Auswirkungen des BGE auf Frauen und die Geschlechterverhältnisse umfassend zu analysieren.
Auf welche Art von Gesellschaften konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf westliche Wohlfahrtsstaaten, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Reproduktionsarbeit, Care-Arbeit, Feministische Ökonomiekritik, Geschlechterverhältnisse, Sozialstaat, Frauen, Erwerbsarbeit, Lohnentwicklung, Geschlechterblindheit, Sozialpolitik.
- Arbeit zitieren
- B.A. Sabrina Pohlmann (Autor:in), 2013, Care- und Reproduktionsarbeit in der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334425