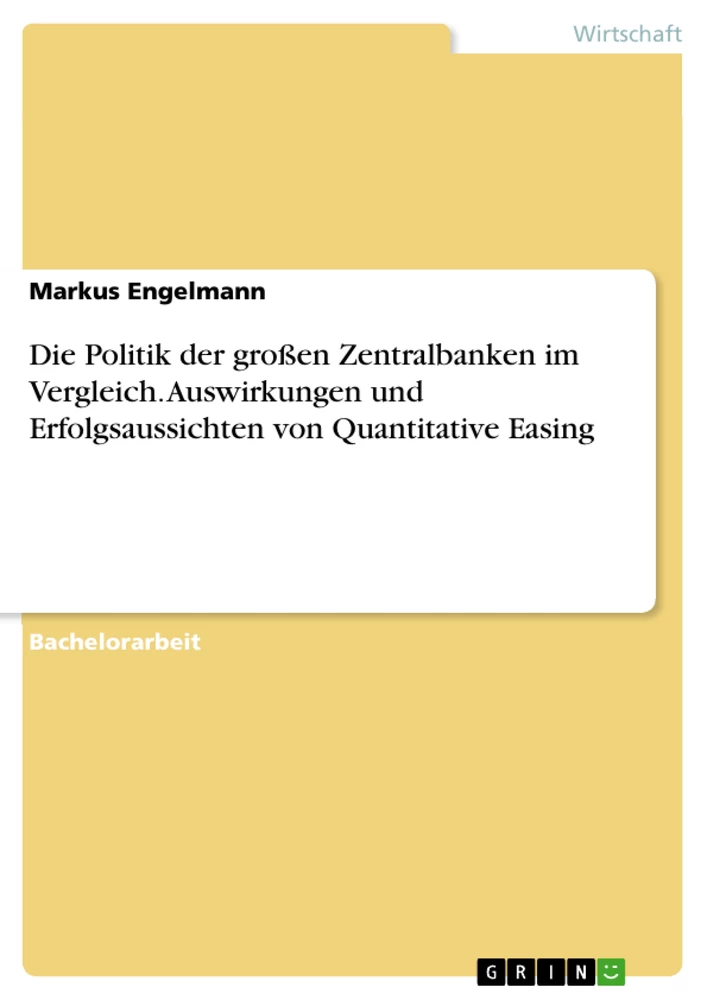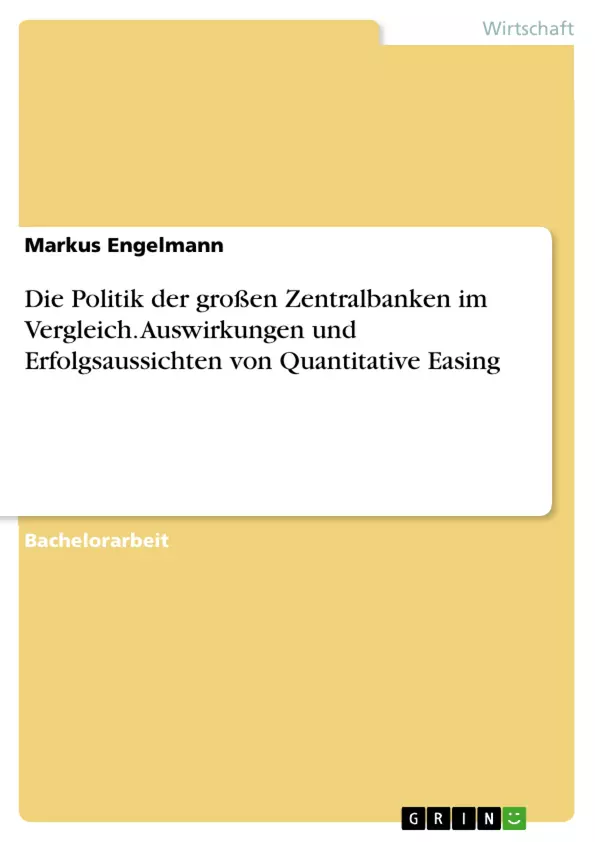Die vorliegende Arbeit vergleicht die QE Programme der vier großen Zentralbanken und analysiert die Effektivität dieser. Dazu wird aktuelle Forschungsliteratur zu diesem Thema herangezogen. Des Weiteren werden die Renditen langlaufender Staatsanleihen betrachtet, da diese im Fokus des QE stehen. Besonders die Wirkungsweise des QE und die Auswirkungen der Programme, die bereits lange durchgeführt werden, sind zentrale Themen dieser Arbeit. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Erfolgsaussichten das QE der EZB hat und ob die Kritik berechtigt ist.
Am 22. Januar 2015 beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) das nicht unumstrittene Quantitative Easing (QE) Programm. Seit März 2015 werden Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von insgesamt 1.140 Milliarden Euro bis mindestens September 2016 aufgekauft. Dadurch soll den deflationären Tendenzen in der Eurozone entgegen gewirkt werden, denn Anfang des Jahres 2015 waren sowohl die Inflationsrate als auch die Erwartungen für die zukünftige Entwicklung des Preisniveaus niedrig oder sogar negativ. Dies resultierte zum einen aus fallenden Energiepreisen, ist zum anderen aber immer noch eine Folge der Finanz- und Schuldenkrise. Für die Verbraucher scheinen sinkende Preise von Vorteil zu sein, aber diese können negative Folgen für eine Volkswirtschaft wie den Rückgang der Investitionstätigkeit mit einer damit einhergehenden Rezession haben. Das QE Programm soll dies durch Wertpapierkäufe verhindern. Es ist aber nicht unumstritten, weil unter anderem die Inflationsgefahr steigt. Besonders die Deutsche Bundesbank übt Kritik an diesem Programm.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Analyse dieser Thematik. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Untersuchung der konventionellen Geldpolitik und erörtert, warum diese nicht mehr funktioniert und der Einsatz des QE daher seine Berechtigung hat. Im darauf folgenden dritten Kapitel wird das QE grundlegend erklärt. Die Funktionsweisen und Transmissionskanäle werden analysiert. Außerdem erfolgen die Betrachtung der Ausgestaltung in der Eurozone und ein erster Vergleich der QE Programme. In Kapitel 4 wird die Umsetzung des QE in Japan, den USA und Großbritannien detailliert untersucht und die Auswirkungen evaluiert. Des Weiteren werden die Erfolgsaussichten für die Eurozone überprüft. Mit der Kritik am QE beschäftigt sich Kapitel 5. Daneben setzt sich dieses Kapitel kritisch mit einer möglichen Exit-Strategie auseinander.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Versagen der traditionellen Geldpolitik
- 3. Was ist Quantitative Easing?
- 3.1 Transmissionskanäle der unkonventionellen Geldpolitik
- 3.2 Ausgestaltung in der Eurozone und erster Vergleich
- 4. Empirische Evidenz zum Quantitative Easing
- 4.1 Quantitative Easing am Beispiel großer Zentralbanken
- 4.1.1 Japan
- 4.1.2 USA
- 4.1.3 Großbritannien
- 4.2 Zusammenfassung und Ausblick für Europa
- 5. Kritik und Probleme
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Analyse von Quantitative Easing (QE) und untersucht die Erfolgsaussichten des Programms, insbesondere im Kontext der Eurozone. Die Arbeit analysiert vergangene und laufende QE-Programme großer Zentralbanken, um Erkenntnisse über die Effektivität und Auswirkungen dieser Politikmaßnahme zu gewinnen.
- Bewertung der Grenzen der traditionellen Geldpolitik in der Eurozone
- Erklärung der Funktionsweise und Transmissionskanäle von QE
- Vergleich der QE-Programme in Japan, den USA und Großbritannien
- Analyse der Auswirkungen und Erfolgsaussichten des QE-Programms der EZB
- Bewertung der Kritik und möglicher Probleme im Zusammenhang mit QE
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der Eurozone im Hinblick auf Deflation und das QE-Programm der EZB vor. Sie zeigt die Relevanz der Thematik und die Ziele der Arbeit auf.
- Kapitel 2: Versagen der traditionellen Geldpolitik: Dieses Kapitel untersucht die Grenzen der konventionellen Geldpolitik, insbesondere im aktuellen Kontext der Eurozone, und erläutert, warum der Einsatz von QE gerechtfertigt ist.
- Kapitel 3: Was ist Quantitative Easing?: Dieses Kapitel bietet eine grundlegende Erklärung von QE, analysiert die Funktionsweise und Transmissionskanäle des Programms und vergleicht die Ausgestaltung des QE in der Eurozone mit anderen Ländern.
- Kapitel 4: Empirische Evidenz zum Quantitative Easing: Dieses Kapitel untersucht die Umsetzung von QE in Japan, den USA und Großbritannien und evaluiert die Auswirkungen der Programme. Es betrachtet auch die Erfolgsaussichten für die Eurozone.
Schlüsselwörter (Keywords)
Quantitative Easing, unkonventionelle Geldpolitik, Eurozone, Zentralbanken, Deflation, Inflationsrate, Renditen langlaufender Staatsanleihen, Transmissionskanäle, Effektivität, Kritik, Exit-Strategie, Japan, USA, Großbritannien, Bank of Japan (BoJ), Federal Reserve (Fed), Bank of England (BOE), Europäische Zentralbank (EZB)
Häufig gestellte Fragen
Was ist Quantitative Easing (QE)?
Quantitative Easing ist eine unkonventionelle geldpolitische Maßnahme, bei der Zentralbanken in großem Stil Wertpapiere (meist Staatsanleihen) kaufen, um die Geldmenge zu erhöhen und die Zinsen zu senken.
Warum setzte die EZB ab 2015 auf Quantitative Easing?
Die EZB wollte damit deflationären Tendenzen in der Eurozone entgegenwirken, die Investitionstätigkeit fördern und die Inflationsrate wieder näher an das Ziel von knapp unter 2 % bringen.
Wie wirken die Transmissionskanäle von QE?
QE wirkt unter anderem über den Zinskanal (Senkung der Renditen), den Portfolio-Rebalancing-Kanal (Anleger weichen auf andere Assets aus) und den Signalisierungskanal (Erwartung niedriger Zinsen).
Welche Kritik gibt es am QE-Programm?
Kritiker, wie die Deutsche Bundesbank, warnen vor einer steigenden Inflationsgefahr, einer Verzerrung der Marktpreise, einer möglichen Abhängigkeit der Staaten von billigem Geld und den Schwierigkeiten einer Exit-Strategie.
Wie unterscheidet sich das QE in den USA von dem in Japan?
Die Arbeit vergleicht die Programme der Fed (USA) und der BoJ (Japan) hinsichtlich ihrer Dauer, ihres Umfangs und ihrer spezifischen Auswirkungen auf die jeweilige Volkswirtschaft.
- Quote paper
- Markus Engelmann (Author), 2015, Die Politik der großen Zentralbanken im Vergleich. Auswirkungen und Erfolgsaussichten von Quantitative Easing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334520