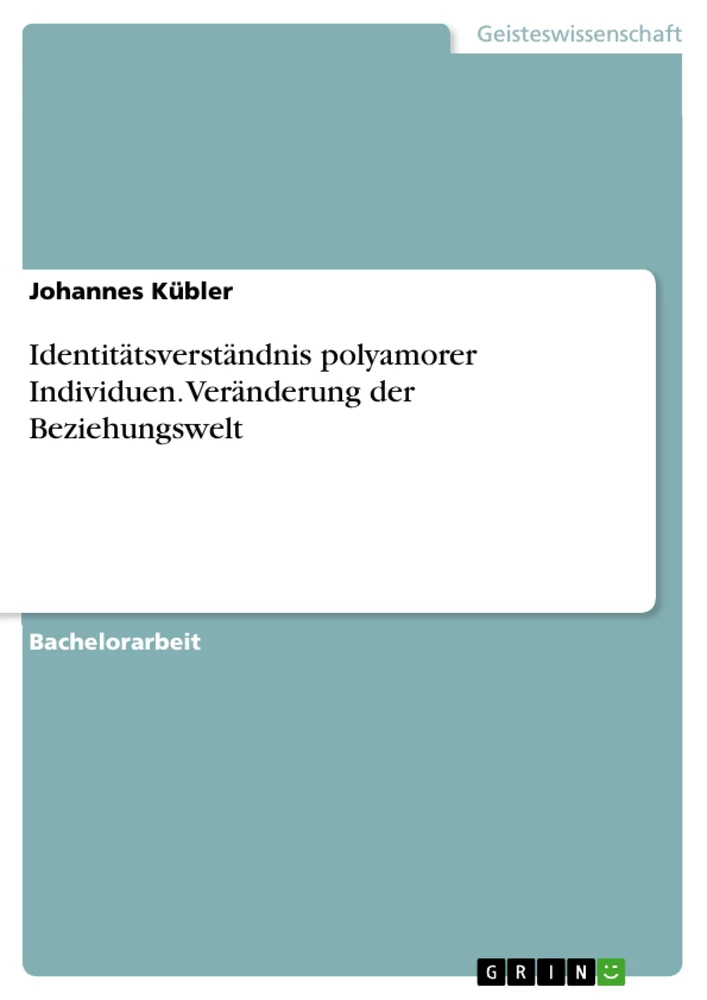Die Gesellschaft postmoderner Industrieländer befindet sich im Umbruch. Tradition und unstrittig akzeptierte Lebensmuster sind auf dem Rückzug. Beruf, Wohnort oder Rollenverständnis sind Schauplätze eines Pluralisierungs- und Individualisierungsprozesses, welcher einerseits für den Einzelnen immer mehr Optionen bereithält, andererseits die Aufgabe sich zu entscheiden immer akuter werden lässt. Während jedoch in den 1960er Jahren die „sexuelle Revolution“ im Mittelpunkt aller Veränderungen stand und die 1980er Jahre
eine umfassende Genderdebatte hervorbrachten, verhandelt der aktuelle Diskurs besonders das gesellschaftliche Verständnis von Partnerschaft und Familie. Für den Einzelnen bedeutet dies auch Abschied von tradierten Beziehungsentwürfen zu nehmen. Neben den klassischen Beziehungsmodellen wie der Ehe oder der Lebenspartnerschaft etablieren sich zunehmend Formen einer seriellen Monogamie und Biographien mit langer Partnerlosigkeit. Sich selbst als kontinuierlich, kohärent und einheitlich zu erleben, erscheint in Zeiten einer unsteten und vom Wandel geprägten Beziehungswelt immer schwieriger. Dass dies jedoch zu einer breiten Abkehr von traditionellen Beziehungsidealen führt, ist nicht zu beobachten. Zwar sind die Trennungs- und Scheidungsraten hoch, doch dies gilt genauso für den prozentualen Anteil derer, die nach erfolgter Trennung erneut heiraten. Und während Online-Partnerbörsen boomen und Millionen Menschen sich immer effizienter auf die Suche nach dem richtigen Partner begeben, aller statistischer Entwicklung zum Trotz, scheint das mehrheitliche Identitätsverständnis weiter auf klassischen Beziehungsformen zu fußen. Die zunehmende Beziehungsmobilität bringt jedoch auch Kostverächter dieser Entwicklung hervor, die ihr Glück weit ab von bisherigen Modellen suchen. So entstehen Beziehungsformen deren Verfechter sich offensichtlich völlig von jeder normativen Orientierung lossagen wollen. Mit der Polyamorie hat sich ein Konzept entwickelt, deren zentraler Bestandteil in der bewussten Zustimmung zu Beziehungspluralität besteht. So bilden polyamore Menschen ein Netzwerk intimer Beziehungen aus, im Gegensatz zur Affäre oder offenen Ehe jedoch auf Gleichberechtigung fußend und über die sexuelle Ebene hinausgehend. Es stellt sich die Frage, welcher gesellschaftliche Blick und welches individuelle Identitätsverständnis diesem Lebensentwurf zugrunde liegen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Klärung des Identitätsbegriffs
2.1.1 Begriffliche Herkunft
2.1.2 Postmoderne Begriffsinterpretation
2.2 Identität im gesellschaftlichen Wandel
2.2.1 Gesellschaftliche Entgrenzungsprozesse
2.2.2 Veränderungen der Beziehungswelt
2.3 Das polyamore Beziehungskonzept
2.3.1 Merkmale der Polyamorie - Definition und Abgrenzung
2.3.2 Formen polyamorer Beziehungskonstrukte
2.4 Konklusion
3 Methodisches Vorgehen
3.1 Gegenstand und Paradigmen der qualitativen Forschung
3.2 Anwendung des problemzentrierten Interviews
3.3 Betrachtung der Kernsatzmethode
3.4 Gütekriterien qualitativer Forschung
3.5 Ermittlung der Untersuchungsgruppe
4 Ergebnisse
4.1 Kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen
4.2 Entwertung des „Wir“, Fokussierung des „Ich“
4.3 Integrität fördert das kohärente Selbstbild
4.4 Beziehungskonstruktion als identitätsstiftender Anpassungsprozess
4.5 Entgrenzungsprozess begründet neue Konfliktfelder
5 Diskussion
6 Rollenreflexion und Interpretationsgrenzen
7 Fazit und Ausblick
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Die Gesellschaft postmoderner Industrieländer befindet sich im Umbruch. Tradition und unstrittig akzeptierte Lebensmuster sind auf dem Rückzug (Peukert, 2012, S. 149-150). Beruf, Wohnort oder Rollenverständnis sind Schauplätze eines Pluralisierungs- und Individualisierungsprozesses, welcher einerseits für den Einzelnen immer mehr Optionen bereithält, andererseits die Aufgabe sich zu entscheiden immer akuter werden lässt (Keupp et al., 2002, S. 46-52). Während jedoch in den 1960er Jahren die „sexuelle Revolution“ im Mittelpunkt aller Veränderungen stand und die 1980er Jahre eine umfassende Genderdebatte hervorbrachten, verhandelt der aktuelle Diskurs besonders das gesellschaftliche Verständnis von Partnerschaft und Familie (Peukert, 2012, S. 151). Für den Einzelnen bedeutet dies auch Abschied von tradierten Beziehungsentwürfen zu nehmen. Neben den klassischen Beziehungsmodellen wie der Ehe oder der Lebenspartnerschaft etablieren sich zunehmend Formen einer seriellen Monogamie und Biographien mit langer Partnerlosigkeit. Sich selbst als kontinuierlich, kohärent und einheitlich zu erleben, erscheint in Zeiten einer unsteten und vom Wandel geprägten Beziehungswelt immer schwieriger (Abels, 2010, S. 427). Dass dies jedoch zu einer breiten Abkehr von traditionellen Beziehungsidealen führt, ist nicht zu beobachten. Zwar sind die Trennungs- und Scheidungsraten hoch, doch dies gilt genauso für den prozentualen Anteil derer, die nach erfolgter Trennung erneut heiraten (Statistisches Bundesamt, 2015). Und während Online-Partnerbörsen boomen und Millionen Menschen sich immer effizienter auf die Suche nach dem richtigen Partner begeben, aller statistischer Entwicklung zum Trotz, scheint das mehrheitliche Identitätsverständnis weiter auf klassischen Beziehungsformen zu fußen (Moucha et al., 2014, S. 4). Die zunehmende Beziehungsmobilität bringt jedoch auch Kostverächter dieser Entwicklung hervor, die ihr Glück weit ab von bisherigen Modellen suchen. So entstehen Beziehungsformen deren Verfechter sich offensichtlich völlig von jeder normativen Orientierung lossagen wollen. Mit der Polyamorie hat sich ein Konzept entwickelt, deren zentraler Bestandteil in der bewussten Zustimmung zu Beziehungspluralität besteht. So bilden polyamore Menschen ein Netzwerk intimer Beziehungen aus, im Gegensatz zur Affäre oder offenen Ehe jedoch auf Gleichberechtigung fußend und über die sexuelle Ebene hinausgehend (Lautmann, 2015, S. 38). Es stellt sich die Frage, welcher gesellschaftliche Blick und welches individuelle Identitätsverständnis diesem Lebensentwurf zugrunde liegen.
Die vorliegende Forschungsarbeit hat zum Ziel, das Selbstverständnis polyamorer Menschen zu erheben und zu charakterisieren. Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über die Herkunft und Bedeutung des Identitätsbegriffs gegeben. Darauf aufbauend findet nachfolgend eine Betrachtung der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse statt. Im Anschluss erfolgt eine merkmalsgeleitete Einordnung des Phänomens der Polyamorie. Es folgt die tiefergehende Untersuchung der Fragestellung. Hierzu wird zunächst die methodische Vorgehensweise vorgestellt, an die eine nach Erlebnisfeldern geordnete Darstellung der Ergebnisse anknüpft. Zur Erforschung wurden fünf problemzentrierte Interviews mit polyamoren Personen geführt. Die dabei entstandenen Ergebnisse sind Grundlage für die anschließende Diskussion. Zudem findet eine kritische Bewertung der erzielten Ergebnisse und der dabei verwendeten Methoden statt. Die Arbeit wird durch ein Fazit und eine Darstellung möglicher Anknüpfungspunkte zukünftiger Forschung abgerundet.
2 Theoretischer Hintergrund
Der folgende Abschnitt behandelt neben der theoretischen Grundlage des Identitätsbegriffs auch dessen Beziehung zu aktuellen gesellschaftlichen Änderungsprozessen. Des Weiteren werden die Besonderheiten einer polyamoren Beziehungsführung dargelegt und unter Bezugnahme auf geläufigere Beziehungsformen verortet. Anschließend wird die inhaltliche Verknüpfung der beiden Forschungsaspekte Identität und Polyamorie erörtert.
2.1 Klärung des Identitätsbegriffs
Der Begriff der „Identität“ wird immer wieder unterschiedlich verwendet. Das Begriffsverständnis differiert dabei nicht nur je nach wissenschaftlichem Kontext, sondern ist auch in seiner Historie immer wieder Umdeutungen unterzogen worden (Petzold, 2012, S. 407-408). Es ist daher zweckmäßig, das nachfolgende Begriffsverständnis zu klären und begründet von anderen Interpretationsweisen abzugrenzen.
2.1.1 Begriffliche Herkunft
Es erscheint zunächst sinnvoll, die semantische Herkunft des Begriffs genauer zu betrachten. Der Begriff „Identität“ stammt vom lateinischen Wort „idem“ ab und bedeutet übersetzt „derselbe“ (Prestel, 2013, S. 30). Die Übersetzung deutet somit auf die Einheitlichkeit und Gleichheit des beschriebenen Gegenstands hin. Die Frage nach der Einzigartigkeit und Beständigkeit einer Sache oder einer Person ist bereits sehr alt und wurde bereits in der Antike diskutiert (Müller, 2011, S. 19–20). So können Platon und Aristoteles als Pioniere der Identitätsforschung betrachtet werden. Naturbeobachtungen, wie beispielsweise die Betrachtung der Jahreszeiten oder der Zustandsveränderung von Holz in Asche durch den Einsatz von Feuer gaben hierbei die Art der Herangehensweise vor. Die zentrale Frage war, wann von Beständigkeit der Dinge ausgegangen werden kann und was diese Beständigkeit im Kern ausmacht (Stroll, 1972, S. 121). Diese ursprüngliche Interpretation wurde allerdings noch nicht auf den Menschen im Speziellen, sondern auf generell alle Objekte der Lebenswelt angewandt.
Das allgemeine Sprachverständnis des Identitätsbegriffs ist maßgeblich durch den Psychoanalytiker Erik Erikson geprägt. Dieser entwickelte, basierend auf den Theorien Sigmund Freuds zur psychosexuellen Entwicklung, das epigenetische Schema der Identitätsentwicklung (Erikson, 1983, S. 28-41). Dies sah vor, dass der Mensch im Laufe seines Lebens einzelne Stufen, nebst jeweiligen Entwicklungsaufgaben, durchläuft, die dessen individuelle Entstehung einer Identität begründen. Dabei handelte sich um eine gesetzmäßige Abfolge von Entwicklungsschritten, hin zu einer stabilen, im Erfolgsfall gelungenen Identität (Noack, 2010, S. 37). Eriksons Ansatz fand in der Folge viel Beachtung und führte zu einer gesellschaftlich breiteren Wahrnehmung des Terminus der Identität. Der Identitätsbegriff wird hierbei vom Gedanken an etwas Festes und Kontinuierliches geprägt. Diese Kontinuitätsvorstellung und der Aufbau einer unveränderlichen Ich-Identität werden bei jüngeren Identitätskonzeptionen kritisch betrachtet. Zwar ist das allgemeine gesellschaftliche Verständnis des Begriffs „Identität“ nach wie vor durch die Vorstellungen Eriksons geprägt, die Idee eines individuellen „Kern-Selbst“ scheint die Wandelbarkeit, die das menschliche Verhalten auszeichnet, nach heutigen Maßstäben jedoch nur unbefriedigend abzubilden (Schäfer, 2015, S. 684). Aus Sicht des Autors erscheint es daher zweckmäßig die klassische Begriffsdefinition für die nachfolgende Untersuchung um aktuelle Konzeptionen zu ergänzen.
2.1.2 Postmoderne Begriffsinterpretation
Der klassische Identitätsbegriff ist heutzutage umstritten. So wird zu Teilen sogar die völlige Abkehr von einem Identitätsbegriff gefordert (Klika, 2000, S. 285). Derzeitige sozialpsychologische Ansätze kritisieren vor allem die Starrheit des herkömmlichen Identitätskonzepts. Die Anforderungen an eine Person seien in der heutigen Gesellschaft vielschichtig und divergent und ließen sich daher unmöglich in einem unveränderbaren Persönlichkeits-Kern unterbringen (Lenz, 2009, S. 206). Heiner Keupp hat im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Identitätsmodell von Erikson den Begriff der „Patchwork-Identität“ geprägt (Keupp, 1998, S. 17). Dieser geht auf das Problem einer widersprüchlichen und unvollständigen Alltagserfahrung der Individuen ein. Bereits vorangegangene Wissenschaftsströmungen hatten auf die Wichtigkeit der Interaktion mit der Umwelt für die Entwicklung des Selbstbilds hingewiesen. So deuteten Gerth und Mills (1970, S. 77) die Identitätsentwicklung als einen Prozess, der maßgeblich durch die Einschätzungen des sozialen Umfelds getrieben ist. Das Selbstbild entwickle sich folglich vor allem durch die jeweiligen äußeren sozialen Bedingungen und nicht durch eine, dem Ganzen zugrunde liegende innere Kraft. Dieser Überlegung liegt jedoch nach wie vor ein stabiles Selbstbild zugrunde, zumindest beim erwachsenen Individuum. Zwar spielt auch bei Keupp nach wie vor der Gedanke einer kontinuierlichen Selbstwahrnehmung eine Rolle, diese Innensicht des Individuums ist aber als Interpretation und nicht als objektive Begebenheit zu bewerten (Keupp et al., 2002, S. 263-265). Der Mensch handle und interagiere widersprüchlich und unterscheide sich folglich deutlich von der durch Kontinuität und Stringenz geprägten Selbstwahrnehmung. Das Individuum bildet kein tatsächliches „Kern-Selbst“ aus, es konstruiert vielmehr eine Vorstellung von sich selbst, die die Widersprüchlichkeit der eigenen Erfahrungen in einen logischen Zusammenhang bringt. Es handelt sich bei der Identitätsbildung also mehr um einen kreativen Prozess der Selbstorganisation als eine Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse. Das Individuum muss sich selbst und die Individuen mit denen es in Kontakt tritt von dem Umstand überzeugen, dass es nach wie vor die Person ist, die es in der Vergangenheit war. Diese, als Identitätsarbeit zu bezeichnende Aufgabe, ist nur mit Hilfe anderer möglich. Durch Interaktion des Individuums mit anderen kann der Eindruck einer aufrechterhaltenen Kontinuität bestätigt werden und ist dadurch erst letztlich für das Individuum erlebbar. Dabei wird die eigene Vergangenheit unter gegenwärtigen Bedingungen uminterpretiert (Abels, 2010, S. 391).
Frühere Entscheidungen und Verhaltensweisen können dabei in einen sinnvoll erscheinenden Zusammenhang mit der Gegenwart gebracht werden (Kohärenz). Das Individuum erhält dabei den Eindruck von Beständigkeit (Kontinuität). Es entsteht der Eindruck einer inneren Logik, die den Wunsch des Individuums nach Kohärenz und Kontinuität befriedigt. Die Vorstellung, einer vollintegrierten Persönlichkeit, die auf die Frage: „Wer bin ich?“ eine klare Antwort hat, weisen Keupp et al. (2002, S. 16 - 19) daher als historisch gewachsen zurück.
2.2 Identität im gesellschaftlichen Wandel
Im Folgenden werden gesellschaftliche Veränderungsprozesse unter Bezugnahme auf postmoderne Identitätstheorien vorgestellt. Insbesondere erfolgt die zur Einordnung des polyamoren Partnerschaftsverständnisses notwendige Darstellung reformierter gesellschaftlicher Beziehungsstrukturen.
2.2.1 Gesellschaftliche Entgrenzungsprozesse
Die Erschaffung eines kohärenten und kontinuierlichen Selbstbilds wird im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Waren für frühere Generationen viele Aspekte des Lebens noch durch gesellschaftliche Konventionen vorgegeben, sind sie heute eine Frage der persönlichen Entscheidung. Beispielhaft kann dies an den beiden Lebensbereichen Berufswahl und Geschlechterrolle veranschaulicht werden. Waren frühere Generationen aufgrund familiärer Traditionen in der Entscheidung über ihre berufliche Tätigkeit häufig noch sehr eingeschränkt, der Bäckersohn trat beispielsweise selbstverständlich in die Fußstapfen des Vaters und übernahm den Familienbetrieb, ist die Berufswahl mittlerweile häufig Ausdruck eigener Überzeugungen und Resultat vielschichtiger Abwägungsprozesse (Dimbath, 2003, S. 124). Eine ähnliche Veränderung der Lebenswelt ist bei Betrachtung der Geschlechterrollen zu verzeichnen. So hat spätestens die Frauenbewegung seit den 1960er Jahren Selbstverständlichkeiten und klassische Rollenverteilungen aufgebrochen (Keupp et al, 2002, S. 51; Peukert, 2012, S. 151). Häusliche Arbeitsteilung oder Kindererziehung sind nicht mehr durch gesellschaftliche Normen klar geregelt. Sie sind individuelle Verhandlungssache (Keupp et al, 2002, S. 51). Im Gegensatz zu früheren Gesellschaften existieren heute kaum noch festgelegte Erfahrungswelten, die für alle Mitglieder einer Gesellschaft gleichermaßen bestehen. Normative Vorstellungen von „richtig“ und „falsch“ gelten immer seltener für jedes Individuum, sondern häufig nur noch innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe (Welsch, 1990, S. 94). Hinzu kommt, dass die Individuen in der Regel nicht nur in einer einzigen gesellschaftlichen Gruppe verkehren, sondern sich durch Schule, Beruf und Freizeitgestaltung in unterschiedlichen Kontexten agieren. Dies führt dazu, dass die gemachten Erfahrungen, aber auch die erfolgten Handlungen, je nach Kontext, stark voneinander abweichen und teilweise sogar gegenläufiger Natur sind (Abels, 2010, S. 422-423). Im Umgang mit pluralistischen Erlebnissen kann das Festhalten an bestimmten Überzeugungen und die damit einhergehende Abgrenzung von Andersdenkenden als identitätsbildender Prozess angesehen werden (Kneidinger, 2013, S. 38). Der Prozess wird dabei durch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und der Entscheidung zu dessen Verteidigung oder Ablehnung gestützt (Abels, 2010, S. 429).
Zur Strukturierung der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse bestehen unterschiedliche Gliederungsansätze und Schwerpunktsetzungen (Walzer, 1993, S. 164-170; Keupp, 2008, S. 298; Schäfer, 2015, S. 669-686) Für die nachfolgende Untersuchung erscheint es zweckmäßig, die Veränderungsprozesse nach Walzer zu strukturieren, da dieser Ansatz das zwischenmenschliche Verhalten und den für die nachfolgende Untersuchung wichtigen Aspekt der Beziehungskonstruktion thematisiert.
Der gesellschaftliche Entgrenzungsprozess lässt sich nach Walzer (1993, S. 164) als eine Zunahme von vier Formen der Mobilität beschreiben: der geographischen Mobilität, der sozialen Mobilität, der politischen Mobilität sowie der Beziehungsmobilität.
Die geographische Mobilität beschreibt den Umstand, dass Wohnortswechsel heute deutlich häufiger stattfinden, als dies in vorherigen Generationen der Fall war. Begründet vor allem durch berufliche Umstände, steigt die Umzugsrate deutlich an. Die eindeutige Identifikation mit einem einzelnen Ort als „Heimat“ wird dadurch unwahrscheinlich. Das Individuum muss zunehmend selbst entscheiden, was als persönlicher Rückzugs- und Herkunftsort anzusehen ist (ebd., S. 164-165).
Die Zunahme der sozialen Mobilität beschreibt den Umstand, dass weniger Menschen den gesellschaftlichen Platz ihrer Eltern einnehmen. Traditionen werden nicht weitergeführt oder spielen zumindest eine geringere Rolle (ebd., S. 165).
Die schwindende Loyalität gegenüber politischen Parteien oder kommunalen Institutionen wird von Walzer als politische Mobilität beschrieben. Die Anzahl derer, die sich dauerhaft an eine bestimmte Gruppierung oder Partei binden, sinkt. Die Instabilität der Institutionen dagegen steigt (ebd., S. 166).
Die sinkende Häufigkeit dauerhafter Beziehungen, der Anstieg von Scheidungsraten, sowie die Zunahme von Wiederverheiratungen beschreibt Walzer als Beziehungsmobilität. Diese als unstetig wahrnehmbaren Beziehungsverhältnisse erschweren die kulturelle Verortung des Individuums (ebd., S. 165).
Um die Folgen der Beziehungsmobilität für die Konstruktion einer kohärenten Selbstwahrnehmung besser abschätzen zu können, ist eine genauere Untersuchung der Beziehungsverhältnisse innerhalb unserer Gesellschaft als zielführend zu betrachten.
2.2.2 Veränderungen der Beziehungswelt
Es stellt sich die Frage, ob die im Modell beschriebene Fluktuation der Beziehungen oder eine veränderte Beziehungsdynamik auch innerhalb unserer Gesellschaft beobachtbar ist. Um sich der Frage zu nähern, erscheint eine genauere Betrachtung heutiger Beziehungsbiographien zielführend. Hierzu werden Kohorten unterschiedlichen Alters einem Vergleich bezüglich der vorherrschenden Beziehungsmuster unterzogen.
Betrachtet man dazu die Kohorten der Jahrgänge 1982 bis 1965, so ist im Vergleich zu Personen höheren Alters ein deutlicher Anstieg der Lebensformenwechsel dieser Kohorten zu beobachten (Brüderl, 2004, S. 3-10). Als Lebensform werden im vorliegenden Fall vier unterschiedliche Zustände bezeichnet: 1. Partnerlosigkeit bzw. keine feste Beziehung, 2. Partnerschaft jedoch ohne gemeinsamen Wohnraum (Living-Apart-Together), 3. nichteheliche Lebensgemeinschaft, 4. Ehe. Mit Blick auf die Kohorten des Jahrgangs 1944 bis 1982, weist die Literatur besonders auf zwei Entwicklungen hin: Einerseits ist eine deutliche Zunahme der Personen zu verzeichnen, die gar keinen Lebensformwechsel bekunden, d.h. dauerhaft ohne festen Partner leben. Andererseits steigt auch die Zahl derer, die vier bis sieben Lebensformwechsel aufweisen, die als „bunte“ Lebensverläufe bezeichnet werden (ebd., S. 10). Es ist folglich eine deutliche Polarisierung der Lebensverläufe festzustellen. Der klassische Lebenslauf mit einem Ereignis, nämlich der Heirat, oder zumindest zwei Ereignissen, der nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit anschließender Heirat, wird durch beide Faktoren seltener beobachtbar. Hierauf verweist auch eine weitere Studie zu „Spätmodernen Beziehungswelten“ von Schmidt et al. (2006, S. 24). Dabei wurden drei Geburtsjahrgänge (1942, 1957 und 1972) von Männern und Frauen mit dem Wohnsitz Hamburg mit Blick auf Lebensformenwechsel verglichen. Die Kohorten zeigen hinsichtlich ihres Beziehungsverhaltens deutliche Unterschiede: So hatte die jüngste Kohorte im Durchschnitt bereits mehr Paarbeziehungen im Verlauf des Lebens als die 30 Jahre ältere Kohorte der im Jahr 1942 Geborenen. Auch die Dauer der einzelnen Beziehungen ist im Fall der jüngeren Studienteilnehmer deutlich reduziert, selbst dann, wenn eine rechnerische Berücksichtigung des vergleichsweise kürzeren Lebens stattfindet. Während 61% der 1942 Geborenen im Alter von 30 Jahren bereits eine 5 Jahre oder länger bestehende Beziehung hatten, gilt dies nur für 32% der 1972 Geborenen. Da diese Beziehungswechsel nicht übergangslos auftreten, die Beziehungen jedoch immer kürzer andauern, steigt gleichzeitig auch der Anteil derer, welche sich in einer Zwischenperiode ohne festen Partner befinden (Schmidt et al., 2006, S. 24). Im Querschnitt lassen sich eine höhere Frequenz an Beziehungswechseln, eine kürzere Beziehungsdauer sowie ein wachsender Anteil partnerschaftsloser Personen feststellen.
Werden die Beziehungsbiographien jüngerer Personen mit denen älterer Personen verglichen, so zeigt sich auch eine deutliche Verschiebung bezüglich der jeweils präferierten Beziehungsform. So ist bei Betrachtung der individuellen Beziehungsbiographien der Anteil derer, die sich seriellen Beziehungsmustern zurechnen lassen, im Kohortenvergleich von 4% (1942 Geborene) auf 39% (1972 Geborene) gestiegen. Zugenommen hat auch der Anteil derer, bei denen sich kürzere Zeiten in einer Partnerschaft und längere partnerschaftslose Zeiten abwechseln, nämlich 2% (1942) im Vergleich zu 12% (1972). Gleiches gilt für den Anteil der Personen, die keiner der untersuchten Beziehungsformen zuzuordnen sind 4% (1942) im Vergleich zu 8% (1972). Traditionelle Beziehungsbiographien, die eine einzige kontinuierliche Beziehung beinhalten, sind dagegen seltener geworden. Geben von den 1942 Geborenen 76% an, mit 30 Jahren eine einzige und dauerhafte Partnerschaft gehabt zu haben, sind es bei den 1972 Geborenen nur noch 31%. Es ist folglich von einer Pluralisierung der Lebens- und Familienformen auszugehen (Peukert, 2012, S. 151).
Die Pluralisierung betrifft jedoch vornehmlich die Verteilung der bereits bestehenden Beziehungsformen. So ist keine Konzentration auf eine bestimmte Form mehr zu beobachten, sondern die Anteile sind stärker auf unterschiedliche Beziehungsformen verteilt. Die Heterogenität der jüngeren Kohorten hat sich erhöht (Brüderl, 2004, S. 8-10). Weniger große Veränderungen sind hinsichtlich der Neuentstehung von Familienformen zu verzeichnen. Zwar fand eine Verdopplung des Anteils der zuzurechnenden Personen statt (von 4% auf 8%), welche sich keiner der bestehenden Formen zuordnen lassen. In Bezug auf die Gesamtkohorte handelt es sich jedoch nach wie vor um eine deutliche Minderheit (Peukert, 2012, S. 150). Die Anzahl der Lebensformen hat sich bei Betrachtung der absoluten Ausprägung gleichwohl erhöht (Peukert, 2012, S. 148). Gesellschaftliche Einschränkungen haben abgenommen. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Beziehungsformen abseits der Ehe ist im Verlauf der Jahre gestiegen (Lautmann, 2015, S. 29-30). Dennoch sind nach wie vor auf Dauerhaftigkeit ausgelegte Beziehungsformen höher anerkannt als andere und werden von einem Großteil der Gesellschaft angestrebt (Peukert, 2012, S. 158). Dies gilt auch für das Werteprinzip der Monogamie, das eine wechselseitige sexuelle Treueerwartung an den Partner beinhaltet. So erhoffen sich unabhängig vom Alter über 90% der befragten Hamburger komplementäre sexuelle Treue innerhalb ihrer aktuellen Partnerschaft (Schmidt et al., 2006, S. 133). Ein Abgleich mit Erhebungen zur sexuellen Treueerwartung von Studierenden aus den Jahren 1981 und 1996 legt zudem den Schluss nahe, dass sexuelle Treue heutzutage sogar einen höheren Stellenwert in festen Beziehungen einnimmt, als dies für vorherige Generationen galt (Schmidt et al., 1998, S. 125).
Wie auch bei der angestrebten Dauerhaftigkeit einer Beziehung, besteht auch mit Blick auf die Erwartung von sexueller Treue häufig ein deutlicher Unterschied zwischen angestrebtem Beziehungsverhältnis und tatsächlicher Begebenheit. Betrachtet man das sexuelle Verhalten, so sind nur 72% in der aktuellen Beziehung und 50% in allen bisherigen Beziehungen nach eigener Einschätzung treu gewesen (ebd., S. 136). Dabei unterscheiden circa ein Viertel der Personen nochmals zwischen männlicher und weiblicher Untreue. So wird von 19% der Frauen und 26% der Männer bei der grundsätzlichen Beurteilung von untreuem Verhalten, die Untreue der Frau als verwerflicher bewertet als dies gleichermaßen für männliche Untreue gilt. (Volz & Zulehner, 2009, S. 73).
Von einem breiten gesellschaftlichen Wertepluralismus hinsichtlich der Bewertung unterschiedlicher Lebens- und Beziehungsformen kann in der Folge nicht ausgegangen werden. Dennoch, die absolute Zahl unterschiedlicher Lebensformen hat zugenommen (Peukert, 2012, S. 148). Die Wahl der Beziehungsform ist in weitaus weniger großem Umfang durch gesellschaftliche Restriktionen vorgegeben (Lautmann, 2015, S. 29-30). Die Entscheidung über die angestrebte Beziehungsform wird zunehmend durch individuelle Faktoren bestimmt. (Brüderl, 2004, S. 10). Dies ist einerseits mit einer größeren Gestaltungsfreiheit des Individuums verbunden. Andererseits erhält das Individuum auch weniger Orientierung durch normative Vorgaben hinsichtlich der Konfiguration der eigenen Beziehung.
Hinzu kommt, dass sich ein kontinuierliches Selbstbild durch stabile Umweltfaktoren leichter einstellt (Keupp et al., 2002, S. 47). Wechselnde Partnerschaften erzeugen dabei nicht automatisch das gleiche Kontinuitätserlebnis des Individuums, wie es für eine einzige, beständige Partnerschaft gilt. Die Kognition eines kontinuierlichen Selbstbilds ist für den Fall einer seriellen Beziehungsbiographie komplexer als dies in gleicher Weise für eine klassische Beziehungsbiographie gelten würde. Es ergibt sich ein Erklärungsansatz für den nach wie vor weit verbreiteten Wunsch nach einer dauerhaften Beziehung, trotz des Umstands, dass dieses Beziehungsmodell von immer weniger Individuen tatsächlich gelebt wird (Peukert, 2012, S. 158).
2.3 Das polyamore Beziehungskonzept
Im Folgenden werden die Merkmale einer polyamoren Beziehungsführung beschrieben und die Hauptformen der Polyamorie erklärt.
2.3.1 Merkmale der Polyamorie - Definition und Abgrenzung
Es gibt eine Vielzahl an Einteilungsmöglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen. Eine Gliederung kann zum Beispiel anhand normativer Kriterien, wie des gesetzlichen Beziehungsstatus in ledig, verheiratet, usw. erfolgen. Auch eine Sortierung nach der Intensität der emotionalen und motivationalen Komponenten, die eine Beziehung beinhaltet, ist denkbar (Sternberg, 1986, S. 119-135). Für die Einordnung der Polyamorie sind diese Klassifikationsformen jedoch nicht zielführend, da Beziehungsstatus und die jeweilige Emotionslage sich innerhalb polyamorer Beziehungen nicht einheitlich darstellen (Lautmann, 2015, S. 38-39). Zur Erfassung des Polyamoriebegriffs ist eine Definition anhand der einzelnen Merkmale einer solchen Beziehung notwendig. Zum besseren Verständnis erfolgt dabei jeweils ein Hinweis auf Beziehungsformen, die sich in manchen Aspekten der Polyamorie gleichen und sich meist nur im jeweils betrachteten Merkmal unterscheiden. Ausgehend von dieser Definition kann im nächsten Schritt das Verhältnis zu anderen Beziehungsformen geklärt werden.
Der Begriff Polyamorie ist ein Neologismus, der aus dem griechischen „poly“ für „viele / mehrere“ und dem lateinischen „amor“, übersetzt „Liebe“, gebildet wird (Boehm, 2014, S. 275). In erster Linie betont der Begriff nur die romantische Anziehung von mehreren Personen auf das Individuum. Nach Rüther (2005, S. 52-54) kann Polyamorie jedoch genauer durch vier Merkmale von anderen Beziehungsformen abgegrenzt werden.
Als erstes kennzeichnet eine polyamoröse Beziehung die „erotische Liebe mit mehr als einer Person“ (ebd., S. 53). Hierbei sind nicht nur Sexualität und Zuneigung, sondern jede Form von Zärtlichkeit gemeint, die innerhalb eines Zeitraums zwischen mehr als zwei Personen stattfinden. Damit grenzt sich Polyamorie zum einen von platonischer Freundschaft und zum anderen von Monogamie ab.
Zweitens sind Transparenz und Ehrlichkeit zentrale Aspekte einer polyamoren Beziehung. So wissen die jeweiligen Partner von der Koexistenz weiterer Beziehungen ihres / ihrer Partner. Das Beziehungsnetzwerk ist für alle Beteiligten einsehbar. Auch der Versuch, Teile eines Beziehungskonstrukts vor Partnern geheim zu halten, wird nicht unternommen. Damit ist Polyamorie von Affären und Seitensprüngen abzugrenzen.
Als dritter Kernaspekt werden die Gleichberechtigung und der Konsens der Beteiligten genannt. Die jeweiligen Partner müssen grundsätzlich bereit sein, die vorhandenen Beziehungen anzuerkennen oder zumindest ihre Bereitschaft zeigen, einen Konsens über die bestehenden Beziehungen zu erzielen. Dabei fließen die Bedürfnisse aller Beteiligten mit gleichem Gewicht ein. Durch diesen gleichberechtigten Beziehungsansatz unterscheidet sich Polyamorie von Polygynie oder Polyandrie, welche auf der Dominanz des männlichen oder weiblichen Teils einer Beziehung fußt.
Als viertes Merkmal ist die langfristige Ausrichtung der Beziehungsführung zu nennen. So besteht bei den beteiligten Personen die grundsätzliche Intention, langfristige Beziehungen einzugehen. Zwar sind kurzfristige sexuelle Kontakte für die Beteiligten nicht grundsätzlich ausgeschlossen, eine Integration solcher Kontakte in die bestehenden Beziehungen ist jedoch meist nicht vorgesehen. Hierbei unterscheidet sich Polyamorie vom Swingen oder einer offenen Beziehung, die auf kurzfristige Sexualkontakte abzielen (ebd., S. 54).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Beziehungsformen im Überblick. (Eigene Darstellung).
2.3.2 Formen polyamorer Beziehungskonstrukte
Häufig werden polyamore Beziehungen nochmals in drei Unterformen unterschieden (Wirth, undatiert; Rüther, 2005, S. 72-79). Die erste Kategorie beschreibt Personen die in einer priorisierten Beziehung leben, sogenannte „Primary“, und daneben weitere Beziehungen führen, „Secondary“ genannt. Diese Unterscheidung entsteht häufig aus strukturellen Gründen, da z. B. gemeinsame Kinder, finanzielle Pflichten oder ein gemeinsamer Haushalt existieren, was der betreffenden Beziehung eine gesonderte Stellung einräumt (Rüther, 2005, S. 73-74). Eine weitere Gruppe wird durch Personen gebildet, die in mehreren Primary leben. Es handelt sich dabei um gleichberechtigte Dreier-, Vierer- oder Mehrfachbeziehungen. Dabei besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Begrifflichkeiten für unterschiedliche Gruppengrößen, die sich jedoch nur in der Anzahl der beteiligten Personen unterscheiden, ansonsten aber nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Die geläufigsten Begriffe lauten dabei: „Triade“ bei exakt drei beteiligte Personen, „Polyfidelity“ wenn mehr als drei Personen beteiligt sind, „Poly-Familie“, „Netzwerk“ oder „Polykül“ für eine Gruppe mit unbestimmter Größe (Rüther, 2005, S. 69-81). Eine dritte Gruppe bilden Personen, die in keiner Primary-Beziehung leben, sogenannte Poly-Singles. Personen dieser Gruppe verzichten dabei absichtlich auf eine Primärbeziehung (Wirth, undatiert). Im Zuge der vorliegenden Arbeit wurden Personen aller Kategorien befragt, um mögliche Unterschiede zwischen persönlichen Einstellungen, Identitätskonstruktionen und Wertvorstellungen aufzudecken und in die Ergebnisse einfließen zu lassen.
Das Lebensmodell der Polyamorie ist im Allgemeinen mit einer betont verhandelbaren und individuellen Beziehungsgestaltung verbunden. Es ergeben sich daher vielfältige Beziehungskonstellationen, die sich in ihrem Aufbau zum Teil deutlich voneinander unterscheiden (Rüther, 2005, S. 71). Allen gemein ist dabei jedoch immer das Bekenntnis zu den in Kapitel 2.3.1 aufgeführten Grundsätzen: Mehrpersonenliebe, Transparenz, Gleichberechtigung und Langfristigkeit.
2.4 Konklusion
Sowohl die serielle Monogamie als auch die Polyamorie gehen mit dem Umstand einher, mit mehreren Partnern und unterschiedlichen Beziehungswelten konfrontiert zu sein. Im Fall der seriellen Monogamie erfolgt der Beziehungswechsel jedoch zeitlich aufeinander folgend. Das Individuum verfolgt dabei in aller Regel das Ziel einer einzigen dauerhaften Beziehung. Wie auch Personen, die in einer Ehe oder in einer nichtehelichen Partnerschaft leben, liegt der Fokus auf der Schaffung einer Beziehung, die dauerhaft und singulär fortbesteht. Der Unterschied besteht zur Ehe und nichtehelichen Partnerschaft allein im Erfolg hinsichtlich der Umsetzung dieses Ziels. Diese gedankliche Zielsetzung gilt auch für Menschen in offenen Beziehungen oder Swinger, die zwar den sexuellen Aspekt einer Beziehung pluralisieren, dies jedoch auf Sexualität als einzelnen Baustein begrenzen und sich hinsichtlich ihres Beziehungsverständnisses nicht von den zuvor genannten Beziehungsformen unterscheiden. In allen Fällen scheint eine einzelne Dauerbeziehung relevant für die Schaffung eines kohärenten und kontinuierlichen Selbstbilds.
Anders verhält es sich mit Personen, die einen polyamoren Lebensstil verfolgen. Die Konstruktion eines kohärenten und kontinuierlichen Selbstbilds scheint nicht mit dem Führen einer singulären, dauerhaften Beziehung verknüpft. Schlussfolgernd muss angenommen werden, dass der Wunsch sich selbst als kontinuierlich wahrzunehmen, entweder nicht vorhanden ist oder auf andere Weise befriedigt werden kann. Auf die Möglichkeit, mit dem Führen einer Ehe oder einer nichtehelichen Partnerschaft die kohärente Selbstwahrnehmung zu verbessern, wird gänzlich verzichtet. Es stellt sich aus Sicht des Autors die Frage, welches Identitätsverständnis eine solche polyamore Lebensweise begründet.
3 Methodisches Vorgehen
Im folgenden Abschnitt werden die angewandten methodischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit vorgestellt. Ziel ist dabei zum einen, die Wahl der verwendeten Mittel zu erklären, sowie deren spezielle Wirkungsweise darzulegen. Im Anschluss werden die Methoden zur Ermittlung der Untersuchungsgruppe vorgestellt.
3.1 Gegenstand und Paradigmen der qualitativen Forschung
Qualitative Forschung behandelt insbesondere Prozesse und Phänomene aus Sicht der Beteiligten. Der Erkenntnisgewinn dieser Forschung entsteht durch die Interpretation der Summe von Einzelsichten. Hierbei können soziale Muster oder Konzepte aufgedeckt werden (Helfferich, 2011, S. 22). Die Bewertung der sozialen Interaktion folgt meist entweder dem interpretativen oder dem normativen Paradigma nach Wilson (1970, S. 56-58). Soziale Interaktion wird nach Wilson als ein interpretativer Prozess verstanden. Die Individuen treten durch Handlungen miteinander in Beziehung. Die jeweiligen Handlungen des Einen führen beim Gegenüber zu Reaktionen. Diese Reaktionen erfolgen nicht frei vom Gegenüber, vielmehr sind sie das Ergebnis eines antizipativen Prozesses, in den Erwartungen an die Handlungsweisen des Gegenübers einfließen.
Das normative Paradigma beschreibt diese Interaktion der Individuen als geprägt von Vorannahmen, Normen und eindeutigen Haltungen. Jede Person tritt mit individuellen Einstellungen und Bedürfnissen sowie expliziten Ansichten über die Welt in die Handlung ein. Auf Basis dieser Grundlage erfolgen anschließend Handlungen innerhalb einer sozialen Situation.
Im Fall des interpretativen Paradigmas wird die soziale Interaktion als ständiger, aktiver und kreativer Deutungsprozess verstanden. Die gezeigte Interaktion erklärt sich durch eine vorausgehende Interpretation beider Seiten. Ein erfolgreicher Informationsaustausch kann nur gelingen, wenn beide Seiten die Situation auf einer Ebene interpretieren. Dieser Deutungsprozess ist jedoch nicht stabil, sondern wird stetig revidiert (Wilson, 1970, S. 61).
Für die nachfolgende Untersuchung wurde der Ansatz des interpretativen Paradigmas gewählt. Die einheitliche Interpretation der Interviewfragen, durch Interviewer und Interviewten ist während des Erhebungsprozesses von hoher Relevanz, wird durch den Autor jedoch nicht als grundsätzlich gegeben angenommen, sondern erscheint vielmehr das Ergebnis einer erfolgreichen Kommunikation zu sein. Besonders deutlich wird dies bei Begriffen wie z. B. „Identität“ oder „Beziehung“, deren Interpretationsspielraum in den Kapiteln 2.1 und 2.3 vorgestellt wurde.
Qualitative Forschungsverfahren und quantitative Forschungsverfahren grenzen sich vor allem durch den Charakter des Untersuchungsgegenstands voneinander ab. Während in einem quantitativen Forschungssetting der Informationsgewinn nur durch die numerische Messbarkeit der untersuchten Variable möglich ist und deren Interpretation mithilfe statistischer Methoden erfolgt, rekonstruiert qualitative Forschung die subjektiven Sichtweisen des Untersuchungsgegenstands (Helfferich, 2011, S. 21-24).
Für die vorliegende Fragestellung ist eine qualitative Vorgehensweise zu präferieren, da diese nicht nur auf die statistische Klärung eines Zusammenhangs abzielt, sondern das grundsätzliche Verständnis für Interaktionsbeziehungen in den Vordergrund stellt (Mayring, 2002, S. 9). So ist die Zielsetzung dieser Arbeit auch vor allem das Verständnis der Präferenz eines polyamoren Beziehungskonstrukts und dem zugrundeliegenden Identitätsbild. Ebenso für eine qualitative Vorgehensweise spricht, dass es sich bei der Fragestellung nach dem Identitätsverständnis um das Erfassen einer individuellen Sichtweise handelt, und Subjektivität als Teil des Forschungssettings verstanden wird. Zudem besteht, wie für die qualitative Forschung vorgesehen, die Möglichkeit einer Felduntersuchung, da die Interviews im jeweiligen Umfeld der befragten Person durchgeführt werden. Dies ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Lebenswelt des untersuchten Individuums. Da Alltagssituationen jedoch variieren, ist die Replizierbarkeit der Ergebnisse kaum möglich (Bortz & Döring, 2006, S. 299).
3.2 Anwendung des problemzentrierten Interviews
Das Thema Identitätskonstruktion ist subjektiver Natur und erfordert daher ein Erhebungsverfahren, dass diese Prämisse berücksichtigt, indem es den befragten Individuen genügend Raum zur freien Äußerung gibt, ohne jedoch den Blick auf die Fragestellung zu verlieren. Die Methode des problemzentrierten Interviews (PZI) (Witzel, 2000) entspricht diesen Voraussetzungen am besten und findet daher Anwendung. Vor der Durchführung eines Interviews ist dafür eine umfassende Analyse der jeweiligen Problemstellung notwendig. Auch die theoriegestützte Erarbeitung eines Interviewleitfadens gibt dem PZI bereits ein thematisches Gerüst. Dieser halbstrukturierte Aufbau des Interviews erlaubt dennoch ausreichende Freiheiten zur offenen Beantwortung der Fragen durch den Interviewten. So sind zentrale Aspekte dieser Interviewform die Führung des Interviews unter subjektiver Orientierung an der interviewten Person. Das Interview soll dabei innerhalb einer vertrauensvollen Situation zwischen Interviewer und Interviewten stattfinden (Mayring, 2002, S. 67-69).
Es sind drei Grundprinzipien zu benennen, denen die Herangehensweise des PZI‘s Rechnung trägt. Als „Problemzentrierung“ bezeichnet Witzel (2000) eine Befragung durch den Interviewten, die unter Nutzung bereits generierten Wissens konsequent die gestellte Forschungsfrage fokussiert und die Kommunikation auf das Forschungsproblem zuspitzt. Die „Gegenstandsorientierung“ verweist auf eine flexible Handhabe der angewandten Methodik, orientiert am jeweiligen Forschungsgegenstand (ebd.). So muss nicht an einer bestimmten Erhebungstechnik festgehalten werden, sondern kann im Laufe des Erhebungsprozesses auch dem Wissenszuwachs angepasst werden. Um Vertrauen und Offenheit des befragten Individuums zu gewährleisten, wird als dritte Grundposition die „Prozessorientierung“ gefordert. Hierbei wird auf die Wichtigkeit von Sensibilität und Umsicht durch den Interviewer verwiesen. Eine akzeptierende Grundhaltung gegenüber den Aussagen des Interviewten sorgt für das notwendige Vertrauen zwischen Interviewer und Interviewtem (ebd.).
Da die vorliegende Fragestellung auch Fragen verlangt, die die Intimsphäre des Befragten tangieren, ist für eine erfolgreiche Durchführung des Interviews explizit die Prozessorientierung zu beachten. So wurde bei der Durchführung der Interviews im besonderen Maße auf eine annehmende Haltung des Interviewers, sowie eine angenehme, vertrauensvolle Interviewsituation Wert gelegt. Dies äußerte sich innerhalb des Forschungsprozesses auch darin, dass ein Interview auf Wunsch des Interviewten nicht zuhause, sondern in einem abgelegenen Ferienhaus durchgeführt wurde (Interview 1). Die Zielsetzung, einer angenehmen und den Diskretionsbedürfnissen des Forschungsgegenstands angepassten Vorgehensweise, konnte damit abgesichert werden. Ergänzend zu den Grundprinzipien des PZI’s wurden auch forschungsethische Implikationen zum Umgang mit Intimität bei der Gestaltung des Interviewleitfadens berücksichtigt (Langer, 2014, S. 169-189).
3.3 Betrachtung der Kernsatzmethode
Die mit der problemzentrierten Methodik geführten Interviews wurden mit der Kernsatzmethode ausgewertet. Diese ermöglicht es, das umfangreiche Gesprächsmaterial zu reduzieren ohne den Sinn oder die Komplexität des Inhalts zu mindern (Leithäuser & Vollmerg, 1988, S. 283). Einerseits ist eine Reduktion des qualitativen Materials notwendig, um dessen Kommunizierbarkeit zu gewährleisten. Anderseits soll dies geschehen, ohne dass Erlebniszusammenhang und Situationsbezug der Aussagen verloren gehen (ebd., S. 245).
Um diese beiden gegenläufig wirkenden Zielsetzungen zu erreichen, wird bei der Kernsatzmethode in einem ersten Schritt das komplette Interview mittels Tonbandaufzeichnung transkribiert. Anschließend wird das Transkript in Kernsätze zusammengefasst, welche auf einzelne Kernsatzkarten notiert werden. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Sortierung der Kernsätze aufgrund ihrer inhaltlichen Ähnlichkeit zu Kernsatzbündeln (ebd., S. 246). Thematische Wiederholungen durch den Interviewten sind dabei die Grundlage und verweisen auf eine hohe persönliche Gewichtung. Die Kernsatzbündel formen die Grundlage für die Erfahrungsfelder, welche den Ergebnisteil der Forschungsarbeit bilden (ebd., S. 247).
3.4 Gütekriterien qualitativer Forschung
Um die Ergebnisse von Forschung in ihrer Aussagekraft einschätzen zu können, müssen diese an vorher festgelegten Gütekriterien gemessen werden. Im Gegensatz zu quantitativer Forschung ist die Qualität qualitativ erhobener Daten nicht mit den klassischen Gütekriterien, Reliabilität und Validität einzuschätzen, da diese die argumentative Vorgehensweise, wie sie der qualitativen Forschung unterliegt, nicht abbilden können (Mayring, 2002, S. 140). Für qualitative Forschung sind sechs hiervon abzugrenzende Gütekriterien anzuwenden (ebd., S. 144-148). Diese werden nachfolgend inhaltlich kurz vorgestellt und dabei auf deren Umsetzung innerhalb der vorliegenden Arbeit Bezug genommen.
Als erstes Kriterium nennt Mayring (2002, S. 144) die Nachvollziehbarkeit der verwendeten Verfahren. Die verwendeten Analyseinstrumente der vorliegenden Arbeit wurden in den Kapiteln 3.2 und 3.3 vorgestellt. Zudem fand eine thematische Erläuterung innerhalb des zweiten Kapitels statt, welche die theoriegeleitete Herangehensweise verdeutlicht.
Als zweites Gütekriterium ist die argumentative Interpretationsabsicherung anzuführen. Diese fordert ein hohes Maß an theoriegeleiteter Schlüssigkeit der Interpretation qualitativer Daten. Dabei soll auch auf alternative Deutungsmöglichkeiten der Ergebnisse hingewiesen werden (ebd., S. 145). Im Zuge der Auswertung der Interviews wurde daher besonders auf widersprüchliche Aussagen im Verlauf eines Interviews und Dissens zwischen den Aussagen der einzelnen Interviewpartner geachtet.
Ein weiteres Gütekriterium verweist auf die Wichtigkeit einer systematischen und geplanten Vorgehensweise. Dies gilt dem Zweck, das Material umfassend zu erschließen (ebd., S. 145-146). Zwar sind Abweichungen von der ursprünglich geplanten Analyse möglich, sollen jedoch nur begründet erfolgen. Dies wurde auch im vorliegenden Fall berücksichtigt. Zwar fanden Anpassungen des Interviewleitfadens nach Durchführung des ersten Interviews statt, diese gründeten jedoch allein auf dem zuvor generierten Wissenszuwachs.
Eine angemessene Nähe zum Gegenstand fordert das vierte Gütekriterium (ebd., S. 146). Um dies umzusetzen wurde zur Durchführung der Interviews ein jeweils durch die Interviewten mitbestimmter Rahmen gewählt. Die Interviewten sollten kein „Laborgefühl“ entwickeln, sondern das Interview in ihrer jeweils natürlichen Lebenswelt geben können. Einzig ein ruhiger und entspannter Rahmen wurde als Bedingung für die Interviewsituation durch den Autor vorgegeben.
Als fünftes Kriterium nennt Mayring (2002, S. 147) die Validierung der Ergebnisse durch den Beforschten selbst. Wenn der Beforschte sich in den Interpretationen des Forschers wiederfindet, kann dies als wichtiges Argument zur Sicherung der Ergebnisse Verwendung finden. Im vorliegenden Fall wurden die geführten Interviews sowie die Ergebnisse der Erhebung allen Interviewpartnern vor Abschluss des Gesamtprozesses zur Validierung vorgelegt. Im Zuge dessen kam es zu keiner inhaltlichen Änderung.
Als sechstes Gütekriterium verweist Mayring (2002, S. 147-148) auf die Möglichkeit, die eigenen Ergebnisse mit qualitativen oder quantitativen Ergebnissen anderer Studien zu validieren. Dabei ist jedoch nicht die völlige Übereinstimmung der Ergebnisse als Zielsetzung zu sehen. Vielmehr sollen dabei alternative Erklärungen für die entsprechende Fragestellung gefunden werden. Da zur vorliegenden Fragestellung keine qualitativen oder quantitativen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorlagen, konnte eine Triangulation der Ergebnisse nicht stattfinden.
3.5 Ermittlung der Untersuchungsgruppe
Um das Identitätsverständnis polyamorer Menschen zu untersuchen, wurden insgesamt fünf polyamore Personen befragt. Die Anzahl der Interviewpartner stand zu Beginn der Untersuchung noch nicht fest, sondern ergab sich aus dem Umstand, dass im Zuge der Auswertung des vierten und fünften Interviews zahlreiche Redundanzen festgestellt wurden. Es war daher kein wesentlicher Informationsgewinn im Zuge der Durchführung weiterer Interviews zu erwarten (Abbruchkriterium).
Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden nur Personen mit hetero- oder bisexueller Neigung befragt, da sich die Phänomenologie der Polyamorie bei Personen der genannten Gruppen gesondert darstellt (Lautmann, 2015, S. 39). Besonders im Fall weiblicher und männlicher homosexueller Neigung sind klassische Beziehungsformen durch gesellschaftliche Einschränkungen nicht zugänglich oder mit gesellschaftlichen Widerständen verbunden. Das Ergebnis ist häufig die Abkehr von der damit verbundenen Vorstellung nach sexueller Treue. Die sexuelle Offenheit innerhalb homosexueller Beziehungen ist bereits seit langem verbreiteter als dies gleichermaßen für heterosexuelle Beziehungen gelten würde, ohne dass dieser Umstand jedoch mit Polyamorie gleichzusetzen wäre (ebd., S. 39).
Des Weiteren wurde bei der Auswahl der Personen darauf geachtet, dass keine befragten Personen Teil des gleichen Beziehungskonstrukts sind. So befand sich keiner der Befragten zum Zeitpunkt des Interviews oder zu einem früheren Zeitpunkt in einer Beziehung zu einem anderen Interviewpartner, da sich sonst Fehlinterpretationen ergeben hätten können.
Für die Akquise der Interviewpartner wurden mehrere Techniken angewandt. So wurde ein standardisiertes Anschreiben verfasst, welches über das Internetforum „Joyclub.de“ an Personen verschickt wurde, die sich als polyamor sowie hetero- oder bisexuell beschrieben. Des Weiteren fand eine Akquise über die persönliche Teilnahme an Stammtischtreffen polyamorer Personen in drei Städten statt. Eine weitere Person konnte über den persönlichen Bekanntenkreis akquiriert werden. Die Interviews fanden im Anschluss an ein persönliches Vorabgespräch oder telefonischen Kontakt im Zeitraum vom 9. bis 29. Oktober 2015 in Oldenburg, Bremen, Saarbrücken, Heidelberg und Bad Herrenalb statt. Vor Beginn des Interviews wurde der Interviewte jeweils gebeten einen Screeningbogen auszufüllen. Zum einen um allgemeine Informationen über die familiären Verhältnisse zu erlangen und diese für das nachfolgende Interview als Anknüpfungspunkt zu verwenden. Zum anderen um den Erhebungsprozess effizient zu gestalten und mögliche Ausschlusskriterien frühzeitig und vor Beginn des Interviews zu identifizieren.
4 Ergebnisse
Im Zuge der geführten Interviews kristallisierten sich fünf Erfahrungsfelder heraus, die zur Beantwortung der Frage nach dem Identitätsverständnis polyamorer Individuen beitragen.
4.1 Kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen
Wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben, verändert sich die gesellschaftliche Beziehungslandschaft zunehmend. Der Anteil klassischer Beziehungen sinkt, während wechselnde Partner und serielle Beziehungsmodelle immer häufiger ein Teil der persönlichen Beziehungsbiographie werden. Aus Sicht von Interviewpartnerin 2 ist diese Veränderung auf zu hohe gesellschaftliche Ansprüche bezüglich einer singulären Beziehung zurückzuführen, da dieser die Aufgabe zuteilwerde, die Beteiligten allumfassend zu befriedigen (I2, Z. 255-259). Für eine einzelne Person seien diese Ansprüche utopisch und von daher der Versuch auch zwecklos, ihnen bei der Ausgestaltung der eigenen Beziehung Rechnung zu tragen (I2, Z. 260-261). Besonders kritisch wird der gesellschaftliche Anspruch von sexueller Treue innerhalb einer Beziehung gesehen, da dieser nicht den natürlichen Verhaltensweisen des Menschen entspreche (I5, Z. 210). Wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt, wird der Wunsch nach einer sexuell treuen Beziehung in vielen Partnerschaften nur als Anspruch formuliert und nicht Teil des gezeigten Verhaltens (Schmidt et al., 2006, S. 136). Interviewpartnerin 5 verweist in diesem Zusammenhang auf den von ihr beobachteten Umstand, dass auch viele freundschaftliche Beziehungen zu einem gewissen Grad auf körperlicher Anziehung beruhen. Der Verzicht, sexuelle Aspekte einer solchen Beziehung auszuleben, sei ein Produkt gesellschaftlicher Normen (I5, Z. 210-213). Für Interviewpartner 4 besteht deshalb auch keine Logik dabei, eine Beziehung in einer bestimmten Form exklusiv zu gestalten. Exklusivität, egal in welcher Weise, sei kein Bestandteil seines Wirkens innerhalb von Beziehungen (I4, Z. 85-88). Dagegen würde Ehrlichkeit in vielen Beziehungen einen Kernbestandteil des jeweiligen Beziehungsverständnisses darstellen. Sowohl Interviewpartnerin 2 als auch Interviewpartner 4 interpretieren den Begriff der Treue als zwischenmenschlichen Zusammenhalt, der auch ohne monogames Verhalten möglich ist. Treue wird dabei als Synonym für Loyalität verstanden: „Es gibt unterschiedlichste Arten von Treue […] Loyalitätsbekundungen sind in jedem Fall wichtig“ (I2, Z. 290-291). „Treue … hat für mich … eine große Bedeutung aber nicht in diesem Sinne von Exklusivität, sondern im Sinne von Loyalität“ (I4, Z. 242-243). Ebenfalls unter Aussparung einer sexuellen Komponente wird der Treuebegriff von Interviewpartnerin 1 als Achtsamkeit gegenüber den Bedürfnissen des Partners verstanden (I1, Z. 228-234). Auch Interviewpartner 3 hält Treue als keine, die Sexualität betreffende Begrifflichkeit, sondern verwendet den Begriff synonym für Zuverlässigkeit (I3, Z. 303-304). Interviewpartnerin 5 verbleibt beim konventionellen Begriffsverständnis der Treue, lehnt diese, mit Blick auf das Gelingen einer Beziehung, jedoch ab (I5, Z. 69).
Die dargestellte veränderte Sicht auf Beziehungen speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Die hohe Gewichtung von loyalem Verhalten wird in allen geführten Interviews deutlich. Interviewpartner 4 erklärt dies besonders ausdrucksstark: „Mir verarscht vorkommen [ist] für mich schlimmer als die Eifersucht“ (I4, Z. 23). Monogames Verhalten wird als Ausdruck eines großen Bedürfnisses nach Sicherheit verstanden (I2, Z. 310-312). Es befriedige das menschliche Verlangen nach Geborgenheit gezielter, als dies für die Polyamorie gelte (I1, Z. 76). Diese Sicherheit sei jedoch trügerisch, weil die sexuelle Treue ja nur vorausgesetzt, de facto in vielen Fällen jedoch gar nicht umgesetzt werde (I1, Z. 75-76). Auch die marktwirtschaftliche Ausrichtung der Gesellschaft spielt bei vielen aus Sicht der Interviewpartner eine Rolle und in die Betrachtung der Beziehungsthematik mit ein. Dadurch werde die Eigentumsfrage wie sie in unserer Gesellschaft für alle Gegenstände gelte, fälschlicherweise auch auf Personen angewandt (I1, Z. 190-194). „Natürlich ist jeder Mensch frei, ja aber in dem Moment wo ich dann halt sage, das ist mein Mann, das ist meine Frau, das ist mein Freund oder so, da kommt dieses ‚meins‘ dazu und dann fängt man an zu denken ok, der gehört jetzt mir und ich darf bestimmen was er machen darf oder nicht.“ (I1, Z. 178-181). Diese, aus Sicht von Interviewpartnerin 1, fehlerhafte Herangehensweise bezieht sich dabei nicht nur auf Personen in monogamen Beziehungen, sondern auch auf Menschen, die ihre Beziehung nur begrenzt auf sexuelle Inhalte offen gestalten (I1, Z. 176). Zwar besteht auch bei polyamoren Menschen der Wunsch nach engen und festen Beziehungen, daraus entsteht jedoch kein wechselseitiger Besitzanspruch (I5, Z. 287-291). Die Ablehnung eines solchen Besitz- und damit einhergehenden Konkurrenzdenkens zeigt sich für Interviewpartner 3 darin, dass mögliche Partner von ihm bei der Suche nach weiteren Partnern nicht eingeschränkt, sondern unterstützt werden (I3, Z. 100-101). Interviewpartnerin 5 hebt dabei das Prinzip der Anteilnahme an positiven Erfahrungen von Partnern hervor: „Okay ich lass dich jemanden anderen haben und wenn ihr kuschelt dann ist das so und wenn ihr Sex habt, dann freu ich mich für dich.“ (I5, Z. 126-127). Für diese Sicht und das Ablegen von Besitzdenken werden Ehrlichkeit, Offenheit und Toleranz als Voraussetzungen beschrieben (I5, Z. 86-95). Die Vorstellung, dass Besitzdenken innerhalb von Beziehungen schon im Ansatz falsch ist, prägen auch die Denkweisen von Interviewpartnerin 2: „Ich möchte meinen Partner lieben und nehmen mit seiner Freiheit. Ihn in Freiheit lieben.“ (I2, Z. 249-250). Für sie ergeben sich dabei auch wertvollere Beziehungen. Durch die Möglichkeit des Partners, frei über die Gestaltung weiterer Beziehungen zu entscheiden, ergibt sich im Fall von partnerschaftlichen Problemen eine noch höhere Wertschätzung der Partnerschaft, da diese trotz der Problematik weiter aufrecht erhalten wird: „Es ist noch mehr so ein Zeichen von wahrer Liebe, wenn du trotz der Beziehungsprobleme und trotz der Alternativen zusammen bleibst. […] Das ist ein ‚ja‘ zu der Beziehung an sich und nicht ein ‚ja‘, weil ich nicht alleine sein will.“ (I2, Z. 379-383).
4.2 Entwertung des „Wir“, Fokussierung des „Ich“
Nach Keupp (1999, S. 263) besteht ein wichtiger Aspekt der Identitätsarbeit darin, sich als autonom und selbstbestimmt wahrzunehmen. Innerhalb der geführten Interviews wird die Relevanz, die dieser Punkt für die Interviewten einnimmt, immer wieder deutlich. Interviewpartner 4 stellt fest, dass Unabhängigkeit, insbesondere finanzielle Unabhängigkeit, eine wichtige Voraussetzung für einen polyamoren Lebensstil ist. Allein durch die zusätzlichen Reisekosten, die durch die Besuche weiterer Partner entstünden, sei diese eine notwendige Voraussetzung (I4, Z. 134-139). Eine perfekte Beziehung basiere neben Respekt auf einer Grundlage ohne jegliche Abhängigkeiten, erklärt Interviewpartner 4 weiter (I4, Z. 288-292). Ein autonomer Ansatz wird auch für die Betrachtung der eigenen Zufriedenheit gewählt. So sei die Bedürfnisbefriedigung keine interpersonelle Angelegenheit, sondern von individuellem Charakter (I4, Z. 170-174). Diese Eigenverantwortung für das Erreichen der persönlichen Zufriedenheit wird als Vorteil von Polyamorie betrachtet, da in polyamoren Partnerschaften eine solche Haltung akzeptiert werde (I4, Z. 175). Auch Interviewpartnerin 1 beurteilt steigende Eigenverantwortung innerhalb ihrer zuvor monogamen Beziehung als Ausgangspunkt für ihre Beschäftigung mit Polyamorie (I1, Z. 18-19). Dies habe zur Folge, dass in einer polyamoren Beziehung bei allen Handlungen individuelle Werte eine zentrale Rolle spielen sollten: “Jeder macht das, was für ihn richtig ist“ (I1, Z. 198-199). Die Erreichung persönlicher Zufriedenheit ist hierbei vom Partner losgelöst. Dies bedeutet einerseits, dass der Partner als weniger verantwortlich betrachtet wird. Er wird entlastet. Andererseits wird auch die eigene Verantwortlichkeit für den Partner als geringer eingeschätzt. Für Interviewpartnerin 5 ergibt sich aus dieser gedanklichen Abkopplung der Partner auch die Konsequenz, dass jegliche zwischenmenschliche Interaktion auch nur die beteiligten Personen betrifft. Ist ein Partner beispielsweise bei einem sexuellen Kontakt nicht anwesend, so stellt sich auch nicht die Frage nach dessen Bewertung des Kontakts: „Wenn ich jetzt mit jemandem ins Bett gehe, dann hat das doch erstmal gar nichts mit meinem Partner zu tun, der war ja auch nicht dabei oder wir haben jetzt ja auch nicht über den geredet oder so.“ (I5, Z. 221-223). Sexualität wird als etwas rein Individuelles wahrgenommen. Dass das eigene Autonomiebestreben von hoher Bedeutung ist, wird auch an anderer Stelle betont: „Ich finde mich auch sexuell befreit, ich lasse mich da nicht einschränken.“(I5, Z. 198-199). Interviewpartner 4 berichtet davon, dass das Ausleben des Bedürfnisses nach Autonomie bei der Beziehungsbildung in seinem Fall zu Konflikten mit einer bisherigen Partnerin geführt hat. Dennoch weist er darauf hin, dass auch in Konfliktfällen seine Autonomiebestrebungen über gegenläufige Bedürfnisse des Partners gestellt werden (I4, Z. 361-378). Auch für Interviewpartnerin 1 hat das persönliche Autonomiebestreben höhere Priorität als eine enge partnerschaftliche Verflechtung (I1, Z. 121-122). Weitere Beziehungen werden auch gegen den Willen eines Partners aufrecht erhalten, jedoch unterliegt allem der Grundgedanke eines achtsamen Miteinanders und der Wunsch nach Kommunikation: „Wenn es für dich schwer ist, dann müssen wir vielleicht irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, wo es leichter ist.“(I1, Z. 123-124).
Ein weiteres Ziel, welches als eng verbunden mit der eigenen Autonomie betrachtet wird, ist die Weiterentwicklung der eigenen Person (I2, Z. 261-263). Da unabhängig voneinander gleichzeitig mehrere Beziehungen geführt werden können, sind auch mehr Erfahrungen möglich, eine Perspektivenerweiterung wahrscheinlicher (I2, Z. 262-263). Dabei erfordere Polyamorie ein hohes Maß an Introspektion: „Ich glaube es geht nur, wenn man sich selbst reflektiert“ (I1, Z. 205). So werden unreflektierte Verlustängste auch als häufiger Grund für monogames Beziehungsverhalten betrachtet (I1, Z. 288). Durch die intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten würde hingegen ein persönlicher Entwicklungsprozess vollzogen: “das allerschwierigste sind glaube ich die Ängste […] und dass man auch sagt, ja gut es tut weh und es ist aber in Ordnung, weil durch den Schmerz muss man hindurch gehen, um die Reife zu bekommen.“ (I1, Z. 212-215). Nach Abschluss dieses Prozesses seien positive Bewusstseinszustände wie Leichtigkeit und Sorglosigkeit möglich (I1, Z. 222-224). Interviewpartnerin 5 und Interviewpartner 3 beschreiben in diesem Zusammenhang ebenfalls positive Folgen einer polyamoren Lebensweise. Während Interviewpartnerin 5 besonders das Gefühl der sexuellen Unbeschwertheit hervorhebt, spielt für Interviewpartner 3 die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln bei der persönlichen Präferenz des polyamoren Lebensstils eine entscheidende Rolle (I5, Z. 124-126; I3, Z. 117-119).
4.3 Integrität fördert das kohärente Selbstbild
In Kapitel 2.2.1 wurde dargelegt, dass das Festhalten an eigenen Überzeugungen und die damit einhergehende Abgrenzung von Andersdenkenden als identitätsbildender Prozess angesehen werden muss (Kneidinger, 2013, S. 38). Dies kann entweder durch die Übernahme und Verteidigung tradierter Wertvorstellungen geschehen oder muss, wie heutzutage immer häufiger, mittels einer individuellen, von Traditionen abweichenden Entwicklung geschehen (Abels, 2010, S. 429). Für die interviewten Personen bestanden mit Blick auf ihre derzeitige Beziehungsgestaltung meist keine Rollenbilder, die übernommen werden konnten. Aus Sicht von Interviewpartnerin 5 beeinflussen zwar alle Beziehungen, mit denen man in Kontakt kommt, die eigene Weise, Beziehungen zu führen. Menschen die polyamor leben, kannte sie zu Beginn der eigenen Polyamorie jedoch keine (I5, Z. 99-101). Interviewpartnerin 1 gibt an, erst einige Jahre nachdem sie bereits mehrere Beziehungen zur gleichen Zeit geführt hatte, den Begriff der Polyamorie kennen gelernt zu haben (I1, Z. 128-131). Andere polyamore Personen, neben den eigenen Partnern, kennt sie bis heute nicht (I1, Z. 141-142). Interviewpartner 3 und 4 kannten ebenfalls keine polyamorösen Personen, sondern haben das Konzept der Polyamorie durch die Beschäftigung mit einschlägiger Literatur kennen gelernt (I3, Z. 5-11; I4, Z. 30-35). Hiervon eine Ausnahme bildet allein Interviewpartnerin 2, die durch eine polyamore Freundin in Kontakt mit einem diesbezüglichen Rollenvorbild stand: „Ich habe angefangen, mich mit ihr zu unterhalten […] und es hat auf jeden Fall dann auch mit ihr angefangen.“ (I2, Z. 283-286). Für alle anderen Interviewpartner kann die eigene Beziehungsgestaltung jedoch nicht mit der Übernahme von Rollenvorbildern erklärt werden. Es erscheint daher logisch, dass es für das kohärente Erlebnis der eigenen Beziehungsführung andere Formen als der externen Validierung durch die Nachahmung und den Abgleich mit bekannten Vorbildern bedurfte. Interviewpartnerin 2 verweist auf die Relevanz einer integren Haltung: „Also ich lege unglaublichen Wert auf Authentizität und möchte nicht verheimlichen, wie ich zu wem stehe“ (I2, Z. 90-91). Auch bei der Selbstbeschreibung führt Interviewpartnerin 2 die Attribute „ehrlich“ und „authentisch“ an (I2, Z. 205), was auf die hohe Wertigkeit dessen für das eigene Selbstverständnis hinweist. Interviewpartner 4 betont den offenen Umgang mit der eigenen Polyamorie (I4, Z. 91). Er führt weiterhin aus, dass seine primäre Partnerin dem entgegengesetzt handelt und unter der Unmöglichkeit einer externen Validierung ihrer Sicht leidet: “Sie versteckt alles, sie frisst Probleme die sie damit hat in sich hinein, weil sie keine Ansprechpartner hat, mit denen sie über Polyamorie reden kann.“(I4, Z. 355-356). Auch Interviewpartnerin 1 beschreibt sich als eine Person, die hinter ihren Einstellungen steht. Sie gibt jedoch auch an, die bestehenden Mehrfachbeziehungen gegenüber den eigenen, teilweise bereits erwachsenen Kindern, aus Sorge vor deren Unverständnis, bisher nicht thematisiert zu haben (I1, Z. 292-308).
Die eigene Person wird von den Interviewten mit jeweils unterschiedlichen Attributen charakterisiert. Interviewpartnerin 1 verbindet vor allem Abenteuerlust und Veränderungsbereitschaft mit sich selbst (I1, Z. 48-49). Interviewpartnerin 2 und Interviewpartner 3 betonen die ihnen selbst zugrunde liegende tolerante Haltung (I2, Z. 97-101; I3, Z. 248-249). Während diese beschriebenen Eigenschaften noch in einen inhaltlichen Zusammenhang mit der präferierten Beziehungsführung gebracht werden können, verweisen andere Antworten auf die Diskrepanz zwischen den Selbsturteilen, die der polyamoren Lebensweise zugrunde liegen können. Interviewpartner 3 beschreibt sich, konträr zur Selbsteinschätzung von Interviewpartnerin 1, als zurückhaltend und konfliktscheu (I3, Z. 243-246). Interviewpartner 4 hält sich für besonders rational, erkennt bei sich selbst jedoch auch eine gewisse Unbeholfenheit hinsichtlich zwischenmenschlicher Interaktion. Zudem hat Interviewpartner 4 nach eigenem Bekunden Schwierigkeiten damit, seinen Mitmenschen die eigene Haltung verständlich darzulegen (I4, Z. 272-283). Interviewpartnerin 5 verweist durch die Art ihrer Antwort auf den normativen Gehalt, den die Beurteilung der eigenen Eigenschaften besitzt. Statt die eigene Person zu attribuieren, wird die emotionale Kopplung eigener Verhaltensweisen vorgestellt: „Ich finde mich total gut, wenn ich aktiv und fleißig bin und wenn ich irgendwas mache, wo ich denke, dass hat irgendeinen Nutzen. Ich finde mich schrecklich wenn ich mal faul bin.“(I5, Z. 194-196).
Dass die Offenlegung der eigenen Überzeugungen hinsichtlich der Beziehungskonstruktion mit Konflikten verbunden ist, argumentieren Interviewpartnerin 2 und Interviewpartner 3. Bei Interviewpartnerin 2 sei es im Zuge dessen zu einem Zerwürfnis mit den Eltern eines Partners gekommen: „Ich hatte Angst davor, […] dass sie mich verstoßen […] aber letztendlich ist es passiert, dass wir es ihnen gesagt haben und es ist auch tatsächlich das eingetreten, was ich befürchtet habe.“ (I2, Z. 127-129). Bei Interviewpartner 3 sei in Folge des Transparentmachens der eigenen Vorstellungen womöglich die Freundschaft mit dem besten Freund zerbrochen (I3, Z. 202-203). Diese negative Erfahrung habe in seiner Folge jedoch nicht dazu geführt, dass Interviewpartner 3 seine Polyamorie verheimlicht. Das Bild, welches Freunde und Familie von seiner Beziehungsführung haben, soll möglichst auch der eigenen Sicht entsprechen. Damit zeigt sich die hohe Priorisierung, der integres Auftreten und Handeln zugerechnet werden muss: „Ich möchte, dass man anerkennt, zumindest die Teile meines Umfeldes, die mir wichtig sind, dass ich so lebe, dass ich prinzipiell auch so empfinde.“ (I3, Z. 189-191).
4.4 Beziehungskonstruktion als identitätsstiftender Anpassungsprozess
Nach Keupp (1999, S. 263) besteht Identitätsarbeit in erster Linie nicht darin, widersprüchliche Lebensbereiche aufzulösen, sondern diese in eine für sich selbst annehmbare Relation zu setzen. Die Unterschiedlichkeit soll dabei nicht als Problem, sondern als Herausforderung wahrgenommen werden (ebd., S. 263). Im Folgenden sollen Sachlagen erörtert werden, die Aufschluss über den Umgang der Interviewpartner mit Wandelbarkeit auf der zwischenmenschlichen Ebene geben.
Interviewpartner 4 betrachtet alle interindividuellen Kontakte als ständig veränderbare Konstrukte: “Ich sehe jede zwischenmenschliche Beziehung als eine Verbindung, die irgendetwas sein kann und im Idealfall ist es freigestellt, was diese Verbindung ist und wie sie sich entwickelt“ (I4, Z. 118-120). Die beschriebene Wandelbarkeit würde durch eindeutige Begrifflichkeiten wie Freundschaft oder Partnerschaft künstlich begrenzt. Die Verwendung dieser Begriffe sei deshalb nicht zielführend (I4, Z. 120-123). Intraindividuelle Veränderungen werden von allen Interviewpartnern beschrieben. Interviewpartner 1, 2 und 5 berichten einheitlich einen mehrschichtigen Prozess, wenn es um die Frage der eigenen aktuellen Beziehungsführung geht. So ergab sich bei allen innerhalb einer anfänglich monogamen Beziehung der persönliche Wunsch nach Veränderung der Beziehungsgestaltung (I1, Z. 15-16; I2, Z. 25-26; I5, Z. 7-13). Dabei wurden zuerst sexuell freizügigere Formate gelebt wie z. B. eine offene Beziehung oder eine feste Partnerschaft mit ergänzenden sexuellen Kontakten zu Freunden. Zu einem späteren Zeitpunkt fand dann abermals ein Wechsel zu Formaten statt, die neben dem sexuellen Kontakt auch eine emotionale Bindung zu mehreren Personen zuließen (I1, Z. 23-24; I2, Z. 20-25; I5, Z. 6-21). Für Interviewpartnerin 5 ist auch eine Rückkehr zur Monogamie eine Möglichkeit für zukünftige Beziehungsgestaltungen (I5, Z. 112-113). Hierbei wird deutlich, dass es sich für Interviewpartnerin 5 bei der eigenen Beziehungsgestaltung um keinen festgelegten Zustand handelt, da auch die Anwendung ehemaliger Beziehungsformate zukünftig denkbar bleibt. Des Weiteren macht Interviewpartnerin 5 darauf aufmerksam, dass es sich bei Beziehungen um Konstrukte handelt, deren Dauer im Ermessen der Beteiligten liegt: „Beziehungen dürfen ja auch mal zu Ende gehen.“ (I5, Z. 261) und weiter: „Es ist zwar schön, wenn es lange dauert. Es ist aber auch schön, wenn man sich verabschieden darf, wenn es nicht mehr passt.“ (I5, Z. 265-266). Ein Beziehungskonzept, das der Erzeugung eines kohärenten und kontinuierlichen Selbstbilds durch seine langfristige Ausrichtung dienlich wäre, scheint zumindest im Fall von Interviewpartnerin 5 nicht vorzuliegen, da alle Beziehungen immer als temporär verstanden werden. Wie in Kapitel 2.1.2 dargelegt, ist ein solches Selbstbild jedoch nicht unbedingt von förderlichen Aspekten, wie z. B. einer langfristigen Beziehungsführung abhängig, da es sich in erster Linie um eine kognitive Leistung des Individuums handelt, die eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Sinnzusammenhang zu betrachten. Folglich ist primär der subjektive Eindruck von Kohärenz und nicht objektive Kohärenz entscheidend (Keupp et al., 2002, S. 16 - 19).
Interviewpartner 4 geht davon aus, schon immer polyamor gewesen zu sein (I4, Z. 31-35). Die stattgefundenen Veränderungen auf der Beziehungsebene werden dabei eher als Anpassung der Außenverhältnisse an die bereits bestehende Innensicht beschrieben (I4, 35-41). Für Interviewpartner 3 hat sich ebenfalls keine Änderung seiner Innensicht ergeben. Die Entscheidung polyamor zu leben, wurde nach theoretischer Auseinandersetzung gemeinsam mit seiner Partnerin getroffen. Dies hat aus seiner Sicht zu keiner Veränderung seiner Person als solches geführt, oder ist auf Veränderungen seiner Person zurückzuführen (I3, Z. 11-23).
Der Rückgang klarer gesellschaftlicher Vorgaben zur Ausgestaltung der eigenen Beziehungswelt und eine damit einhergehende größere Eigenverantwortung werden von den Interviewten als positiv wahrgenommen (I3, Z. 165-168; I4, Z. 315-322; I2, Z. 351-362). Für Interviewpartner 3 ist die Ausgestaltung der eigenen Beziehungswelt eine Aufgabe, der sich das Individuum bewusst unterziehen muss (I3, Z. 167-169). Die Frage, ob die gewählte Beziehungsform dauerhaft funktioniert, ist aus Sicht von Interviewpartnerin 5 allerdings von der jeweiligen Entscheidung unabhängig (I5, Z. 255-260). Dabei greift sie den in Kapitel 2.2.2 dargestellten Umstand hoher Trennungsraten innerhalb klassischer Beziehungsmuster auf. Daneben verweist sie auf die Einseitigkeit der gesellschaftlichen Debatte, welche sich zu unkritisch mit der Monogamie befasse und gleichzeitig andere Beziehungsformen als instabil betrachte: „Wenn man sich überlegt, es gibt ja jede Menge Singles, die in einer monogamen Beziehung gelebt haben. Bei denen sind auch 100% aller Beziehungen gescheitert und da heißt es auch nicht: ‚Ja das war ja monogam, das konnte ja nicht klappen‘.“ (I5, Z. 255-257).
Die wahrgenommene höhere Optionalität innerhalb der Beziehungsgestaltung und die daraus generierte Veränderung wird von den Betroffenen jedoch nicht als Widersprüchlichkeit betrachtet, sondern meist als Reifungsprozess, also eine sinnhafte Abfolge (I1, Z. 45-46). Dies lässt auf eine erfolgreiche Integration der Ambivalenzen in das eigene Identitätsbild schließen.
4.5 Entgrenzungsprozess begründet neue Konfliktfelder
In Kapitel 2.2.1 wurden verschiedene Dimensionen vorgestellt, die der gesellschaftliche Entgrenzungsprozess mit sich bringt. Aus Sicht des Individuums ergeben sich dabei immer vielfältigere Möglichkeiten der eigenen Lebensführung. Die dabei erschwerte Aufgabe, aus der wachsenden Zahl an Optionen eine passende Wahl zu treffen, kann jedoch auch zu Stress und zur Überforderung des Individuums führen (Abels, 2010, S. 434). Letztlich besteht die Gefahr, dass die persönlichen Ressourcen zu sehr durch den Entscheidungsprozess gebunden werden und nicht mehr für anschließendes Handeln zur Verfügung stehen (ebd., S. 424).
Für Interviewpartnerin 1 ergeben sich aufgrund ihrer polyamoren Beziehungen immer wieder zeitliche Stressoren. Dies hat auch zur Folge, dass sie die Anzahl ihrer Partner derzeit auf 2 begrenzt. Sie verdeutlicht aber auch, dass dies eine Momentaufnahme und keine unveränderbare Situation darstellt (I1, Z. 93-99). Interviewpartner 4 berichtet von einer Beziehung, die aufgrund zeitlicher Einschränkungen nicht mehr aktiv geführt werden kann (I4, Z. 62-64). Interviewpartner 3 hat schon die Erfahrung gemacht, dass eine Partnerin eine Beziehung aus Zeitgründen beendet hat (I3, Z. 79-83). Er gibt zudem an, dass es aufgrund der vermehrten Koordinierung und Planung einer polyamoren Beziehung immer wieder zu Abspracheschwierigkeiten mit seiner Primärpartnerin kommt (I3, Z. 335-340).
Neben dem Zeitaufwand für die Organisation wird auch immer wieder der Kommunikationsaspekt der Beziehungen kritisch beurteilt. Zwar wird von Interviewpartner 3 Kommunikation neben Ehrlichkeit als Grundlage eines idealen Beziehungsgeflechts bezeichnet, er macht jedoch auch auf den großen Bedarf an Kommunikation für seine Beziehungen aufmerksam (I3, Z. 85-89; Z. 229-231). Interviewpartner 4 betrachtet die Bereitschaft viel zu kommunizieren als Voraussetzung für die polyamore Beziehungsgestaltung. Im Gegensatz zur monogamen Beziehung müssten mehr Inhalte der Beziehung verhandelt und abgestimmt werden, da keine vorgefertigten Schemata bestünden, auf die zurückgegriffen werden könne (I4, Z. 151-153). Interviewpartnerin 2 sieht in der Notwendigkeit zusätzlicher Kommunikation auch den größten Nachteil ihrer Beziehungsführung (I2, Z. 231). Sie sieht speziell bei polyamoren Beziehungen das erhöhte Risiko, durch zu intensive Kommunikation der Beziehung selbst zu schaden: „Ich weiß nicht ob es unbedingt an der Polyamorie liegt, weil es gibt ja auch monogame Beziehungen in denen Probleme totgeredet werden. Aber sicherlich ist das Potential in polyamorösen Beziehungen größer, dass man auch mal was zerredet.“ (I2, Z. 235-236).
5 Diskussion
Will man die identitätsbildenden Prozesse der polyamor lebenden Interviewpartner analysieren, so fallen zuerst der kritische Umgang und die hinterfragende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und Werten auf. So proklamieren gleich mehrere Interviewpartner eine solche Haltung für sich (I1, Z. 190-194; I3, Z. 164-168; I5, Z. 210-213). Diese Selbstwahrnehmung wird besonders bei der Bewertung des Treuebegriffs sichtbar (I1, Z. 228-234; I2, Z. 290-291; I3, Z. 303-304; I4, Z. 242-243; I5, Z. 69). Dabei wird zum einen deutlich, dass alle ein aus ihrer Sicht gesellschaftlich gängiges Verständnis des Begriffs kennen. Dieses Verständnis beinhaltet neben weiteren Attributionen in jedem Fall eine sexuelle Komponente. Anderseits verweisen alle, mit Ausnahme von Interviewpartnerin 5, auf ein eigenes Begriffsverständnis und stehen besonders einer in jeglicher Hinsicht sexuell bezogenen Deutungsweise kritisch gegenüber. Generell wird sexuelle Treue als ein wenig sinnhaftes gesellschaftliches Konstrukt abgelehnt, Monogamie höchstens akzeptiert, wenn sie nach einem Abwägungsprozess, der alle Beziehungsmodelle erfasst, gelebt wird. Diese Haltung entspricht tatsächlich nur der Ansicht einer Minderheit innerhalb unserer Gesellschaft (Schmidt et al., 2006, S. 133). Sexuelle Treue spielt für die meisten Individuen eine große Rolle innerhalb der Partnerschaft, deren Relevanz im Vergleich zu früheren Generationen sogar zugenommen hat (Schmidt et al., 1998, S. 125). Derweil zeigen Studien auch, dass ein beträchtlicher Anteil dieser Personen den eigenen Treueanforderungen nicht nachkommt (Schmidt et al., 2006, S. 136). Dieser Umstand wird von Interviewpartner 2 dann auch als widersprüchlich entlarvt (I2, Z. 210-213). Gleichzeitig wird das Konzept der Monogamie nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die Kritik zielt vielmehr auf die weitverbreitete Forderung nach monogamem Verhalten bei gleichzeitiger Missachtung der eigenen Forderung. Folgt man der Maxime von Keupp (1999, S. 263-265) über Identitätsarbeit, könnte diese Ansicht Ausdruck des Versuchs sein, widersprüchliches Verhalten, eigene Untreue auf der einen Seite bei gleichzeitiger Forderung nach Treue auf der anderen Seite, aufzulösen, mit dem Ziel, die Selbstwahrnehmung kohärent zu gestalten. Für diese Sicht spricht auch, dass alle Interviewpartner vor ihrer eigenen polyamorösen Lebensweise monogame Beziehungen hatten, innerhalb derer sie mit dem Konfliktfeld der sexuellen Treue konfrontiert waren. Um nun ein inkohärentes Selbstbild durch eigene Untreue bei gleichzeitigem Treueanspruch gegenüber dem Partner zu vermeiden, erscheint die Auflösung des Konflikts durch die Veränderung der Beziehungsverhältnisse als gelungene Identitätsarbeit (Keupp, 1999, S. 263). Voraussetzung für diese Ansicht ist jedoch ein Beziehungsverständnis, was auf Gleichberechtigung und Transparenz beruht, da ansonsten das eigene Fremdgehen bei gleichzeitiger Treueforderung ohne Schwierigkeit in ein kohärentes Selbstbild integriert werden kann.
Konkurrenz- oder Besitzdenken scheinen bei den Interviewten Personen geringer ausgeprägt zu sein als es üblicherweise anzunehmen wäre. Exklusive Berechtigungen, die den Partner betreffen, gehören offensichtlich nicht zum Beziehungsverständnis polyamorer Individuen. Zwar können auch die eigenen Wünsche nach der Beziehung zu mehreren Personen als ein zentraler Antrieb für das polyamore Konzept gesehen werden, Polyamorie beinhaltet jedoch stets auch die Freiheit der involvierten Partner in gleicher Weise anzuerkennen. Für Interviewpartnerin 1 ist die Bereitschaft, den Partner mit anderen zu teilen als Voraussetzung sogar noch vor dem eigenen Interesse an Mehrfachbeziehungen zu benennen (I1, Z. 314-316). Die Ablehnung von Besitz erfolgt jedoch nicht nur von einer Seite, sondern bilateral. Die Interviewpartner betonen in vielerlei Hinsicht ihre Unabhängigkeit von einzelnen Partnern. Diese Haltung entspricht zwar dem Zeitgeist: „Die Selbsttreue hat die Treue in Partnerschaft und Beziehung abgelöst“ (Oswald-Rinner, 2011, S. 251). Sie wird durch das freiheitsbetonte Beziehungskonzept der Interviewpartner nur besonders deutlich. Unabhängigkeit wird als Voraussetzung für das Entstehen einer Beziehung betrachtet (I4, Z. 134-139). Die Autonomiebestrebungen der Interviewpartner betreffen jedoch nicht ausschließlich die Anbahnung einer Beziehung, sie sind auch Grundlage für die Interaktion innerhalb der Beziehung. Einerseits führt dies zu einer Entlastung der Ansprüche an den Partner. Dieser wird beispielsweise von jeglicher Pflicht die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen freigesprochen (I4, Z. 170-174). Anderseits besteht diese Pflicht auch umgekehrt nicht, sodass die eigenen Bedürfnisse stets priorisierter behandelt werden, als dies ansonsten der Fall wäre. Besonders deutlich wird dies an der Kompromisslosigkeit, mit der das Ausleben der eigenen Sexualität gegenüber partnerschaftlichen Einschränkungen verteidigt wird. Zwar wird eine wertschätzende Umgangsweise mit dem Partner angestrebt, Zugeständnisse werden im Zweifel jedoch kaum gemacht (I1, Z. 121-124; I4, Z. 361-378). Diese Haltung wird von Abels mit der Pluralität der erlebten Realität des Individuums erklärt. Durch die Wahrnehmung einer durch Gegensätzlichkeit geprägten Lebenswelt, sei das Messen der eigenen Person an außerhalb von sich selbst bestehenden Ordnungen für das Individuum nicht mehr möglich. Das Spannungsverhältnis, in dem sich das Individuum hierdurch befindet, das durch die fehlende objektive Erlebniswelt entsteht, kann nur durch ein stärkeres Festhalten an der Innensicht aufgelöst werden. Die Selbsterfahrung erhält somit eine höhere Gewichtung (Abels, 2010, S. 428-429). Bei den Interviewpartnern manifestiert sich dies in einer Ich-geprägten Beziehungsführung. Ein hohes Maß an Autonomie verspricht einerseits die größere Chance, ein integres Selbstbild zu behalten, da die Wahrscheinlichkeit, sich verbiegen zu müssen sinkt (Keupp, 1999, S. 263). Andererseits ist auch Anerkennung durch das Umfeld für das Kohärenzerlebnis des Individuums wichtig, weshalb an dieser Stelle auf Möglichkeiten der Schaffung eines solchen eingegangen werden muss (ebd., S. 263). Generell wird von den Interviewten ein offener Umgang mit dem präferierten Beziehungsstil gepflegt. So werden vor allem der Freundes- und Bekanntenkreis wie auch die eigene Familie mit dem Umstand der Polyamorie konfrontiert (I1, Z. 292; I2, Z. 90-91; I3, Z. 181-182; I4, Z. 91; I5, Z. 228). Die Reaktionen des Umfelds fallen dabei meist neutral aus, in manchen Fällen auch negativ. Anerkennung durch die eigene Gruppe zu erfahren ist zur Bildung der sozialen Identität von hoher Wichtigkeit (Kneidinger, 2013, S. 38). Da im vorliegenden Fall dies häufig jedoch nicht durch bereits bestehende Freunde oder die Familie gewährleistet wird, werden Alternativlösungen gesucht. Tatsächlich berichten mehrere Interviewpartner nach Publik Werden der eigenen Polyamorie Kontakt zu anderen polyamorös lebenden Personen aufgebaut zu haben. Sie sind damit Teil eines polyamorösen Netzwerks, das den erleichterten Kontakt zu Gleichgesinnten ermöglicht.
In der Tat besteht innerhalb der polyamoren Bewegung eine auffällig starke Vernetzung. Polytreffen, Stammtische oder eine rege Internet- und Blogcommunity veranschaulichen dies (Boehm, 2014, S. 282). Für die ausgehende Fragestellung der Identitätsarbeit, weist dies auf die Wichtigkeit von Anerkennung für die Bildung eines kohärenten Selbstbilds hin. Da Anerkennung über familiäre Verflechtungen oder Freunde nicht immer gewährleistet ist, bilden sich sekundäre Optionen für das Erlangen von Anerkennung aus. In diesem Fall wird dies durch eine intensive Vernetzung der polyamoren Individuen gewährleistet, innerhalb derer sie gegenseitige Wertschätzung der eigenen Ansichten erfahren.
Im Gegensatz zu klassischen Identitätsansätzen betonen postmoderne Identitätskonzepte die Vielschichtigkeit des Individuums. Abweichend vom klassischen Begriffsverständnis wird Identität dabei als etwas Wandelbares verstanden, das Raum für Widersprüchlichkeit und Gegensätze lässt (Lenz, 2009, S. 206). Die befragten Interviewpartner nehmen die eigene Veränderlichkeit meist bewusst wahr. Es zeichnen sich dabei drei Bereiche ab, in denen diese Wandelbarkeit des eigenen Subjekts wahrgenommen wird. Dies betrifft die eigene Person, die gelebte Beziehungsform, sowie die in die Beziehungen involvierten Personen. Interviewpartner 1, 2 und 5 berichten, dass sie im Laufe einer Beziehung unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich der Beziehungsform bei sich festgestellt haben (I1, Z. 15-16; I2, Z. 25-26; I5, Z. 7-13). Während zu Beginn eine monogame Beziehungsführung präferiert wurde, ergaben sich im Laufe der Zeit meist offenere Beziehungsmodelle, worauf letztlich der Wunsch nach einer polyamoren Beziehungsführung folgte. Im Fall von Interviewpartnerin 5 ist auch eine zukünftige Rückkehr zu einer monogamen Lebensweise denkbar, was das Bewusstsein für die eigene Wandelbarkeit unterstreicht (I5, Z. 112-113).
Das von den Interviewten gelebte Beziehungskonzept beinhaltet jedoch auch, ein Bewusstsein für die zeitliche Begrenzung einer Beziehung zu entwickeln. Im deutlichen Gegensatz zu klassischen Konzepten wie beispielsweise der Ehe, wird die zeitliche Begrenzung mancher Beziehungen als zu akzeptierender und teilweise sogar wünschenswerter Umstand wahrgenommen. Besonders Interviewpartnerin 5 macht auf diesen Aspekt ihres Beziehungsverständnisses aufmerksam (I5, Z. 265-266). Durch das beschriebene Beziehungsverständnis wird Veränderung als etwas Positives wahrgenommen. Dabei werden sowohl die eigene als auch die Wandelbarkeit der äußeren Umstände anerkannt und in das eigene Identitätsverständnis integriert. Damit nehmen die befragten Individuen vom klassischen Identitätskonzept Abstand und orientieren sich an der pluralistischen Herangehensweise postmoderner Identitätskonstrukte.
Gerade für Individuen, die betont plurale Lebenskonzepte präferieren, stellt sich allerdings die Frage nach einer Begrenzung der Optionen. Aus Sicht des Individuums ergeben sich nämlich nicht nur größere Handlungsspielräume, auch ein steigender Entscheidungsdruck wird spürbar. (Abels, 2010, S. 424). Im Gegensatz zu monogam lebenden Personen bestehen bei der Beziehungsgestaltung keine logischen Grenzen. Während ein monogam lebendes Individuum weitere romantische Beziehungen im Fall des Bestands einer Beziehung ausschließt und damit mögliche Ressourcenaufwendungen einspart, gilt dies nicht für polyamor lebende Personen. Selbst falls kein Partner bereits vorhanden ist, ergeben sich bei polyamorer Herangehensweise größere Entscheidungsräume. So muss nicht nur über die Wahl des richtigen Partners entschieden werden, sondern jede Beziehung muss individuell hinsichtlich der Intensität und des zeitlichen Rahmens immer wieder neu überdacht werden. Hinzu kommt, dass dieser Rahmen im Gegensatz zu monogamen Beziehungen bewusst einer ständigen Prüfung unterzogen wird, was den hierbei zu erwartenden Prüfungsaufwand ebenfalls erhöht. Die Anstrengungen, die dieser Entgrenzungsprozess beim Individuum auslöst, werden auch innerhalb der Interviews deutlich. Neben dem größeren organisatorischen Aufwand, wird auch der größere zeitliche Aufwand thematisiert, den die Mehrfachbeziehungen mit sich bringen. Des Weiteren zeigt sich, dass von Interviewpartnerin 2 sowie Interviewpartner 3 und 4 auch überproportionale Kommunikationsbemühungen als Grundlage ihres Beziehungskonzepts angesprochen werden (I2, Z. 231; I3, Z. 85-89; I4, Z. 151-153). Dass dieser Aufwand durchaus eine Belastung für die Beziehungsführung darstellt, führt besonders Interviewpartnerin 2 aus (I2, Z. 235-236). Es zeigt sich, dass eine individuelle Begrenzung der reinen Anzahl als auch der Intensität der Beziehungen von den Interviewpartnern als notwendig erachtet wird (I1, Z. 93-99; I3, Z. 79-83).
6 Rollenreflexion und Interpretationsgrenzen
Fokus der vorliegenden Arbeit ist die Ergründung der persönlichen Beziehungsrealität polyamorer Personen und dessen Einfluss auf das jeweilige Identitätsverständnis. Die Subjektivität des Forschungsgegenstands ist dabei im Zusammenhang mit den qualitativ erhobenen Daten zu diskutieren und zu reflektieren. Dabei muss neben den gewählten Erhebungstechniken auch die tatsächliche Umsetzungsweise kritisch überprüft werden.
Die Interviews wurden aus Rücksicht auf die Wünsche des jeweiligen Interviewpartners wahlweise in den Räumlichkeiten des Interviewten oder einem öffentlich zugänglichen Raum durchgeführt. Einzige Voraussetzung war bei der Auswahl der Räumlichkeit, dass das Gespräch ungestört und außer Hörweite nicht involvierter Personen stattfinden konnte, da nur so die Gewährleistung einer, der intimen und persönlichen Thematik gerecht werdenden Gesprächssituation sicher gestellt werden konnte. Letztlich wurden die Interviews 1, 3, und 5 in den Privaträumen des Interviewpartners durchgeführt. Die Interviews 2 und 4 fanden in Nebenräumen von Kaffeehäusern statt. Alle Interviews konnten ungestört und in Ruhe durchgeführt werden, jedoch kann ein Einfluss der Durchführungsstätte nicht vollständig ausgeschlossen werden, da diese aufgrund der gegebenen Wahlfreiheit nicht konstant gehalten werden konnte. Lediglich im ersten Interview kam es nach 9 Minuten zu einer deutlichen Ablenkung der Interviewpartnerin, da ihr Mobiltelefon klingelte. Da die Interviewte ihren Redefluss nur für einen kurzen Moment unterbrach und den zuvor begonnen Satz konform weiterführte, ist aus Sicht des Autors nicht von einer erheblichen Störung auszugehen.
Aufgrund der Eindrücke, die während des ersten Interviews gesammelt wurden, wurde die Eingangsfrage der Interviews umformuliert und der Leitfaden um Fragen zur zeitlichen Aufteilung zwischen den bestehenden Beziehungen ergänzt, da sich dies als wichtiger Gegenstand des ersten Interviews darstellte.
Die Akquise der interviewten Personen erfolgte bewusst über unterschiedliche Kanäle. Zum einen erschien aufgrund des geringen polyamoren Gesellschaftsanteils bei gleichzeitig persönlichen und intimen Interviewinhalten ein hohes Maß an Mobilisierungsbemühungen ratsam. Zum anderen sollten mögliche Fehlschlüsse durch die Wahl von Interviewpartnern aus nur einem bestimmten räumlichen oder gesellschaftlichen Milieu vermieden werden. Im Fall der reinen Akquise über den Bekanntenkreis des Autors wären vornehmlich junge Personen aus Bremen und Umgebung Teil der Stichprobe gewesen. Die Akquise über die Teilnahme an polyamoren Treffen, die Kontaktaufnahme in Internetforen ergänzt durch Kontakte über den persönlichen Bekanntenkreis ergab eine wesentlich breiter aufgestellte Personengruppe. So konnten Personen im Alter zwischen 26-49 Jahren interviewt werden, die im südwestdeutschen und norddeutschen Raum wohnhaft sind.
Intime und mutmaßlich schambehaftete Interviewthemen können zu verstärktem sozial erwünschtem Antwortverhalten des Interviewten führen (Schnell et al., 2008, S. 355-356). Dies äußert sich während des Interviews durch eine verweigernde Haltung oder Meinungslosigkeit des Interviewten (ebd., S. 356). Aufgrund des intimen Gehalts des Interviewthemas bedurfte dieser Umstand besonderer Beachtung. Da von insgesamt 46 kontaktierten Personen nur 8 Personen ihre Zustimmung für ein Interview gaben, muss den 5 interviewten Personen ein vergleichsweise hohes Maß an Offenheit unterstellt werden. Aus Sicht des Autors schlug sich diese Haltung auch in den Antworten nieder. So zeigten die Interviewten größtenteils ein offenes und glaubwürdiges Antwortverhalten. Lediglich Interviewpartnerin 5 grenzte ihre Antwortgabe zumindest in einem Fall aufgrund persönlicher Hemmnisse ein: „Es gab einmal eine Sache, das werde ich jetzt nicht so erläutern, da hab ich gesagt: ‚Solang du mit mir zusammen bist, mach das bitte nicht‘[…] Es ging um eine sexuelle Erfahrung.“(I5, Z. 159-161).
Die zur Erhebung verwendete Methodik des problemzentrierten Interviews kann im Rückblick als passend betrachtet werden. Durch die teilstrukturierte Form, bestehend aus dem Screeningbogen und dem Interviewleitfaden wurden wichtige Aspekte zur zielgerichteten Durchführung der qualitativen Interviews gewährleistet. Einerseits konnte durch den Screeningbogen sichergestellt werden, dass nur geeignete Interviewpartner tatsächlich interviewt wurden. Anderseits erhielt der Interviewer bereits vor Beginn des Interviews thematische Einstiegsmöglichkeiten oder besonders interessante Zusammenhänge aufgezeigt. Durch den Interviewleitfaden wiederum konnte ein thematisch orientierter Interviewverlauf gewährleistet werden, ohne dass jedoch zu wenige Möglichkeiten zur freien Erzählung durch den Interviewten bestanden hätten. Auch die Auswertungsmethode nach Leithäuser und Volmerg (1988, S. 234-247) hat sich bei Betrachtung des Umfangs der entstandenen Transkripte als sinnhaft erwiesen. Zentrale Erfahrungsfelder konnten auf diese Weise, besonders durch die mehrfache Thematisierung innerhalb unterschiedlicher Interviews, extrahiert werden. Auf eine von Leithäuser und Volmerg (1988, S. 246) angeratene Beratung über die hierbei entstandenen Kernsätze durch weitere Forscher des Themengebiets musste, aufgrund der Tatsache einer alleinigen Forschung durch den Autor, verzichtet werden. Eine Validierung der Ergebnisse mittels Triangulation nach Mayring (2002, S. 147-148) konnte aufgrund fehlender Vergleichsstudien ebenfalls nicht durchgeführt werden.
7 Fazit und Ausblick
Zusammenfassend sind die folgenden Einflussfaktoren zu nennen, die das Identitätsverständnis polyamorer Individuen prägen: So ist bei den Befragten eine kritische und prüfende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen festzustellen, insbesondere bezüglich eines ambivalenten Umgangs mit sexueller Treue in der Partnerschaft. Gleichzeitig ist eine ablehnende Haltung gegenüber Besitz- und Konkurrenzdenken hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen festzustellen. Die Ablehnung dieser Normen beeinflusst dabei die soziale Identität der Individuen und kann bei gleichzeitiger Verteidigung eigener Vorstellungen für das individuelle Kohärenzerleben förderlich sein. Des Weiteren wird Identitätsbildung als Entwicklungsprozess verstanden, bei dem durch die Nutzung unterschiedlicher Beziehungsperspektiven eine umfassendere Entwicklung erhofft wird. Der Vorstellung einer einheitlichen und beständigen Persönlichkeit, dem Konzept eines „Identitätskerns“, stehen die Interviewten ablehnend gegenüber. Sie präferieren ein Identitätsverständnis, was an die pluralistischen Vorstellungen der postmodernen Identitätsforschung anknüpft. Bei der Ausgestaltung der Beziehungen wird dabei vor allem eine persönliche und individualisierte Sichtweise eingenommen. Es gilt das Prinzip: Selbsttreue statt sexueller Treue. Integrität wird stets höher gewichtet als der partnerschaftliche Konsens. Durch Autonomiebestrebungen werden dabei die eigenen Werte vor äußeren Einflüssen geschützt. Dies kann zu einer konfliktreichen Interaktion mit der sozialen Umgebung führen. Fehlende Anerkennung durch das familiäre Umfeld oder den Freundeskreis werden durch den engen Kontakt mit anderen polyamoren Individuen kompensiert, sodass dies dennoch zu einer kohärenten Selbstwahrnehmung führt. Die Freiheiten, die durch die heutige pluralistische Gesellschaft entstehen, werden von den polyamoren Individuen genutzt. Dieser Entgrenzungsprozess wird jedoch durch zeitliche und organisatorische Stressoren begleitet, welche letztlich die bewusste Selbsteinschränkung der Individuen begründen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Einflussfaktoren auf das polyamore Identitätsverständnis. (Eigene Darstellung).
Die genannten Faktoren werden jedoch nicht von allen Befragten in gleicher Intensität beschrieben. Es zeigen sich teilweise deutliche interindividuelle Unterschiede. Mit der vorgestellten Betrachtung werden daher nur alle Einflussfaktoren dargestellt, jedoch nicht abschließend in ihrer Ausprägung beurteilt. Dieser Umstand kann als Grundstein für zukünftige Forschung angesehen werden. So wäre eine, auf der vorliegenden Arbeit aufbauende, quantitative Beurteilung des Forschungsgegenstands als wünschenswert zu betrachten.
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Abels, H. (2010). Identität. Wiesbaden: VS.
Boehm, K. (2014). Undoing Couple? – Intimsphären und ihre Aushandlung in polyamoren Beziehungen. In T. Morikawa (Hrsg.), Die Welt der Liebe – Liebessemantiken zwischen Globalität und Lokalität (S. 275-294). Bielefeld: Transcript.
Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation. Heidelberg: Springer.
Brüderl, J. (2004). Die Pluralisierung partnerschaftlicher Lebensformen in Westdeutschland und Europa. Politik und Zeitgeschichte, 19, 3-10.
Dimbath, O. (2003). Entscheidungen in der individualisierten Gesellschaft – Eine empirische Untersuchung zur Berufswahl in der fortgeschrittenen Moderne. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Erikson, E.H. (1983). Interviewpartner – Der Lebenszyklus und die neue Identität der Menschheit . Psychologie Heute, 10, 28-41.
Gerth, H. & Mills, C. W. (1970). Person und Gesellschaft. Die Psychologie sozialer Institutionen. Frankfurt am Main: Athenräum-Verlag.
Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Wiesbaden: VS.
Keupp, H. (1998). Diskursarena Identität – Lernprozesse in der Identitätsforschung. In H. Keupp & R. Höfer (Hrsg.), Identitätsarbeit heute – Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung (S. 11-39). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Keupp, H. (1999). Identitätskonstruktionen: das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbeck: Rowohlt.
Keupp, H. (2008). Identitätskonstruktionen in der spätmodernen Gesellschaft – Riskante Chancen bei prekären Ressourcen. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 7 (2), 291-308.
Keupp, H., Ahbe, T., Gmür, W., Höfer, R., Kraus, W., Mitzscherlich, B. & Straus, F. (2002). Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Erweiterte Neuauflage. Reinbek: Rowohlt.
Klika, D. (2000). Identität – ein überholtes Konzept? – Kritische Anmerkungen zu aktuellen Diskursen außerhalb und innerhalb der Erziehungswissenschaft. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 2, 285-304.
Kneidinger, B. (2013). Geopolitische Identitätskonstruktionen in der Netzwerkgesellschaft – Medien, Kultur, Kommunikation. Wiesbaden: VS.
Langer, P.C. (2014). Zum Umgang mit Intimität im Forschungsprozess - forschungsethische Implikationen des Sprechens über Sexualität in Peer Research. In H. v. Unger, P. Narimani & R. M’Bayo (Hrsg.), Forschungsethik in der qualitativen Forschung – Reflexivität, Perspektiven, Positionen (S. 169-189). Wiesbaden: VS.
Lautmann, R. (2015). Sexuelle Vielfalt oder ein Ende der Klassifikation. In S. Lewandowski & C. Koppetsch (Hrsg.), Sexuelle Vielfalt und die Unordnung der Geschlechter (S. 29-66). Bielefeld: Transcript Verlag.
Leithäuser, T. & Volmerg, B. (1988). Psychoanalyse in der Sozialforschung - Eine Einführung am Beispiel einer Sozialpsychologie der Arbeit. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Lenz, K. (2009). Soziologie der Zweierbeziehung – Eine Einführung. Wiesbaden: VS.
Mayring, P. (2002). Einführung in die qualitative Sozialpsychologie - Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim / Basel: Beltz.
Moucha, P., Plitsch, D. & Wiechers, H. (2014). Der Online-Dating-Markt. Online verfügbar unter: http://www.singleboersen-vergleich.de/presse/online-dating-markt-2013-2014.pdf [Letzter Zugriff am 16.12.2015].
Müller, B. (2011). Empirische Identitätsforschung. Wiesbaden: VS.
Noack, J. (2010). Erik H. Erikson – Identität und Lebenszyklus. In B. Jörissen & J. Zirfas (Hrsg.), Schlüsselwerke der Identitätsforschung (S. 37-38). Wiesbaden: VS.
Osswald-Rinner, I. (2011). Oversexed and underfucked. Wiesbaden: VS.
Petzold, H.G. (2012). Identität – Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdisziplinäre Perspektiven. Wiesbaden: VS.
Peukert, R. (2012). Familienformen im sozialen Wandel. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Prestel, P. (2013). Valenzorientierte lateinische Syntax mit Formenlehre, Valenzregister und Lernvokabular. Bielefeld: Lulu.
Rüther, C. (2005). Freie Liebe, offene Ehe und Polyamory - Geschichte von Konzepten nicht-monogamer Beziehungen seit den 1960er Jahren in den USA und im deutschsprachigen Raum. Wien: Institut für Geschichte.
Schäfer, H.W. (2015). Identität als Netzwerk. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Schmidt, G., Klusmann, D., Matthiesen, S. & Dekker, A. (1998). Veränderungen des Sexualverhaltens von Studentinnen und Studenten. In G. Schmidt & B. Strauß (Hrsg.), Sexualität in der Spätmoderne – Über den kulturellen Wandel der Sexualität (S. 118-136). Stuttgart: Enke.
Schmidt, G., Matthiesen, S., Dekker, A. & Starke, K. (2006). Spätmoderne Beziehungswelten. Report über Partnerschaft und Sexualität in drei Generationen. Wiesbaden: VS.
Schnell, R., Hill, P.B. & Esser, E. (2008). Methoden der empirischen Sozialforschung. München: Oldenbourg.
Statistisches Bundesamt (2015). Eheschließungen. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Eheschliessungen/Tabellen/ErstEhenWiederverheiratung.html [Letzter Zugriff am 16.12.2015].
Sternberg, R.J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119-135.
Stroll, A. (1972). Identity. In P. Edwards (Hrsg.), The Encyclopedia of Philosophy. (S. 121). New York / London: Macmillan.
Volz, R. & Zulehner, P.M. (2009). Männer in Bewegung – Zehn Jahre Männerentwicklung in Deutschland. Baden-Baden: Nomos.
Walzer, M. (1993). Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus. In A. Honneth (Hrsg.), Kommunitarismus – Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften (S. 157-180). Frankfurt / New York: Campus.
Welsch, W. (1990). Identität im Übergang. Philosophische Überlegungen zur aktuellen Affinität von Kunst, Psychiatrie und Gesellschaft. In O. Benkert & P. Gorsen (Hrsg.), Von Chaos und Ordnung der Seele - Ein interdisziplinärer Dialog über Psychiatrie und moderne Kunst (S. 91-106). Berlin / Heidelberg: Springer.
Wilson, T. P. (1970). Theorien der Interaktion und Modelle Soziologischer Erklärung. In Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.), Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit (S. 54-79). Reinbek: Rohwolt.
Wirth, S. (undatiert). Verschiedene Arten von Poly. Online verfügbar unter: http://www.polyamorie.de/verschiedene-arten-von-poly.html [Letzter Zugriff am 29.11.2015].
Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Online verfügbar unter: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/%201132/2519 [Letzter Zugriff am 10.12.2015].
Anhang
Interviewleitfaden Seite 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang
Interviewleitfaden Seite 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang
Screeningbogen
Häufig gestellte Fragen zum Text
Was ist der Fokus dieser Forschungsarbeit?
Die vorliegende Forschungsarbeit zielt darauf ab, das Selbstverständnis von Menschen zu erheben und zu charakterisieren, die polyamore Beziehungen führen. Dabei wird insbesondere untersucht, welche gesellschaftlichen und individuellen Identitätsverständnisse diesem Lebensentwurf zugrunde liegen.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Identitätsbegriff, seine historische Entwicklung und postmoderne Interpretationen. Zudem werden gesellschaftliche Wandlungsprozesse, insbesondere im Hinblick auf Partnerschaft und Familie, sowie die Merkmale und Formen polyamorer Beziehungen dargestellt.
Welche Methodik wird in der Forschungsarbeit angewendet?
Es handelt sich um eine qualitative Forschungsarbeit, die auf dem interpretativen Paradigma basiert. Es werden problemzentrierte Interviews mit polyamoren Personen geführt und die Ergebnisse mithilfe der Kernsatzmethode ausgewertet. Zudem werden Gütekriterien qualitativer Forschung berücksichtigt.
Wie wurden die Interviewpartner für die Untersuchung ausgewählt?
Die Untersuchungsgruppe wurde durch verschiedene Methoden rekrutiert, darunter Anzeigen in Internetforen, Teilnahme an Stammtischtreffen polyamorer Personen und Kontakte über den persönlichen Bekanntenkreis. Es wurden Personen mit hetero- oder bisexueller Neigung ausgewählt, die nicht Teil desselben Beziehungskonstrukts sind.
Welche zentralen Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Zu den zentralen Ergebnissen gehören die kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen, die Fokussierung des "Ich" und die Entwertung des "Wir", die Bedeutung von Integrität für ein kohärentes Selbstbild, die Wahrnehmung der Beziehungskonstruktion als identitätsstiftender Anpassungsprozess sowie die neuen Konfliktfelder, die durch den Entgrenzungsprozess entstehen.
Was sind die Schlussfolgerungen der Forschungsarbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Identitätsverständnis polyamorer Individuen durch verschiedene Faktoren geprägt ist, darunter eine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen, eine Fokussierung auf Autonomie, die Betonung von Integrität und ein Verständnis von Identität als wandelbare und pluralistische Konstruktion.
Welche Grenzen und zukünftigen Forschungsperspektiven werden in der Arbeit aufgezeigt?
Die Arbeit diskutiert die Subjektivität des Forschungsgegenstands und die Grenzen der qualitativen Methodik. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Ergebnisse durch quantitative Forschung zu validieren und die interindividuellen Unterschiede im Identitätsverständnis polyamorer Personen genauer zu untersuchen.
Was sind die Hauptmerkmale der Polyamorie, wie in der Arbeit definiert?
Polyamorie wird durch vier Hauptmerkmale definiert: erotische Liebe mit mehr als einer Person, Transparenz und Ehrlichkeit gegenüber allen Partnern, Gleichberechtigung und Konsens aller Beteiligten sowie die langfristige Ausrichtung der Beziehungen.
Welche Formen polyamorer Beziehungskonstrukte werden unterschieden?
Es werden drei Unterformen unterschieden: Beziehungen mit einer priorisierten Beziehung ("Primary") und weiteren Beziehungen ("Secondary"), Beziehungen mit mehreren gleichberechtigten "Primary"-Beziehungen (Dreier-, Vierer- oder Mehrfachbeziehungen) und Personen, die in keiner "Primary"-Beziehung leben ("Poly-Singles").
Wie unterscheidet sich Polyamorie von anderen Beziehungsformen?
Polyamorie unterscheidet sich von Monogamie durch die Möglichkeit der erotischen Liebe zu mehreren Personen. Von Affären und Seitensprüngen unterscheidet sie sich durch Transparenz und Ehrlichkeit. Von Polygynie oder Polyandrie unterscheidet sie sich durch Gleichberechtigung und Konsens. Und vom Swingen oder offenen Beziehungen unterscheidet sie sich durch die langfristige Ausrichtung der Beziehungen.
- Citation du texte
- Johannes Kübler (Auteur), 2015, Identitätsverständnis polyamorer Individuen. Veränderung der Beziehungswelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334564