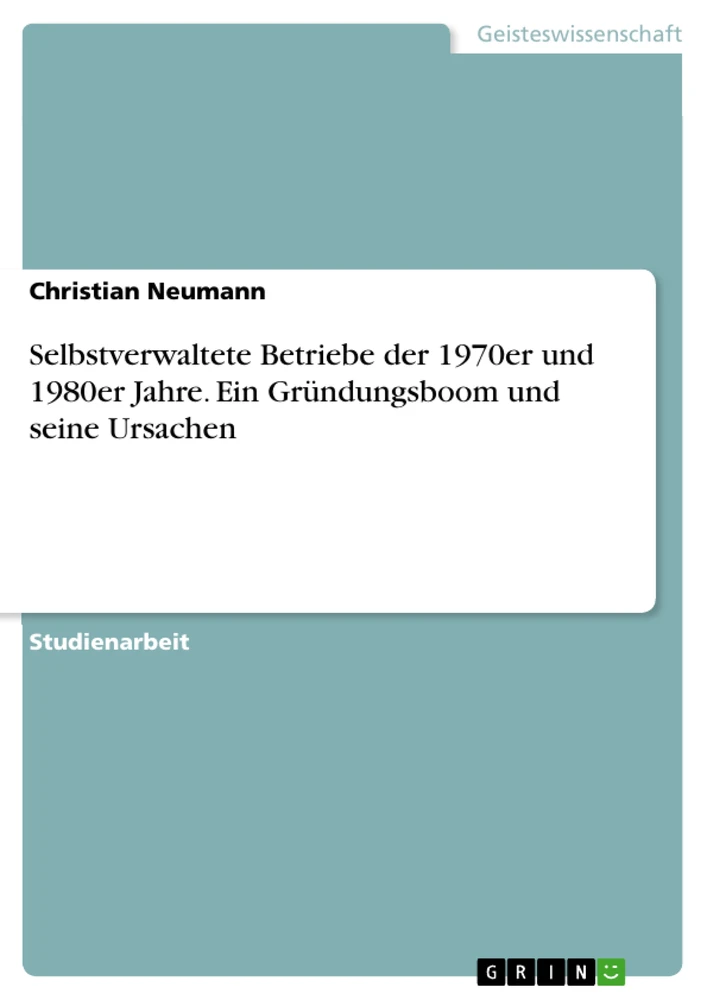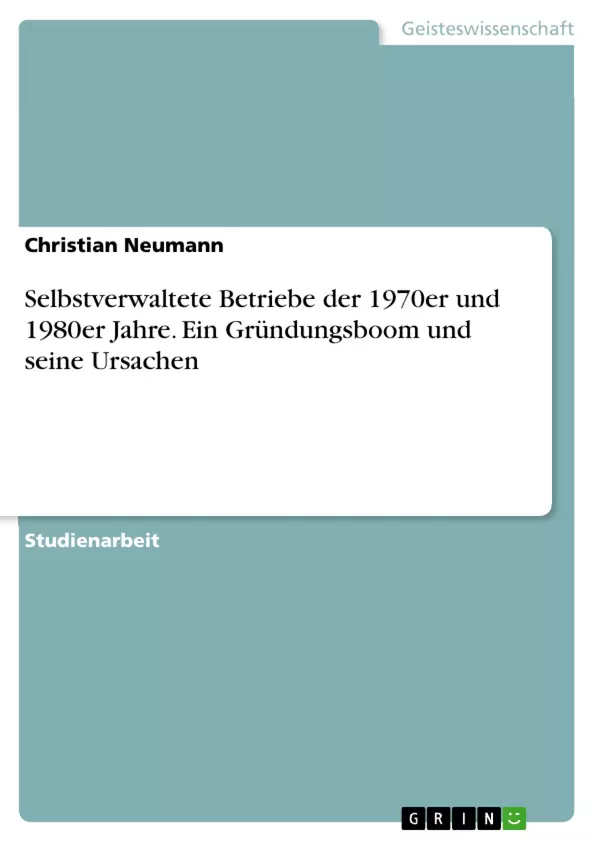„Toll: Hier ist der Lehrling sein eigener Chef“ titelte der Düsseldorfer Express 1986 und veröffentlichte einen begeisterten Artikel über eine selbstverwaltete Schreinerei. Selbstverwaltete Betriebe hatten zu dieser Zeit ein durchaus positives Image, sogar in der Boulevardpresse. Seit Anfang der 1980er Jahre waren sie Objekt zahlloser Studien, produzierten aber auch selber reichlich Statements, Programmentwürfe, Selbstdarstellungen.
Mit dem selbstverwalteten Betrieb waren große Erwartungen und Befürchtungen verbunden. Für die einen bedeuteten sie den ersten Schritt in Richtung Sozialismus, die Befreiung des Menschen von entfremdeter Arbeit, für die anderen waren sie ein Hort kommunistischen Schlendrians. Aber auch die offizielle Politik erhoffte sich nützliche Effekte. Schließlich schafften sie Arbeitsplätze, oft für sonst schwer vermittelbare Personen. Vielleicht konnten sie einen Beitrag zur Reduzierung der konstant hohen Zahl von Langzeitarbeitslosen leisten.
Es ist schwer, die tatsächliche Anzahl solcher Betriebe und den darin Beschäftigten zu erfassen. Schließlich wurden sie in keiner offiziellen Statistik gesondert ausgewiesen. Verschiedene Untersuchungen kamen mal zu einer Gesamtzahl der Projekte von 11.500 Betrieben mit 80.000 Mitarbeitern (1980), mal auf 18.000 Betriebe mit 200.000 Beschäftigten (1986). Die große Aufmerksamkeit, die sie genossen, und ihre nicht zu vernachlässigende Größe rechtfertigen es, sich näher mit der Frage, welche besonderen sozialen und politischen Bedingungen diesen Gründungsboom ermöglichten, zu befassen.
Eine verwendete Quelle ist ein historischer Rückblick über die Entwicklung des Projekts ‚Krebsmühle‘, das aus dem selbstverwalteten Betrieb ASH entstand. Darin wird auch eine 1983 verfasste Broschüre der ASH verwendet, die die ersten 8 Jahre des Projekts beschreibt. Die zweite Quelle ist eine Ausgabe einer Zeitung (Wir wollen’s anders), die insgesamt 6 mal erschien und der Kommunikation zwischen verschiedenen ‚alternativen Projekten‘ dienen sollte. Kollektivbetriebe‘ wurden in den 70er und 80er Jahren in der ganzen westlichen Welt gegründet. Diese Arbeit beschränkt sich auf die damalige Bundesrepublik. Zeitlich wird sie eingegrenzt von den ersten Krisenjahren Anfang der 1970er und dem Verschwinden dieser Betriebe aus dem öffentlichen Bewusstsein zum Ende der 1980er.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstverwaltung und Genossenschaft
- Genossenschaften
- Selbstverwaltete Betriebe (SB) der 70er und 80er Jahre
- Selbstverwaltete Betriebe und Linksalternatives Milieu
- Die Arbeiterselbsthilfe Frankfurt
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für eine Betriebsgründung
- Die Schrotbäckerei Wiesbaden
- Die, Genossenschaftshütte'
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die selbstverwalteten Betriebe der 1970er und 1980er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert den Gründerboom dieser Zeit und die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ihn ermöglichten. Darüber hinaus beleuchtet sie die Verbindung zwischen diesen Betrieben und dem linksalternativen Milieu der 70er Jahre.
- Die Entstehung und Entwicklung selbstverwalteter Betriebe
- Die Rolle des linksalternativen Milieus
- Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen der 70er Jahre
- Beispiele für selbstverwaltete Betriebe und ihre Herausforderungen
- Die Bedeutung selbstverwalteter Betriebe im Kontext der Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der selbstverwalteten Betriebe der 1970er und 1980er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland dar. Sie beschreibt das positive Image dieser Betriebe, insbesondere in der Boulevardpresse, und die zahlreichen Studien und Statements, die in dieser Zeit entstanden sind. Außerdem werden die verschiedenen Erwartungen und Befürchtungen im Zusammenhang mit selbstverwalteten Betrieben beleuchtet, sowohl aus der Perspektive von Befürwortern und Kritikern als auch aus der Sicht der Politik.
Selbstverwaltung und Genossenschaft
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Selbstverwalteter Betrieb" und grenzt ihn von Genossenschaften ab. Es werden die zentralen Merkmale selbstverwalteter Betriebe herausgestellt, wie die Entscheidungsgewalt der im Betrieb Arbeitenden und das Gemeineigentum des Kapitals. Auch werden verschiedene Prinzipien, die mit selbstverwalteten Betrieben verbunden sind, aber nicht in jedem Fall zutreffen, wie zum Beispiel gleicher Lohn und Rotationsprinzip, vorgestellt.
Genossenschaften
Dieses Unterkapitel beleuchtet die Geschichte der Genossenschaften im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung im Kontext der Industrialisierung und Gewerbefreiheit. Es wird der Zusammenhang zwischen Genossenschaften und den Ideen der Selbstverwaltung und des Gemeineigentums aufgezeigt.
Selbstverwaltete Betriebe (SB) der 70er und 80er Jahre
Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Entwicklung und die Verbreitung selbstverwalteter Betriebe in den 1970er und 1980er Jahren. Es geht auf die Bezeichnungen "Alternativbetrieb" und "Kollektiv" ein und stellt die Unterschiede zwischen selbstverwalteten Betrieben und herkömmlichen Betrieben heraus.
Selbstverwaltete Betriebe und Linksalternatives Milieu
Dieses Kapitel untersucht die enge Verbindung zwischen selbstverwalteten Betrieben und dem linksalternativen Milieu der 1970er Jahre. Es betrachtet die Rolle der Arbeiterselbsthilfe Frankfurt und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Gründung von selbstverwalteten Betrieben.
Die Arbeiterselbsthilfe Frankfurt
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Arbeiterselbsthilfe Frankfurt als einem wichtigen Beispiel für ein linksalternatives Projekt, das die Gründung selbstverwalteter Betriebe förderte.
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für eine Betriebsgründung
Dieses Unterkapitel analysiert die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der 1970er Jahre, die die Gründung selbstverwalteter Betriebe ermöglichten oder erschwerten. Es geht auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und die Arbeitsmarktsituation ein.
Die Schrotbäckerei Wiesbaden
Dieses Unterkapitel stellt die Schrotbäckerei Wiesbaden als Beispiel für einen selbstverwalteten Betrieb vor und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Gründung und dem Betrieb eines solchen Unternehmens verbunden waren.
Die, Genossenschaftshütte'
Dieses Unterkapitel präsentiert einen weiteren Typus selbstverwalteten Betriebs, bei dem die Belegschaft eines bestehenden Betriebs diesen nach drohender Schließung übernimmt. Es wird auf die spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten dieser Form der Betriebsübernahme eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Selbstverwaltung, Genossenschaften, linksalternatives Milieu, Arbeitsmarkt, Betriebsgründung, Wirtschaftskrise, Arbeiterselbsthilfe, Alternative Betriebe und die soziale und politische Situation der 1970er und 1980er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus werden wichtige Beispiele für selbstverwaltete Betriebe wie die Schrotbäckerei Wiesbaden und die Arbeiterselbsthilfe Frankfurt analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnete selbstverwaltete Betriebe in den 70er und 80er Jahren aus?
Zentrales Merkmal war die Entscheidungsgewalt der arbeitenden Belegschaft und das Gemeineigentum am Kapital, oft verbunden mit Prinzipien wie Einheitslohn und Rotation.
Wie viele solcher Betriebe gab es in Deutschland?
Untersuchungen schätzten die Zahl Mitte der 80er Jahre auf bis zu 18.000 Betriebe mit rund 200.000 Beschäftigten.
Welche Rolle spielte das linksalternative Milieu?
Viele Gründungen entstanden aus dem Wunsch nach "nicht-entfremdeter Arbeit" und als politischer Gegenentwurf zur hierarchischen Wirtschaftswelt der damaligen Zeit.
Was war das Projekt „Krebsmühle“?
Die Krebsmühle ist ein bekanntes Beispiel für ein Projekt, das aus der Arbeiterselbsthilfe (ASH) hervorging und über Jahrzehnte als selbstverwalteter Betrieb bestand.
Warum erhoffte sich die Politik positive Effekte von diesen Betrieben?
Man sah in ihnen eine Chance, Arbeitsplätze für schwer vermittelbare Personen zu schaffen und die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren.
- Citar trabajo
- Christian Neumann (Autor), 2016, Selbstverwaltete Betriebe der 1970er und 1980er Jahre. Ein Gründungsboom und seine Ursachen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334621