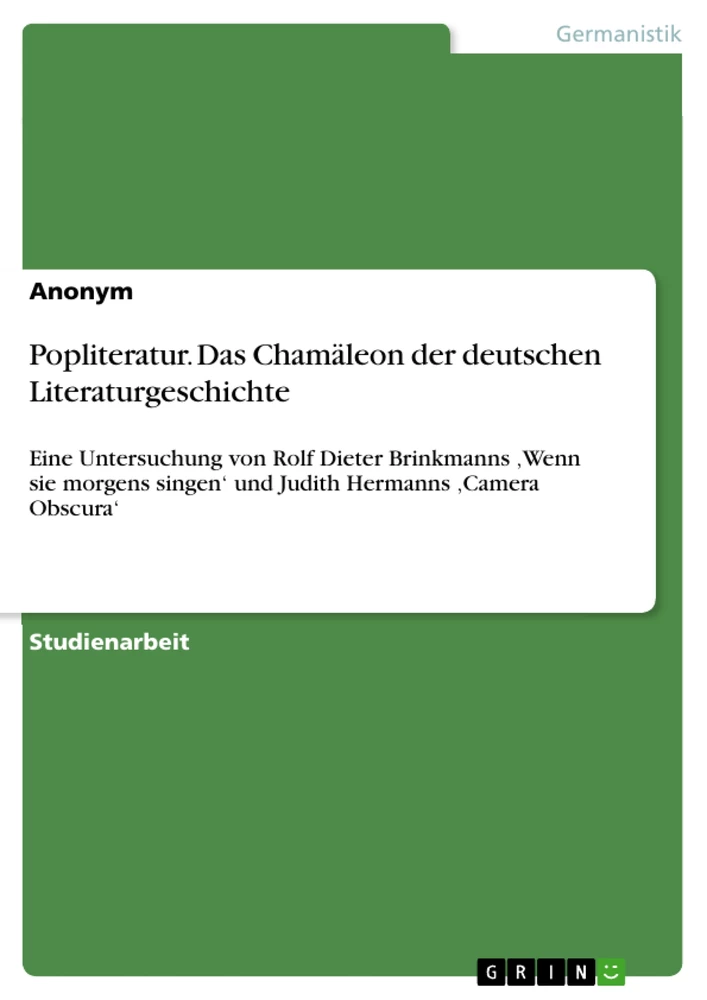In dieser Hausarbeit versuche ich, dem vielschichtigen und facettenreichen Begriff der Popliteratur ein Gesicht zu verleihen. Um dies verwirklichen zu können, habe ich mich mit einem breiten Autoren-Spektrum auseinandergesetzt und über die Mauern der Popliteratur in die Bereiche der bildenden Kunst sowie der Musik hinein geschnuppert; wobei ich diese inhaltlich weitestgehend außer Acht lassen werde, um den Rahmen dieser Hausarbeit nicht zu sprengen.
Innerhalb meiner Vorbereitungsphase bin ich sowohl auf Wiederholungen und Übereinstimmungen, als auch auf Gegensätzlichkeit und Widersprüche getroffen, die mir gezeigt haben, dass die Begrifflichkeit des ‚Pop‘ im Grunde genommen lediglich eine Hülle ist, die jeder, wenn er nur fundiert argumentiert, beliebig füllen kann. In Fachkreisen ist man sich sowohl über die Herkunft des Wortes ‚Pop‘, als auch über dessen genaue Bedeutung uneinig weshalb auch die Popliteratur ein nahezu undurchschaubarer Schleier innerhalb der deutschen Literaturgeschichte ist.
Um mein Vorhaben dennoch verwirklichen zu können, werde ich mich zuerst einmal mit der Definition des ‚Pop’ beschäftigen, um in Folge dessen über Herkunft, Entstehung und Geschichte der deutschen Popliteratur zu berichten. Abschließend werde ich mich auf den Vergleich des 1960er Pops mit dem 1990er Pop konzentrieren, wobei mir die Kurzgeschichten ‚Wenn sie morgens singen‘ von Rolf Dieter Brinkmann sowie Judith Hermanns ‚Camera Obscura‘ als Belegtexte dienen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition „Pop“
- Ursprung, Entstehung und Geschichte der deutschen Popliteratur
- Dadaismus und Beat Generation als Vorläufer der deutschen Popliteratur
- „Cross the border, close the gap“ – Leslie A. Fiedlers Aufsatz als Appell an die Gegenwartsliteratur und ihre Autoren
- Einzug und Entwicklung der Popliteratur innerhalb der deutschen Literaturgeschichte
- Ursprung der deutschen Popliteratur
- Entstehung und Entwicklung der popliterarischen Strömung Deutschlands von den 1960ern bis ins 21. Jahrhundert
- Aufzeichnen der generationsspezifischen Charakteristika der 1960er und 1990er Popliteratur anhand der Kurzgeschichten „Wenn sie morgens singen“ und „Camera Obscura“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der vielschichtigen und facettenreichen Thematik der Popliteratur. Die Arbeit analysiert die Entstehung, Entwicklung und die charakteristischen Merkmale der deutschen Popliteratur, indem sie ein breites Spektrum an Autoren und Werken untersucht. Dabei werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede zwischen der Popliteratur der 1960er und 1990er Jahre beleuchtet, um das Wesen dieses literarischen Phänomens zu verstehen.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Pop“
- Die Vorläufer der deutschen Popliteratur: Dadaismus und Beat Generation
- Die Einbindung der Popliteratur in die deutsche Literaturgeschichte
- Der Einfluss von Musik und bildender Kunst auf die Popliteratur
- Analyse der generationsspezifischen Merkmale der Popliteratur anhand von Beispieltexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Popliteratur ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 3 befasst sich mit der Definition des Begriffs „Pop“ und beleuchtet dessen vielschichtige Bedeutung und seinen Einfluss auf die Literatur. Kapitel 4 untersucht den Ursprung, die Entstehung und die Entwicklung der deutschen Popliteratur, wobei der Einfluss des Dadaismus und der Beat Generation sowie die Einbindung in die deutsche Literaturgeschichte im Fokus stehen. Kapitel 5 analysiert die generationsspezifischen Charakteristika der Popliteratur anhand der Kurzgeschichten „Wenn sie morgens singen“ von Rolf Dieter Brinkmann und „Camera Obscura“ von Judith Hermann.
Schlüsselwörter
Popliteratur, deutsche Literaturgeschichte, Dadaismus, Beat Generation, 1960er Jahre, 1990er Jahre, Kurzgeschichte, „Wenn sie morgens singen“, „Camera Obscura“, Rolf Dieter Brinkmann, Judith Hermann.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Popliteratur?
Popliteratur ist ein facettenreicher Begriff, der oft als „Hülle“ dient. Sie zeichnet sich durch die Nähe zur Alltagskultur, Musik und bildenden Kunst aus.
Wer sind die Vorläufer der deutschen Popliteratur?
Als wichtige Vorläufer gelten der Dadaismus und die amerikanische Beat Generation der 1950er Jahre.
Wie unterscheidet sich der Pop der 1960er vom Pop der 1990er Jahre?
Die Arbeit vergleicht beide Generationen anhand von Texten von Rolf Dieter Brinkmann (60er) und Judith Hermann (90er) hinsichtlich ihrer Lebensgefühle und Stile.
Was bedeutet der Appell „Cross the border, close the gap“?
Dieser Aufsatz von Leslie A. Fiedler forderte die Überwindung der Grenze zwischen Hochkultur und Unterhaltungsliteratur, was wegweisend für die Popliteratur war.
Welche Rolle spielt die Musik in der Popliteratur?
Musik ist oft zentrales Thema oder stilistisches Vorbild; Popliteratur versucht häufig, die Rhythmik und Ästhetik der Popmusik in Sprache zu übersetzen.
Warum wird Popliteratur als „Chamäleon“ bezeichnet?
Weil sie sich ständig wandelt, schwer greifbar ist und sich den jeweiligen Zeitströmungen und kulturellen Kontexten flexibel anpasst.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Popliteratur. Das Chamäleon der deutschen Literaturgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334740