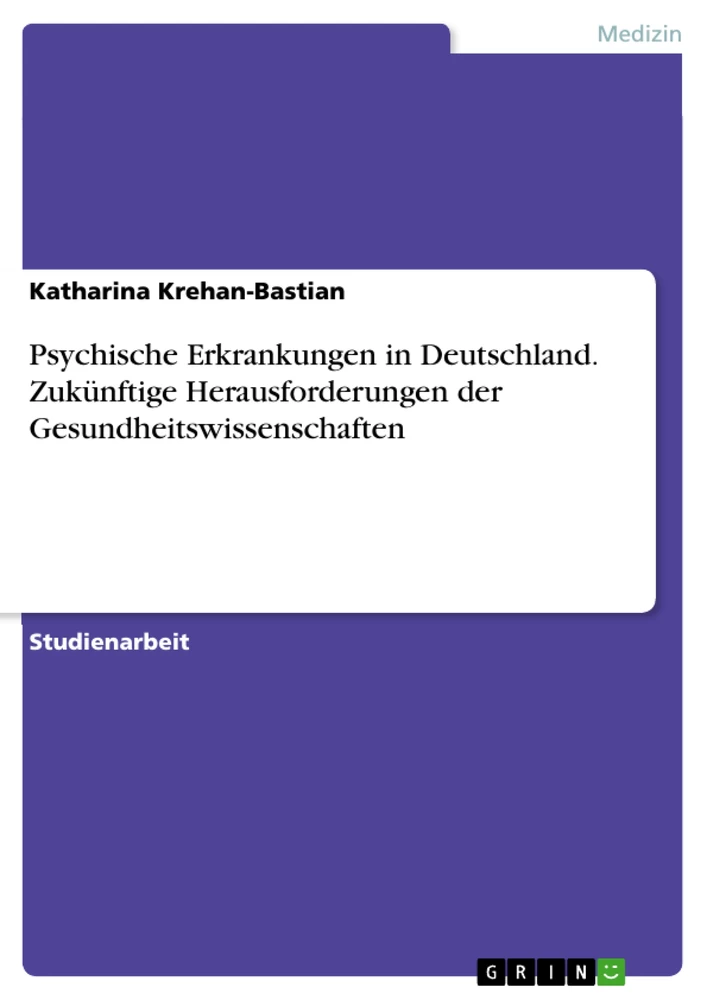Es wird die Zusammensetzung von Altersgruppen bis zum Jahr 2060 betrachtet sowie ein Überblick über die sozioökonomische Situation, der Risikofaktoren, der Ressourcen und der Entwicklung psychischer Erkrankungen gegeben. Weiter werden die Auswirkungen der Zunahme psychischer Erkrankungen auf die Gesundheitsversorgung der Senioren erläutert und Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung zur Stärkung der psychischen Gesundheit der Senioren in Deutschland beschrieben.
Die Bevölkerungszahl in Deutschland sinkt. Bedingt durch den demografischen Wandel wird im Jahr 2060 jeder Dritte mindestens 65 Jahre alt sein. Der Anteil der Hochbetagten wird sich verdoppeln.
Viele Senioren genießen bei guter Gesundheit und materiellem Wohlstand ein aktives Leben. Gleichzeitig müssen zahlreiche Ältere mit gesundheitlichen Einschränkungen und geringen ökonomischen Ressourcen ihren Alltag bewältigen.
Um das 80. Lebensjahr steht die betrachtete Bevölkerungsgruppe an der Schwelle der Hochbetagtheit. Zunehmend erschwert ist der Erhalt der Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden sinkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktuelle Daten zur Entwicklung der betrachteten Altersgruppe
- 2.1 Definition der Altersgruppe „Senioren“
- 2.2 Anteil in Bezug auf die Gesamtbevölkerung
- 2.3 Regionale Verteilung
- 3. Ursachen der Zunahme psychischer Erkrankungen
- 3.1 Risikofaktoren der Senioren
- 3.2 Ressourcen der Senioren
- 4. Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung der Altersgruppe
- 5. Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung
- 5.1 Präventive Ansätze psychischer Erkrankungen
- 5.2 Präventive Ansätze demenzieller Erkrankungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der steigenden Prävalenz und Inzidenz von psychischen Erkrankungen bei Senioren in Deutschland. Sie analysiert die Altersgruppe ab dem 60. Lebensjahr und untersucht die demografischen Veränderungen, sozioökonomischen Faktoren, Risikofaktoren und Ressourcen, die zur Zunahme psychischer Erkrankungen beitragen. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Gesundheitsversorgung und stellt präventive Ansätze zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Senioren vor.
- Demografischer Wandel und steigender Anteil der Senioren in Deutschland
- Sozioökonomische Situation und Risikofaktoren für psychische Erkrankungen bei Senioren
- Auswirkungen der Zunahme psychischer Erkrankungen auf die Gesundheitsversorgung
- Präventive Ansätze zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Senioren
- Herausforderungen der Gesundheitswissenschaften im Kontext der steigenden Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Senioren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz der Betrachtung der Altersgruppe der Senioren im Kontext der steigenden Prävalenz und Inzidenz von psychischen Erkrankungen. Kapitel 2 beleuchtet die demografische Entwicklung der Altersgruppe der Senioren in Deutschland und zeigt die Veränderungen in Bezug auf Anteil und regionale Verteilung auf. Kapitel 3 widmet sich den Ursachen der Zunahme psychischer Erkrankungen bei Senioren und analysiert Risikofaktoren und Ressourcen dieser Altersgruppe. Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der steigenden Prävalenz psychischer Erkrankungen auf die Gesundheitsversorgung der Senioren. Schließlich stellt Kapitel 5 präventive Ansätze zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Senioren vor, wobei sowohl psychische als auch demenzielle Erkrankungen berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Senioren, psychische Erkrankungen, Demenz, Prävalenz, Inzidenz, Risikofaktoren, Ressourcen, Gesundheitsversorgung, Prävention, Gesundheitsförderung, demografischer Wandel, sozioökonomische Situation, Lebenserwartung, Altersstruktur, regionale Verteilung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelt sich der Anteil der Senioren in Deutschland bis 2060?
Bedingt durch den demografischen Wandel wird im Jahr 2060 voraussichtlich jeder dritte Einwohner in Deutschland mindestens 65 Jahre alt sein.
Was sind die häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter?
Die Arbeit thematisiert insbesondere die Zunahme von Depressionen und demenziellen Erkrankungen in der Altersgruppe der Senioren.
Welche Risikofaktoren begünstigen psychische Erkrankungen bei Senioren?
Zu den Risikofaktoren zählen gesundheitliche Einschränkungen, geringe ökonomische Ressourcen, soziale Isolation und der Verlust von Bezugspersonen.
Welche präventiven Maßnahmen gibt es zur Stärkung der psychischen Gesundheit?
Präventive Ansätze umfassen Gesundheitsförderung, soziale Aktivierung, frühzeitige Diagnose von Demenz und die Stärkung individueller Ressourcen.
Wie wirkt sich der demografische Wandel auf das Gesundheitssystem aus?
Die Zunahme hochbetagter Menschen mit psychischen Erkrankungen stellt die Gesundheitsversorgung vor große personelle und finanzielle Herausforderungen.
- Arbeit zitieren
- Katharina Krehan-Bastian (Autor:in), 2014, Psychische Erkrankungen in Deutschland. Zukünftige Herausforderungen der Gesundheitswissenschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334858