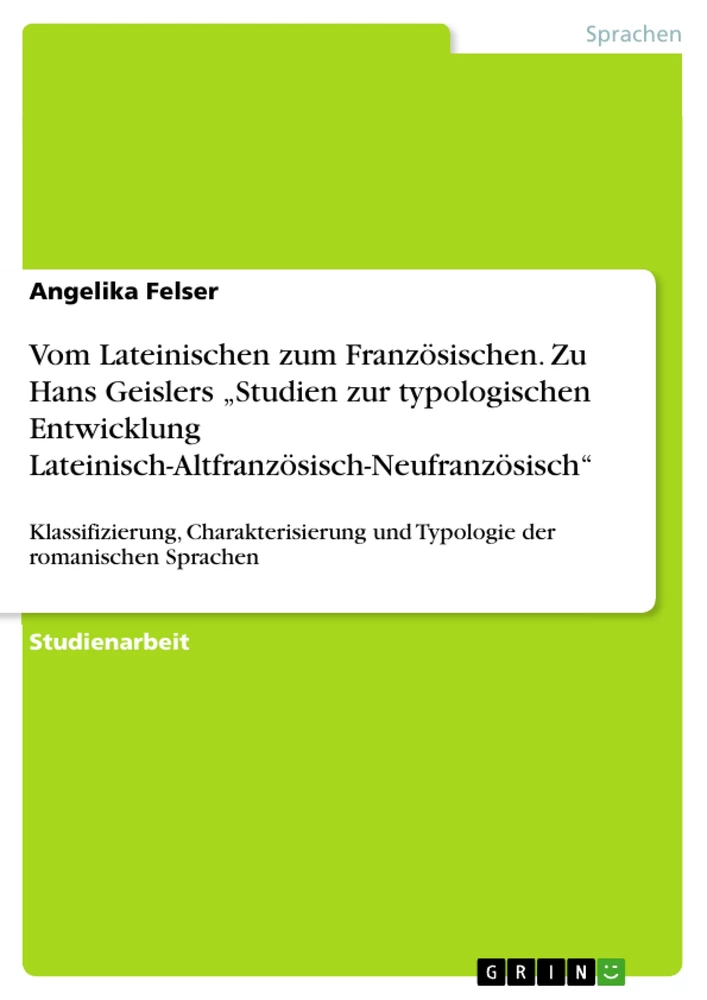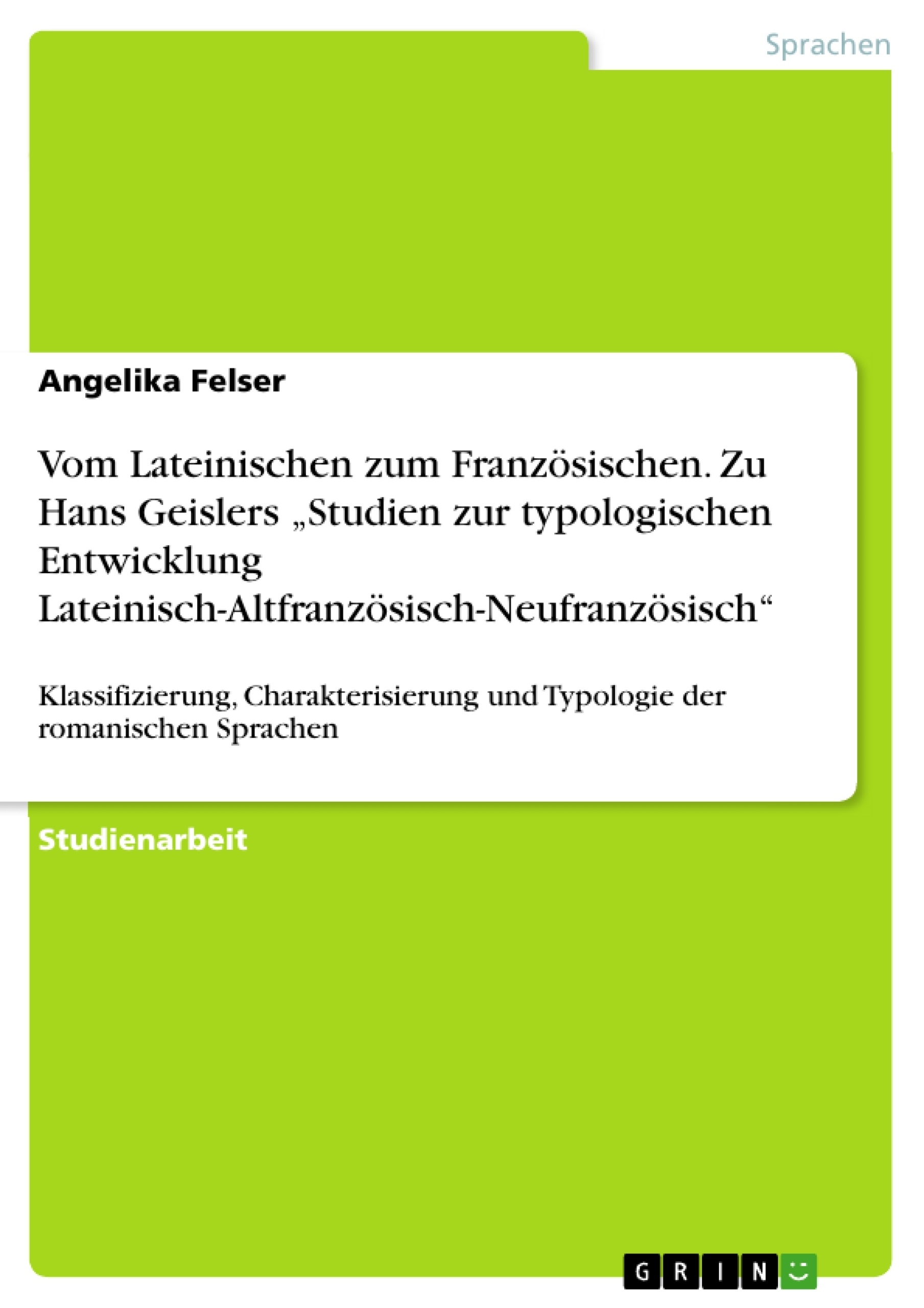Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Hans Geislers Studien zur typologischen Entwicklung des Französischen. Der Autor untersucht, beginnend vom Indogermanischen über das Lateinische und Altfranzösische hin zum Neufranzösischen, sowohl synchron als auch diachron ausgewählte Themengebiete und er setzt so genannte „Parameter“, die miteinander korrelieren und einen Sprachwandel auslösen können.
Dazu beschreibt er das lateinische Kasussystem und anschließend dessen Informationsübertragung auf Präpositionen; weiterhin geht er auf Desemantisierungsprozesse am Beispiel der Adverbbildung ein. Es folgen Einwirkungen auf den Intonations- und Akzentbereich und Auswirkungen der Verbzweitstellung auf zuletzt genannte. Es zeigt sich dabei deutlich, dass die typologischen Veränderungen nicht individuell zu sehen sind, sondern als ein miteinander verflochtenes Netzwerk, dessen Fäden sich gegenseitig halten und die Entwicklungen vorantreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das lateinische Kasussystem
- 3 Funktionsübertragung der Kasus auf Präpositionen
- 3.1 Primär semantische Funktionen
- 3.2 Grammtische Funktionen
- 4 Desemantisierungsprozesse
- 4.1 Veränderungen im Adverbialbereich
- 4.2 Veränderungen im Intonations- und Akzentbereich
- 4.3 Die Verbzweitstellung und Veränderungen im Verbalbereich
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Hans Geislers Studien zur typologischen Entwicklung des Französischen. Der Autor untersucht den Sprachwandel vom Indogermanischen über das Lateinische und Altfranzösische bis hin zum Neufranzösischen. Er analysiert synchron und diachron ausgewählte Themengebiete und verwendet dabei „Parameter“, die miteinander korrelieren und einen Sprachwandel auslösen können.
- Die Rolle des Sprachwandels als „zweckgerichtetes Mittel zur Optimierung der sprachlichen Kommunikation“
- Die Bedeutung des Ökonomieprinzips in der Sprache, das durch „Dekodierungs-“ und „Enkodierungsstrategien“ gekennzeichnet ist
- Die Untersuchung des lateinischen Kasussystems und dessen Funktionsübertragung auf Präpositionen
- Die Analyse von Desemantisierungsprozessen im Bereich der Adverbbildung
- Die Auswirkungen von Veränderungen im Intonations- und Akzentbereich sowie der Verbzweitstellung auf die typologische Entwicklung des Französischen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Arbeit von Hans Geisler und seine Studien zur typologischen Entwicklung des Französischen vor. Geisler betrachtet Sprache als ein sich ständig änderndes, selbstregulierendes System, das durch zwei gegensätzliche Prinzipien – „least effort“ und „the desire to be understood“ – geprägt ist. Diese Prinzipien entsprechen den „Dekodierungs-“ und „Enkodierungsstrategien“, die die grammatikalische Information entweder maximieren oder reduzieren.
Kapitel 2 analysiert das lateinische Kasussystem, das im Gegensatz zum Indogermanischen bereits vorwiegend grammatikalisch war. Die Funktionen der fünf lateinischen Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv, Ablativ) werden beschrieben. Geisler argumentiert, dass der Akkusativ im klassischen Latein vorwiegend eine grammatische Funktion hatte, während der Dativ und der Genitiv zunehmend durch Präpositionen ersetzt wurden.
Schlüsselwörter
Typologische Entwicklung, Sprachwandel, Französisch, Latein, Kasussystem, Präpositionen, Desemantisierung, Adverbbildung, Intonation, Akzent, Verbzweitstellung, Ökonomieprinzip, Dekodierungsstrategien, Enkodierungsstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich das Französische aus dem Lateinischen?
Die Entwicklung verlief über typologische Veränderungen, bei denen komplexe Kasussysteme durch Präpositionen und feste Wortstellungen ersetzt wurden.
Was ist das Ökonomieprinzip in der Sprachentwicklung?
Sprachwandel folgt oft dem Prinzip des „geringsten Aufwands“ (least effort) bei gleichzeitigem Wunsch, verstanden zu werden.
Was versteht man unter Desemantisierung?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Wörter ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und rein grammatische Funktionen übernehmen, wie etwa bei der Adverbbildung.
Welche Rolle spielt die Verbzweitstellung?
Die Position des Verbs im Satz beeinflusst die gesamte Satzstruktur und steht in Wechselwirkung mit Veränderungen im Akzent- und Intonationsbereich.
Was sind die „Parameter“ des Sprachwandels nach Hans Geisler?
Es sind miteinander korrelierende Faktoren (z. B. Kasusverlust und Präpositionengebrauch), die gemeinsam den typologischen Wandel einer Sprache vorantreiben.
- Quote paper
- Angelika Felser (Author), 1995, Vom Lateinischen zum Französischen. Zu Hans Geislers „Studien zur typologischen Entwicklung Lateinisch-Altfranzösisch-Neufranzösisch“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334926