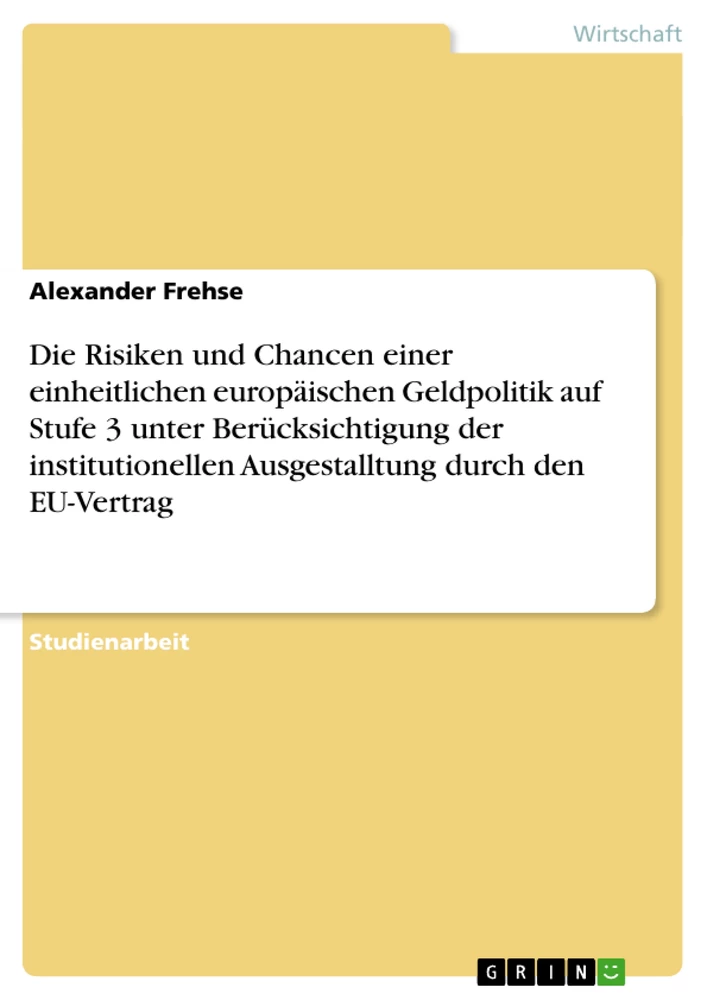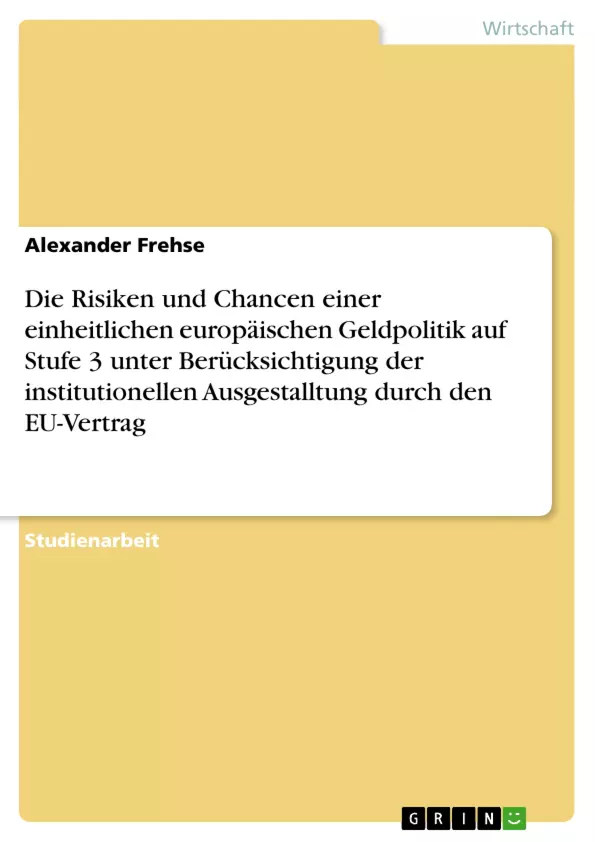Im Zuge eines immer stärker zunehmenden Glaobalisierungsdruckes, sich immer weiter ausbreitender und diversifizierender internationaler Finanzmärkte und stetig steigender internationaler Wirtschaftsbeziehungen verlieren nach und nach nationale Wirtschaftspolitiken an Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklungen an den Finanz- und Wirtschaftsmärkten. Daraus resultiert, wenn man ein Schreckensszenario entwickeln und auf die Spitze treiben will, schlußendlich ein Verlust der Einflussnahme auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel der Beschäftigungspolitik und anderen.
Daher, aber auch aus Gründen des weltwirtschaftlich steigenden Konkurrenz- und Effizienzgedankens, ist die Politik Europas seit nunmehr 45 Jahren bestrebt, einen einheitlichen europäischen Wirtschaftsraum zu schaffen, um zum Wohle Aller die Wirtschaft Europas weltmarktfähig zu halten und zu fördern. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist die 1991 auf der EG-Konferenz in Maastricht von den europäischen Staats- und Regierungschefs beschlossene Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), die in drei Stufen zu einer gemeinschaftlichen Währung, dem ECU (der später dann in Euro umbenannt wurde) führen sollte und zum 01.01.1999 geführt hat. Neben anderem beinhaltet dieser Vertrag die Bildung eines europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), welches mit Vollendung der Währungsunion die Geldpolitik für den gesamten Währungsraum festlegt und unter Führung der neu zu bildenden Europäischen Zentralbank (EZB) die dazu ihrer Ansicht nach erforderlichen geldpolitischen Operationen durchführt. Bis hierher ist bereits erkennbar, welch wichtige Stellung der Geldpolitik in einem einheitlichen europäischen Währungsraum zukommen soll, und so stellt sich die Frage, wie das ESZB diese Aufgabe erledigen soll, vor allem aber, welche Chancen und Risiken mit dieser einheitlichen Geldpolitik verbunden sind.
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll daher erst kurz auf die organisatorische Ausgestaltung des ESZB eingegangen und kurz die dem ESZB zur Verfügung stehenden Instrumente dargestellt werden, um anhand dessen die Chancen und Risiken der europäischen Geldpolitik aus verschiedenen Blickwinkeln zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Organisation des Eurosystems
- Das Instrumentarium
- Ziele des Instrumenteneinsatzes
- Die geldpolitische Strategie des Eurosystems
- Chancen und Risiken aus der Organisationsstruktur
- Die Autonomie des Eurosystems
- Transmissionsprozess und €-spezifische Risiken
- statistische Problemfelder und Folgeentwicklungen
- Abseits einer monoideiden Betrachtung
- Die Verfassungsbeschwerden gegen den EUV/EGV
- Feststellung der Zuständigkeit
- Das Urteil des BVerfG
- Kritik am Urteil
- Die Zweite Verfassungsbeschwerdewelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Chancen und Risiken einer einheitlichen europäischen Geldpolitik auf Stufe 3 im Kontext des EU-Vertrags. Sie untersucht die Organisationsstruktur des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), die zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumente und die geldpolitische Strategie des Eurosystems. Zudem beleuchtet sie die Autonomie des ESZB, den Transmissionsprozess der Geldpolitik und spezifische Risiken im Euro-Währungsraum. Die Arbeit geht auch auf statistische Problemfelder und Folgeentwicklungen sowie auf Verfassungsbeschwerden gegen den EU-Vertrag ein.
- Die Organisation des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB)
- Die Instrumente der europäischen Geldpolitik
- Die Chancen und Risiken einer einheitlichen europäischen Geldpolitik
- Die Autonomie des ESZB und die Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik
- Die Verfassungsrechtlichen Aspekte der europäischen Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und verdeutlicht die Bedeutung der europäischen Währungsunion in einem globalisierten Wirtschaftsraum. Das zweite Kapitel widmet sich der Organisation des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und seiner Aufgaben. Das dritte Kapitel beschreibt die geldpolitischen Instrumente des ESZB, während das vierte Kapitel die Ziele des Instrumenteneinsatzes beleuchtet. Das fünfte Kapitel diskutiert die geldpolitische Strategie des Eurosystems. Das sechste Kapitel analysiert Chancen und Risiken aus der Organisationsstruktur des ESZB. Das siebte Kapitel behandelt die Autonomie des ESZB und dessen Bedeutung für die Geldpolitik. Das achte Kapitel untersucht den Transmissionsprozess der Geldpolitik und spezifische Risiken im Euro-Währungsraum. Das neunte Kapitel beleuchtet statistische Problemfelder und Folgeentwicklungen. Das zehnte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob eine monoideiden Betrachtung der europäischen Geldpolitik gerechtfertigt ist. Das elfte Kapitel analysiert die Verfassungsbeschwerden gegen den EU-Vertrag und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Schlüsselwörter
Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Europäische Zentralbank (EZB), Geldpolitik, Währungsunion, Euro, EU-Vertrag, Maastricht-Vertrag, Preisstabilität, Wirtschaftspolitik, Transmissionsprozess, Verfassungsbeschwerden, Autonomie, Risiken, Chancen, statistische Problemfelder, Folgeentwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des ESZB?
Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) hat das vorrangige Ziel, die Preisstabilität im gesamten Euro-Währungsraum zu gewährleisten.
Welche Risiken birgt eine einheitliche europäische Geldpolitik?
Zu den Risiken gehören der Verlust nationaler Einflussmöglichkeiten auf die Wirtschaftspolitik, unterschiedliche Transmissionsprozesse in den Mitgliedstaaten und statistische Problemfelder.
Wie autonom ist die Europäische Zentralbank (EZB)?
Die EZB genießt eine hohe institutionelle Autonomie, um unabhängig von politischer Einflussnahme geldpolitische Entscheidungen treffen zu können.
Was wurde im Maastricht-Vertrag zur Währungsunion festgelegt?
Der Vertrag legte den dreistufigen Weg zur Einführung des Euro und die Gründung des ESZB sowie der EZB fest.
Gab es rechtliche Widerstände gegen den Euro in Deutschland?
Ja, die Arbeit thematisiert Verfassungsbeschwerden gegen den EU-Vertrag und das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Welche Instrumente stehen dem ESZB zur Verfügung?
Das ESZB nutzt verschiedene geldpolitische Instrumente wie Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserveanforderungen zur Steuerung der Geldmenge.
- Quote paper
- Alexander Frehse (Author), 2002, Die Risiken und Chancen einer einheitlichen europäischen Geldpolitik auf Stufe 3 unter Berücksichtigung der institutionellen Ausgestalltung durch den EU-Vertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33498