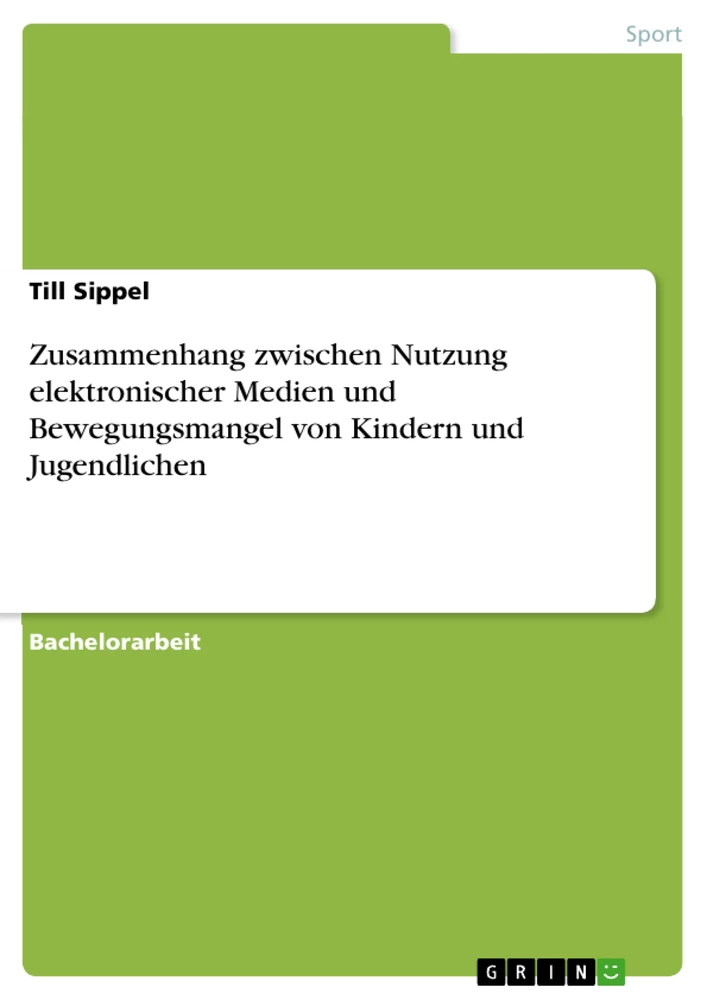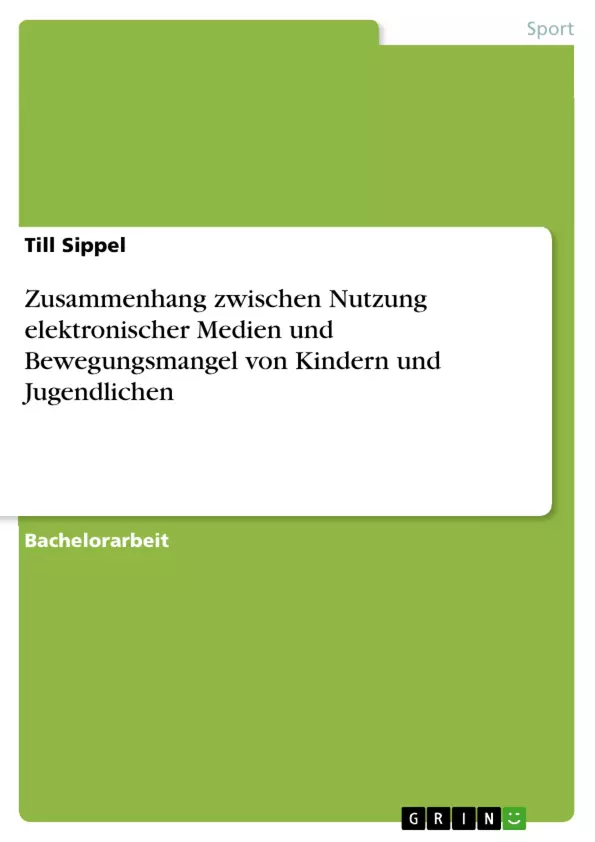Neben dem steigenden Massenkonsum und der Institutionalisierung der Freizeit, scheint eine Enttraditionalisierung des Alltags und das Verschwinden der Straßenspielkultur vonstatten zu gehen, die besonders die 1950er Jahre prägte. Doch ist es wirklich so, dass die Heranwachsenden sich in ihrer Freizeit weniger außerhalb des Hauses aufhalten? Sind sie körperlich inaktiver geworden und besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen diesem Bewegungsmangel und der Nutzung elektronischer Medien, die inzwischen in nahezu jedem Haushalt zu finden sind? Sprachen Charlton und Neumann-Braun bereits 1992 zu Recht von einer „Medienkindheit“, die sich in der „Medien-Jugend“ fortsetze?
Ein Blick in die Literatur zeigt, dass dieser Sachverhalt und die oben erwähnte Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Bewegungsmangel und der Nutzung neuer Medien schwieriger empirisch zu belegen sind, als es von vielen Autoren dargestellt wird. Ziel dieser Arbeit ist es also, auf der Grundlage ausgewählter Studien, wissenschaftlich fundierte Aussagen gesammelt darzustellen und auf die oben aufgeführte Fragestellung zu übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung und Bedeutung von Bewegung und körperlicher Aktivität
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Bedeutung
- 3. Veränderte Lebens- und Bewegungswelten
- 3.1 Gesellschaftliche Ebene
- 3.2 Familiäre und soziale Ebene
- 3.3 Spiel und Freizeitverhalten
- 3.3.1 Verhäuslichung der Freizeit
- 3.3.2 Verinselung der Freizeit
- 4. Bedingungen der Sportteilnahme
- 4.1 Biologische und demographische Faktoren
- 4.2 Soziale und ökonomische Faktoren
- 5. Auswirkungen von Bewegungsmangel
- 6. Vorstellung der Studien
- 6.1 MedikuS-Studie
- 6.2 KiGGS-Studie
- 6.3 KIM-Studie
- 6.4 JIM-Studie
- 7. Medien als Grund für Bewegungsmangel - Alternative oder Ergänzung?
- 7.1 Körperlich-sportliche Aktivität der KiJus
- 7.2 Mediennutzung der KiJus
- 7.3 Zusammenhang zwischen Mediennutzung und körperlich-sportlicher Aktivität
- 8. Ergebnisse und Fazit
- 9. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der Nutzung elektronischer Medien und dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Einflüsse von Medien auf das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zu untersuchen und die Frage zu klären, ob Medien eine Alternative oder Ergänzung zur körperlichen Aktivität darstellen.
- Veränderte Lebens- und Bewegungswelten von Kindern und Jugendlichen
- Bedingungen der Sportteilnahme und deren Einfluss auf die körperliche Aktivität
- Auswirkungen von Bewegungsmangel auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Mediennutzung und deren Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Bewegungsmangel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand einführt und die Relevanz des Themas beleuchtet. Anschließend werden die Begriffe "Bewegung" und "körperliche Aktivität" definiert und ihre Bedeutung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erläutert.
Kapitel 3 befasst sich mit den veränderten Lebens- und Bewegungswelten von Kindern und Jugendlichen und beleuchtet die gesellschaftlichen, familiären und sozialen Einflüsse auf das Bewegungsverhalten. Kapitel 4 analysiert die Bedingungen der Sportteilnahme und stellt die biologischen, demographischen, sozialen und ökonomischen Faktoren dar, die die sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen beeinflussen.
In Kapitel 5 werden die Auswirkungen von Bewegungsmangel auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dargestellt. Kapitel 6 stellt verschiedene Studien vor, die sich mit dem Thema Mediennutzung und Bewegungsmangel beschäftigen, darunter die MedikuS-Studie, die KiGGS-Studie, die KIM-Studie und die JIM-Studie.
Kapitel 7 analysiert die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und untersucht den Zusammenhang zwischen Mediennutzung und körperlich-sportlicher Aktivität. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit werden in Kapitel 8 zusammengefasst und in Kapitel 9 ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder gegeben.
Schlüsselwörter
Bewegungsmangel, körperliche Aktivität, Mediennutzung, Kinder, Jugendliche, Lebenswelt, Sportteilnahme, Gesundheit, MedikuS-Studie, KiGGS-Studie, KIM-Studie, JIM-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Bewegungsmangel?
Die Forschung zeigt, dass die Beziehung komplexer ist als oft angenommen. Während hoher Medienkonsum oft mit Inaktivität einhergeht, belegen Studien, dass Mediennutzung nicht zwangsläufig sportliche Aktivitäten ersetzt, sondern diese auch ergänzen kann.
Was bedeutet „Verhäuslichung der Freizeit“ bei Kindern?
Dieser Begriff beschreibt den Trend, dass Kinder ihre Freizeit immer häufiger innerhalb der eigenen Wohnung verbringen, anstatt draußen zu spielen. Elektronische Medien spielen dabei als Unterhaltungsquelle eine zentrale Rolle.
Welche gesundheitlichen Folgen hat Bewegungsmangel für Jugendliche?
Bewegungsmangel kann zu Übergewicht, Haltungsschäden, Herz-Kreislauf-Problemen und einer verringerten motorischen Leistungsfähigkeit führen. Auch psychische Auswirkungen wie eine geringere Stressresistenz sind möglich.
Welche Studien untersuchen das Bewegungsverhalten von Kindern in Deutschland?
Wichtige Daten liefern die KiGGS-Studie (Gesundheit), die KIM- und JIM-Studien (Mediennutzung) sowie die MedikuS-Studie, die den Zusammenhang zwischen Medien und körperlicher Aktivität analysieren.
Welche Faktoren beeinflussen die Sportteilnahme von Jugendlichen?
Neben persönlichen Interessen spielen biologische Faktoren (Alter, Geschlecht), soziale Einflüsse (Elternhaus, Freunde) und ökonomische Bedingungen (Kosten für Vereine) eine entscheidende Rolle.
Sind Medien eine Alternative oder eine Ergänzung zum Sport?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Mediennutzung oft als zeitliche Konkurrenz zum Sport wahrgenommen wird, aber auch als Informationsquelle für sportliche Aktivitäten dienen kann, was eine differenzierte Betrachtung erfordert.
- Quote paper
- Till Sippel (Author), 2015, Zusammenhang zwischen Nutzung elektronischer Medien und Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335052