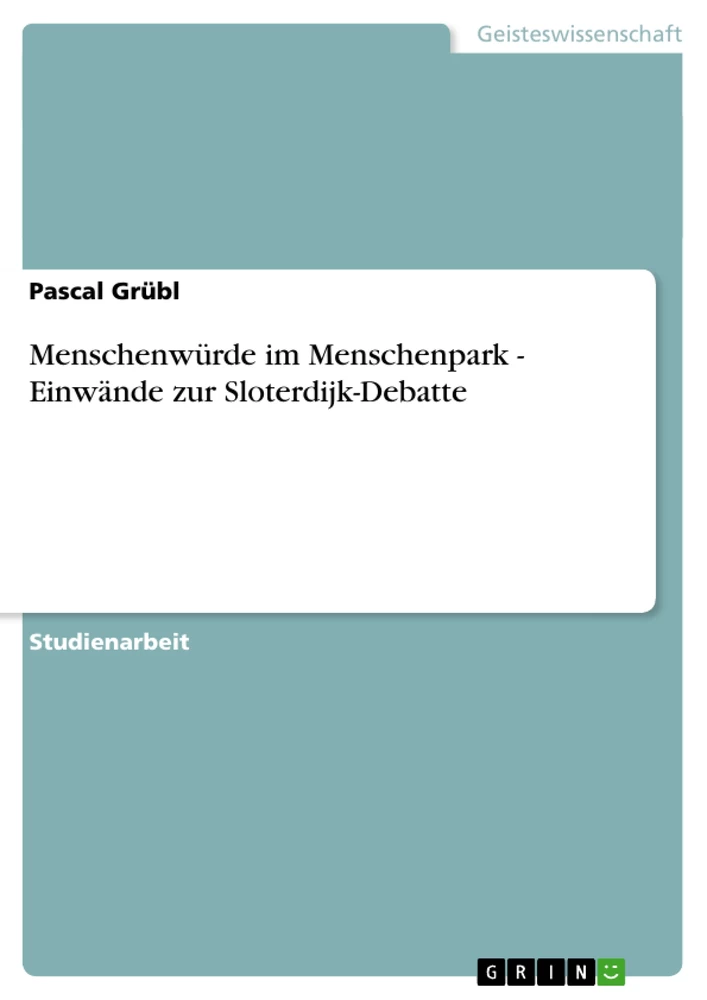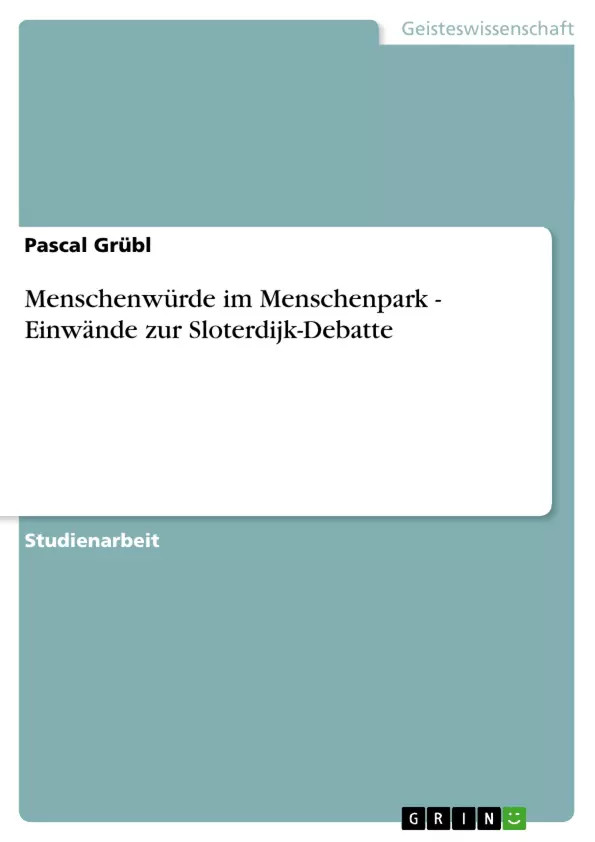„An/thro/po/tech/nik; die; - : Gebiet der Arbeitswissenschaft, auf dem man sich mit dem Problem befasst, Arbeitsvorgänge, - mittel u. – plätze den Eigenarten des menschlichen Organismus anzupassen.“ Der Duden war gerade mal neun Jahre alt und niemand dachte an eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, als Peter Sloterdijk im Juli 1999 mit der Forderung nach einem Kodex für Anthropotechniken für Furore sorgte. Es ging um das genaue Gegenteil. Die gentechnologische Anpassung des Menschen an seine Umwelt. Die gewendete Bedeutung des Wortes ist nur Ausdruck einer Bewegung der
fundamentalen Umkodierung von Menschenbildern, von Individualität und
Körperlichkeit. Die Humangenetik liefert die nötigen Stichwörter.
Ist von der Sloterdijk-Debatte die Rede, liest man oft, dass eigentlich zwei Themen verhandelt wurden, die vo neinander getrennt werden müssten – Genmanipulationen am Menschen einerseits und das Selbstverständnis einer Gesellschaft andererseits. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Stellungnahmen zur Gentechnologie und kommt dennoch zu einem anderen Ergebnis. Den Hauptteil bilden einzelne Textanalysen, in denen gezeigt wird, wie eng die beiden Themen miteinander verknüpft werden und es von ihrer Konzeption her auch sind. Daneben wird auf aufgeworfene Fragen, sofern sie für
Gentechnologiedebatten im Allgemeinen von Bedeutung sind, eingegangen. Für eine empirische Aussage über Tendenz und Wirkungsmacht des Diskurses zu Gentechnologie ist der Umfang der untersuchten Beiträge zu gering, weshalb ich mich mit Stellungnahmen zurückhalte. Die untersuchten Texte entstammen der Wochenzeitung
Die Zeit, in dem ein wesentlicher Teil der Sloterdijk-Debatte ausgetragen und der Stein des Anstoßes, Sloterdijks Regeln für den Menschenpark, veröffentlicht wurde. Damit lassen sich Aussagen zur Rolle der Zeit im gesellschaftlichen Diskurs treffen. Nach den
Betrachtungen der Artikel um Sloterdijks Rede folgt ein Ausblick in die Anfänge der Debatte um Gentechnologie, die bis heute andauert. Ausgangspunkt hier war ein im Januar 2001 im Tagesspiegel veröffentlichter Artikel von Julian Nida-Rümelin, der als
„Fremdbeitrag“ in die Betrachtung aufgenommen wird. Mit der abschließenden Analyse der Positionen Robert Spaemanns ist die Sloterdijk-Debatte um den theologischen Standpunkt ergänzt, ein Eindruck ihrer unmittelbaren Relevanz für und ein Einstieg in
den aktuellen Diskurs gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Regeln für den Menschenpark (Peter Sloterdijk)
- Eine transzendente Seinswahrheit
- Soziale Evolution
- Bioethik und Eugenetik
- Codex für Anthropotechniken
- Subjektive Seite der Selektion
- Die Sloterdijk-Debatte
- Das Zarathustra-Projekt (Thomas Assheuer)
- Die kritische Theorie ist tot (Peter Sloterdijk)
- Zwischenspiel
- Die falsche Angst Gott zu spielen (Ronald Dworkin)
- Die Guten ins Töpfchen (Jörg Albrecht)
- Es gibt keine Gene für die Moral (Ernst Tugendhat)
- Retrospektive
- Konkretisierung der Debatte
- Wo die Menschenwürde beginnt (Julian Nida-Rümelin)
- Gezeugt, nicht gemacht (Robert Spaemann)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Debatte um Peter Sloterdijks „Regeln für den Menschenpark“ und untersucht die Stellungnahmen zur Gentechnologie, die in diesem Kontext entstanden sind. Sie zeigt auf, wie eng die Themen Genmanipulation am Menschen und das Selbstverständnis einer Gesellschaft miteinander verknüpft sind. Darüber hinaus werden relevante Fragen aus der Gentechnologiedebatte im Allgemeinen betrachtet. Der Fokus liegt auf Textanalysen, die beleuchten, wie diese beiden Themen miteinander verflochten sind und welche Konzepte sie gemeinsam bedienen.
- Kritik am Humanismus als „Zähmungsinstanz“ und dessen Rolle in der Bildung von Nationen
- Die Bedeutung von Sprache und „Sein“ in Sloterdijks Philosophie
- Biotechnologische Implikationen von Zucht und Selektion
- Die Verbindung von Ethik und Genetik in der Anthropotechnik
- Die Frage nach der Rolle von Gentechnologie im gesellschaftlichen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung der Debatte um Gentechnologie und den anthropotechnischen Entwurf, den Peter Sloterdijk in seinen „Regeln für den Menschenpark“ präsentiert.
Regeln für den Menschenpark (Peter Sloterdijk)
Dieses Kapitel analysiert Sloterdijks „Regeln für den Menschenpark“ und untersucht die Kritik am traditionellen Humanismus, die Sloterdijk mit dem Konzept der Anthropotechnik verbindet. Es werden die zentralen Argumente Sloterdijks zur transzendenten Seinswahrheit, zur sozialen Evolution und zur Bedeutung von Bioethik und Eugenetik beleuchtet.
Die Sloterdijk-Debatte
In diesem Kapitel werden verschiedene Positionen zur Sloterdijk-Debatte vorgestellt. Die Texte von Thomas Assheuer, Ronald Dworkin, Jörg Albrecht und Ernst Tugendhat werden analysiert und ihre Kritik an Sloterdijks Thesen beleuchtet. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle von Gentechnologie in der Gesellschaft und die Frage nach der moralischen Verantwortung des Menschen gegenüber sich selbst und seinen Nachkommen erörtert.
Konkretisierung der Debatte
Das Kapitel fokussiert auf die Positionen von Julian Nida-Rümelin und Robert Spaemann in der Sloterdijk-Debatte. Es werden die Argumente von Nida-Rümelin zum Schutz der Menschenwürde und die theologische Perspektive von Spaemann auf die Frage nach der Gentechnologie und der Schöpfung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Gentechnologie, Anthropotechnik, Humanismus, Bioethik, Eugenetik, Soziales Selbstverständnis, Sprache und Sein sowie den philosophischen Perspektiven von Peter Sloterdijk, Martin Heidegger, Ronald Dworkin und Ernst Tugendhat. Der Diskurs um die Rolle von Gentechnologie im gesellschaftlichen Kontext sowie die Frage nach der moralischen Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen stehen im Vordergrund.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser der sogenannten Sloterdijk-Debatte?
Der Auslöser war Peter Sloterdijks Rede "Regeln für den Menschenpark" im Juli 1999, in der er einen Kodex für Anthropotechniken forderte.
Welche zentralen Themen werden in "Menschenwürde im Menschenpark" behandelt?
Die Arbeit verknüpft die Themen Genmanipulation am Menschen mit dem gesellschaftlichen Selbstverständnis, der Bioethik, Eugenetik und der Kritik am klassischen Humanismus.
Welche Philosophen und Autoren kommen in der Debattenanalyse zu Wort?
Analysiert werden Texte von Peter Sloterdijk, Thomas Assheuer, Ronald Dworkin, Ernst Tugendhat, Julian Nida-Rümelin und Robert Spaemann.
Was versteht Sloterdijk unter dem Begriff "Anthropotechnik"?
In diesem Kontext bezeichnet es die biotechnologische und gentechnologische Einwirkung auf den Menschen, was im Gegensatz zur klassischen humanistischen Bildung ("Zähmung") steht.
Welche Rolle spielt die Wochenzeitung "Die Zeit" in dieser Arbeit?
Die untersuchten Texte entstammen maßgeblich der "Zeit", da dort ein wesentlicher Teil der Debatte ausgetragen und Sloterdijks umstrittene Regeln erstveröffentlicht wurden.
Wie wird die theologische Perspektive in der Debatte vertreten?
Die Arbeit schließt mit einer Analyse der Positionen von Robert Spaemann ab, der den theologischen Standpunkt zur Gentechnologie und Schöpfung einbringt.
- Citar trabajo
- Pascal Grübl (Autor), 2002, Menschenwürde im Menschenpark - Einwände zur Sloterdijk-Debatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33511