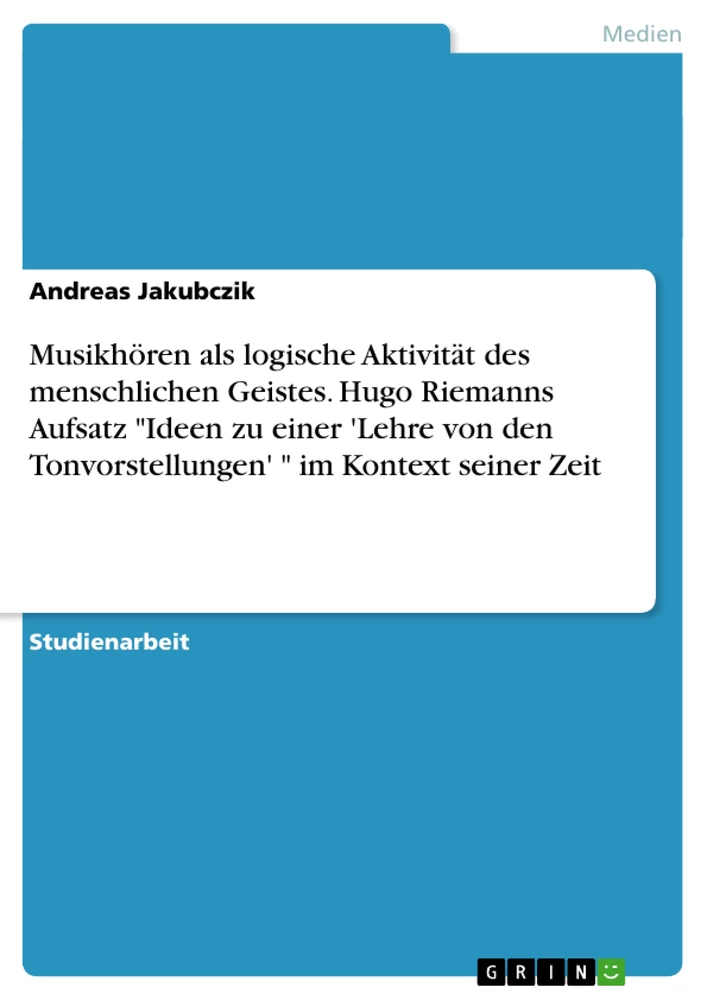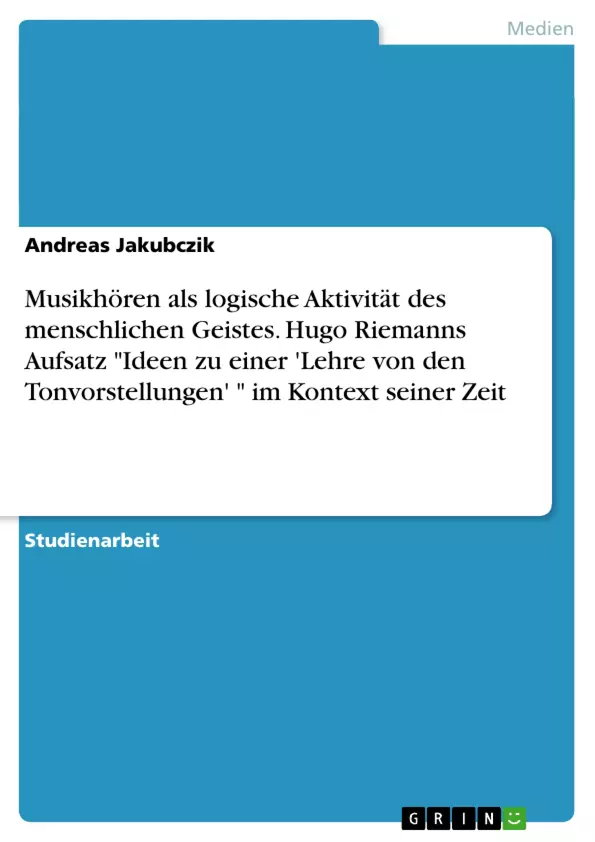Im Folgenden soll der Inhalt des oben genannten Aufsatzes wiedergegeben und besprochen werden. Aus sich selbst heraus ist er gar nicht so einfach verständlich. Dazu muss erst einmal Riemanns Terminologie geklärt, sowie der wissenschaftsgeschichtliche Problemzusammenhang herausgearbeitet werden, dem dieser Text zugehört. Außerdem muss etwas zu den zeitgenössischen Musiktheoretikern gesagt werden, auf die Riemann sich in seinem Aufsatz bezieht. Dies alles kann im Rahmen einer Seminararbeit wie der vorliegenden nur ansatzweise geschehen.
Zur Abkürzungs- und Zitierweise: Den im Zentrum meiner Ausführungen stehenden Aufsatz werde ich im folgenden mit „Ideen“ abkürzen. Bei allen Zitaten erfolgt die Quellenangabe direkt im Anschluss in Klammern; dabei verwende ich Siglen, die in der Literaturliste (unten, S.28 f.) den zugehörigen Literaturangaben zugeordnet sind. Für die „Ideen“ gilt hierbei die Abkürzung „Id“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der Problemzusammenhang – Riemanns These – Seine Zeitgenossen
- 1.2 Ziel und Vorgehensweise
- 2. Riemanns Modellansatz
- 2.1 Deduktive oder induktive Methode?
- 2.2 Tonvorstellung
- 2.3 Klangvertretung
- 2.3.1 Exkurs: Riemanns Herleitung der Durmolltonalität und des Konsonanzbegriffs
- 2.4 Ökonomie und Zentralisation: Riemanns Plädoyer für die gleichschwebende Temperatur
- 2.5 Anwendungsbeispiele
- 2.5.1 Das „Tonnetz der reinen Stimmung“
- 2.5.2 Wenn die Stimmführung entscheidet
- 2.6 Riemanns Stellung zur Frage, welche Bedeutung die Obertonreihe für das „musikalische Hören“ hat, und zur Verschmelzungstheorie von Stumpf
- 3. Fazit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Analyse von Hugo Riemanns Aufsatz „Ideen zu einer Lehre von den Tonvorstellungen“ aus dem Jahr 1914. Die Arbeit beleuchtet den wissenschaftsgeschichtlichen Kontext des Aufsatzes und untersucht Riemanns Kritik an den musiktheoretischen Ansätzen seiner Zeitgenossen, insbesondere an den Theorien von Helmholtz und Stumpf. Darüber hinaus wird Riemanns Modellansatz, der auf der Vorstellung der „Tonvorstellung“ basiert, im Detail untersucht. Die Arbeit strebt danach, ein tieferes Verständnis von Riemanns musiktheoretischen Konzepten und seiner Position innerhalb der musikwissenschaftlichen Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts zu ermöglichen.
- Riemanns Kritik an Helmholtz’ Theorie der „Tonempfindung“
- Riemanns Konzept der „Tonvorstellung“ im Vergleich zu Stumpf’s „Tonpsychologie“
- Riemanns Ansatz zur Herleitung der Durmolltonalität und des Konsonanzbegriffs
- Riemanns Plädoyer für die gleichschwebende Temperatur
- Riemanns Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Obertonreihe für das musikalische Hören
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt den Problemzusammenhang von Riemanns Aufsatz „Ideen“ vor und führt in die musikwissenschaftliche Diskussion des frühen 20. Jahrhunderts ein. Es beleuchtet Riemanns These, dass die „Tonvorstellung“ und nicht die „Tonempfindung“ den Kern der musikalischen Erfahrung darstellt. Dabei wird insbesondere auf die musiktheoretischen Beiträge von Helmholtz und Stumpf eingegangen. Kapitel 2 analysiert Riemanns Modellansatz im Detail. Es untersucht Riemanns Herleitung der Durmolltonalität und des Konsonanzbegriffs, sowie sein Plädoyer für die gleichschwebende Temperatur. Darüber hinaus werden Riemanns Ansichten zur Bedeutung der Obertonreihe und zur Verschmelzungstheorie von Stumpf betrachtet.
Schlüsselwörter
Tonvorstellung, Tonempfindung, musikalisches Hören, Helmholtz, Stumpf, Obertonreihe, Durmolltonalität, Konsonanz, gleichschwebende Temperatur, harmonischer Dualismus, Musiktheorie, Musikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hugo Riemanns Aufsatz von 1914?
Der Aufsatz „Ideen zu einer Lehre von den Tonvorstellungen“ behandelt die These, dass Musikhören eine logische Aktivität des Geistes ist, basierend auf Vorstellungen statt reiner Empfindung.
Was unterscheidet "Tonvorstellung" von "Tonempfindung"?
Riemann kritisiert Helmholtz’ Fokus auf die physikalische Empfindung und betont, dass der Kern der musikalischen Erfahrung im geistigen Modell der Tonvorstellung liegt.
Welche Rolle spielt die gleichschwebende Temperatur bei Riemann?
Riemann plädiert aus Gründen der Ökonomie und Zentralisation für die gleichschwebende Temperatur in der Musiktheorie.
Was ist Riemanns "harmonischer Dualismus"?
Die Arbeit untersucht Riemanns speziellen Ansatz zur Herleitung der Dur-Moll-Tonalität und seinen Konsonanzbegriff.
Gegen welche Zeitgenossen richtet sich Riemanns Kritik?
Riemann setzt sich kritisch mit den Theorien von Hermann von Helmholtz und Carl Stumpf (insbesondere dessen Verschmelzungstheorie) auseinander.
- Quote paper
- Andreas Jakubczik (Author), 2003, Musikhören als logische Aktivität des menschlichen Geistes. Hugo Riemanns Aufsatz "Ideen zu einer 'Lehre von den Tonvorstellungen' " im Kontext seiner Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33516