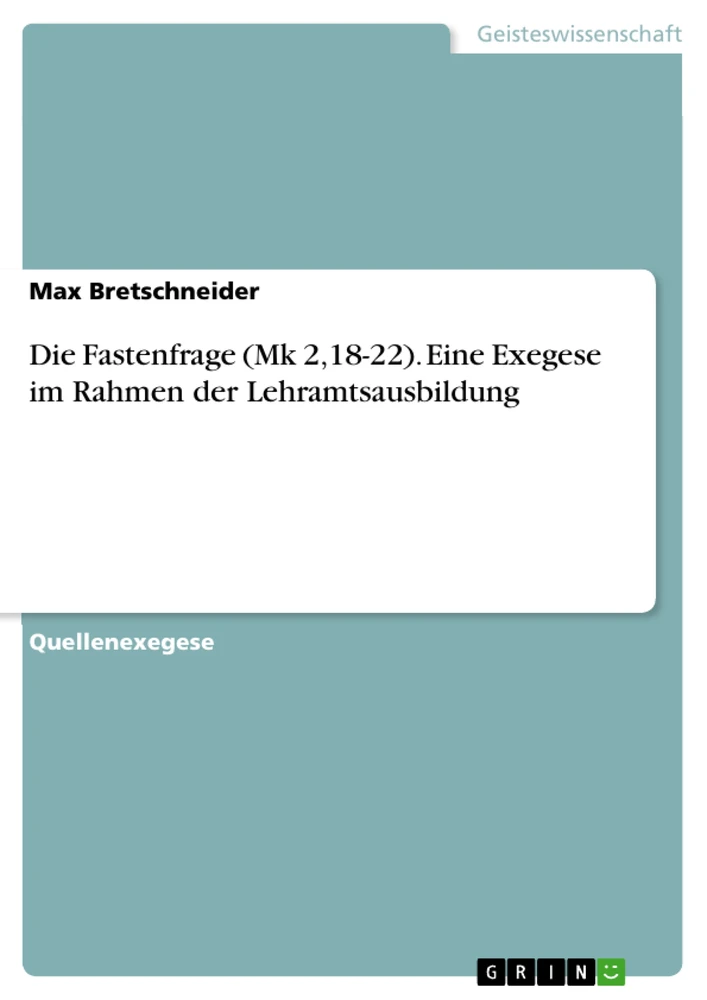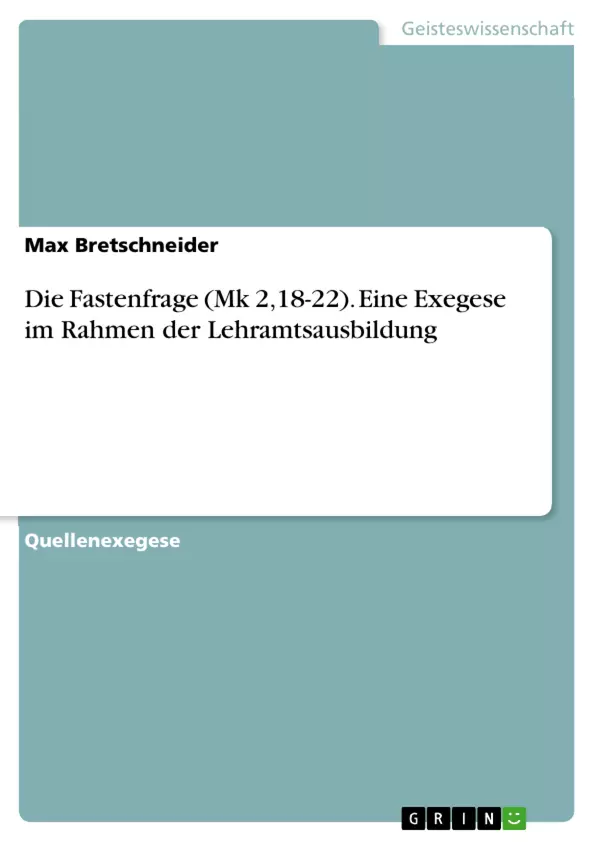Da das Markusevangelium als das älteste der vier Evangelien gilt, schafft es heutzutage eine bedeutende Quelle für Rückfragen der Historie Jesus. Demzufolge stehen die übrigen Evangelisten in direktem Bezug zu seinen „narrativen Verkündigungen“.
Markus-Johannes wird mehrfach in der Bibel erwähnt. So gilt er in der Apg 13,5 und 13 als Begleiter Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise. Mit Petrus selbst wird ihm eine enge Freundschaft nachgesagt, da er als sein Dolmetscher bei Predigten fungierte. Nur auf Wunsch der römischen Christen soll Markus sein Evangelium niedergeschrieben haben
Doch wer ist dieser Markus? Ist er wirklich der Verfasser des uns vorliegenden Evangeliums? Sein biblischer Bericht selbst liefert nur vage Angaben zu seiner Person und lässt viel Interpretationsspielraum. Dennoch gilt in der altkirchlichen Überlieferung Markus, der mit jüdischem Namen Johannes heißt, als Verfasser. Er stammt aus Jerusalem und das Haus seiner Mutter Maria war schon damals ein wichtiger Versammlungsort, in dem sich die führenden Persönlichkeiten der damaligen Urgemeinde trafen.
Eine sehr bekannte Perikope des Markusevangeliums beschäftigt sich mit der sog. „Fastenfrage“ – Markus 2,18-22. Hier wird nicht nur die Problematik des Fastens an sich erörtert, sondern auf einer anderen Ebene ebenfalls die vorherrschende Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern.
Diese exegetische Arbeit befasst sich mit jener Perikope aus dem Markusevangelium, wobei, unter dem Punkt Literarkritik, versucht wird, nicht nur auf formale und sprachliche Besonderheiten einzugehen, sondern gleichwohl die traditionelle und redaktionelle Entstehungsgeschichte auf den verschiedenen Stufen der Tradition darzulegen.
Es gilt demzufolge nachzuweisen, inwiefern ein Übersetzungsvergleich erste Indizien liefern kann, die in den folgenden Schritten – u.a. einer Überprüfung auf Einheitlichkeit und einem synoptischen Vergleich – ausgearbeitet werden. Desgleichen besteht Klärungsbedarf in der Begriffs-und Religionsgeschichte bezüglich Markus 2,18-22, wobei versucht wird die Problematik Jesu mit den Pharisäern darzulegen.
Als letzter exegetischer Schritt werden die verschiedenen Stufen der Tradition hervorgehoben und die reale Wirkungsgeschichte von Markus 2,18-22 und deren eigentlicher Stellenwert für die christliche Urgemeinde erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzungsvergleich
- Literarkritik
- Abgrenzung
- Abgrenzung nach oben
- Abgrenzung nach unten
- Stellung im Kontext
- Gliederung (Elberfelder)
- Synoptischer Vergleich
- Einheitlichkeit
- Abgrenzung
- Traditionsgeschichte/Formgeschichte
- Scheidung von Tradition und Redaktion
- Gattungsbestimmung
- Der Sitz im Leben
- Begriffs- und Religionsgeschichte
- Begriffsgeschichte
- Religionsgeschichtliche Analyse
- Der Sinn des Textes
- Der Sinn des Textes auf der ersten Stufe der Tradition (Verse 18,19ab)
- Der Sinn des Textes auf der zweiten Stufe der Tradition (Verse 18,19ab + 20)
- Der Sinn des Textes auf der dritten Stufe der Tradition (Verse 18,19ab + 20,19c)
- Der Sinn des Textes auf der „vierten“ Stufe der Tradition (markinische Redaktion)
- Wirkungsgeschichte und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese exegetische Arbeit befasst sich mit der Perikope Mk 2,18-22 aus dem Markusevangelium und untersucht, unter dem Punkt Literarkritik, die formale und sprachliche Besonderheiten sowie die traditionelle und redaktionelle Entstehungsgeschichte auf den verschiedenen Stufen der Tradition. Die Arbeit untersucht, inwiefern ein Übersetzungsvergleich erste Indizien liefern kann, die in den folgenden Schritten – u.a. einer Überprüfung auf Einheitlichkeit und einem synoptischen Vergleich – ausgearbeitet werden. Des Weiteren wird der Klärungsbedarf in der Begriffs- und Religionsgeschichte bezüglich Markus 2,18-22 beleuchtet, wobei versucht wird, die Problematik Jesu mit den Pharisäern darzulegen. Als letzter exegetischer Schritt werden die verschiedenen Stufen der Tradition hervorgehoben und die reale Wirkungsgeschichte von Markus 2,18-22 und deren eigentlicher Stellenwert für die christliche Urgemeinde erörtert.
- Die Fastenfrage im Markusevangelium und ihre Interpretation
- Die Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern
- Die Tradition und Redaktion von Markus 2,18-22
- Die Bedeutung des Textes für die christliche Urgemeinde
- Die Rolle des Fastens in der jüdischen und christlichen Religion
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Perikope Mk 2,18-22 im Kontext des Markusevangeliums vor und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Der Übersetzungsvergleich analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Elberfelder, Luther- und Gute-Nachricht-Bibelübersetzungen und liefert erste Hinweise auf die Interpretation der Perikope.
- Die Literarkritik untersucht die Abgrenzung der Perikope von den umliegenden Texten, ihre Stellung im Kontext des Markusevangeliums, die Gliederung, den synoptischen Vergleich und die Einheitlichkeit des Textes.
- Die Traditionsgeschichte/Formgeschichte betrachtet die Entstehung des Textes in verschiedenen traditionellen und redaktionellen Stufen, die Gattungsbestimmung als Streitgespräch und den Sitz im Leben der Perikope.
- Die Begriffs- und Religionsgeschichte analysiert die Bedeutung des Fastens im Alten Testament und im Neuen Testament, sowie die Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern.
- Der Sinn des Textes wird auf den verschiedenen Traditionsstufen untersucht und die Intentionen des Autors sowie die Interpretation des Textes werden erläutert.
- Die Wirkungsgeschichte und das Fazit diskutieren den Einfluss der Perikope auf die christliche Urgemeinde und bieten eine Interpretation des Textes im Kontext der heutigen Zeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Markusevangelium, Fasten, Pharisäer, Traditionsgeschichte, Redaktion, Übersetzungsvergleich, Synoptische Evangelien, Sitz im Leben, Begriffsgeschichte, Religionsgeschichte, Streitgespräch, Apophthegma, Messianische Heilszeit, Christliche Urgemeinde, Wirkungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Inhalt von Markus 2,18-22?
Diese Perikope behandelt die sogenannte „Fastenfrage“, in der die Praxis des Fastens und die daraus resultierenden Spannungen zwischen Jesus und den Pharisäern thematisiert werden.
Warum ist das Markusevangelium historisch so bedeutend?
Es gilt als das älteste der vier Evangelien und dient daher als primäre Quelle für die historische Rückfrage nach dem Leben und Wirken Jesu.
Wer war der Verfasser des Markusevangeliums?
Die altkirchliche Überlieferung nennt Markus (mit jüdischem Namen Johannes) aus Jerusalem als Verfasser, der als Dolmetscher des Petrus fungiert haben soll.
Was bedeutet „Sitz im Leben“ in der Exegese?
Der Begriff beschreibt den sozialen und religiösen Kontext, in dem ein biblischer Text innerhalb der christlichen Urgemeinde entstanden ist und verwendet wurde.
Wie wird die Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern erklärt?
Jesus bricht mit traditionellen jüdischen Fastenpraktiken und begründet dies mit der „messianischen Heilszeit“, was zu theologischen Konflikten mit den Pharisäern führt.
- Citar trabajo
- Max Bretschneider (Autor), 2013, Die Fastenfrage (Mk 2,18-22). Eine Exegese im Rahmen der Lehramtsausbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335223