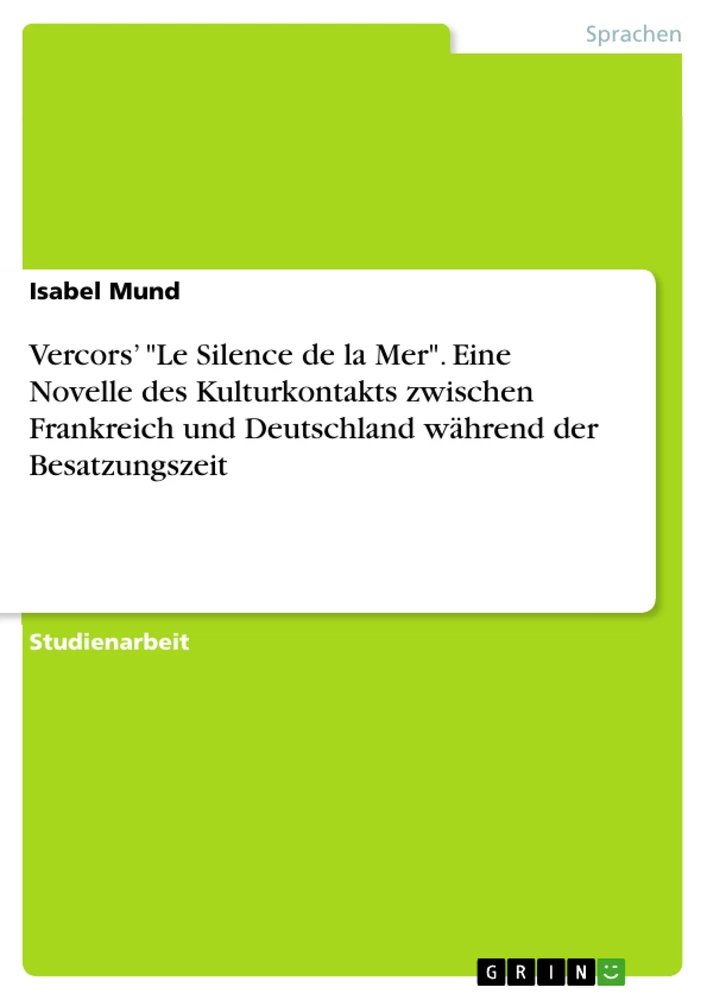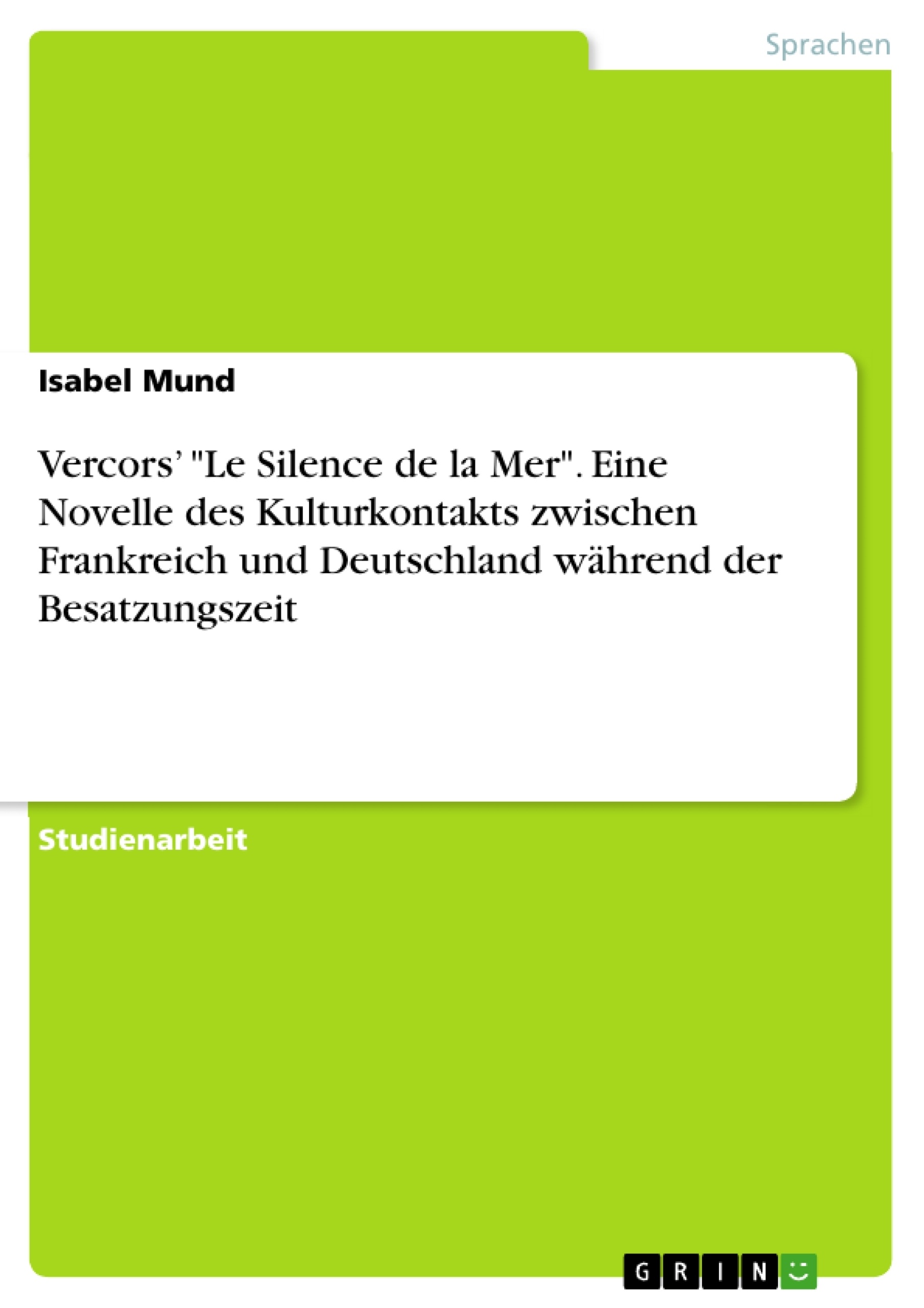Kein literarisches Werk der französischen Résistance-Bewegung ist so populär geworden wie Vercors’ „Le Silence de la Mer“. Aufgrund seiner Vieldeutigkeit und hohen Symbolkraft vereint es den Aufruf zum Widerstand gegen die dt. Besatzung mit literarischem Anspruch. Unabhängig davon spiegelt Vercors’ Werk das Lebensgefühl einer nicht traditionellen französischen Familie auf dem Land und ihren persönlichen Umgang mit der deutschen Besatzung wider. Durch eine authentische Darstellung der Protagonisten ermöglicht Vercors dem Leser eine Identifikation mit den Charakteren und erzielt daher einen hohen Grad an Authentizität.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht jedoch nicht allein die bereits vielfach durchgeführte, aber dennoch nicht vollständig abgeschlossene Analyse der Symbolkraft von Vercors’ Werk. Vielmehr wird der analytische Blick auf den Kulturkontakt, ein bisher in der Literaturwissenschaft selten untersuchtes Thema, gelenkt. Ausgangspunkt ist hierbei die Annahme, dass die in „Le Silence de la Mer“ vorkommenden Protagonisten, das heißt der französische Erzähler, seine mit ihm in einem Haus lebende Nichte und der bei ihnen einquartierte deutsche Offizier Werner von Ebrannac, ein fester Bestandteil ihrer jeweiligen Kulturen sind. Unter dieser Prämisse treten sie, im Rahmen der besonderen Besatzungssituation, in Kontakt mit Vertretern der jeweils anderen, während des Zweiten Weltkriegs sogar verfeindeten Kultur, wobei es zwangsläufig zu einem Kulturkontakt kommt.
Das Ziel des 2. Kapitels der vorliegenden Arbeit ist die Definition der für die folgende Analyse relevanten Fachbegriffe. Außerdem soll durch die Auseinandersetzung mit dem Phänomen ‚Kulturkontakt‘ ein Beitrag zu dessen genauerer Definierbarkeit geleistet werden. Im 3. Kapitel der Arbeit wird der Kulturkontakt in „Le Silence de la Mer“ unter Zuhilfenahme relevanter Sekundärliteratur analysiert. Hier wird unterschieden zwischen der Untersuchung der Voraussetzungen, unter denen der Kulturkontakt abläuft und der Analyse des eigentlichen kulturellen Kontakts sowie seiner Auswirkungen auf die Beteiligten. Abgerundet wird die vorliegende Arbeit durch eine Zusammenfassung der Analyseergebnisse und einen Ausblick auf weitere interessante Analyseansätze, die in dieser Arbeit unberücksichtigt bleiben mussten. Des Weiteren wird im letzten Kapitel dieser Arbeit darauf eingegangen, ob es sich tatsächlich um einen Kulturkontakt handelt und welche Wirkungen dieser auf die Protagonisten hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Die Novelle
- 2.2 Kultur, Stereotype, kulturelle Identität und Kulturkontakt
- 2.2.1 Kultur
- 2.2.2 Stereotype
- 2.2.3 Kulturelle Identität
- 2.2.4 Kulturkontakt
- 3. Analyse des Kulturkontakts und seiner Darstellung in Le Silence de la Mer
- 3.1 Die Voraussetzungen des Kulturkontakts in der Novelle
- 3.2 Der Beginn des Kulturkontakts und die Sicht der Kulturen aufeinander
- 3.3 Der Verlauf des Kulturkontakts und die Veränderungen im Verhältnis der Protagonisten
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Kulturkontakts in Vercors' Novelle Le Silence de la Mer während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt stehen die Begegnung und Interaktion der Protagonisten, die sich im Rahmen dieser besonderen Situation als Vertreter ihrer jeweiligen Kulturen begegnen.
- Die Novelle als literarische Form und ihre Besonderheiten
- Die Definition von Kultur, Stereotypen, kultureller Identität und Kulturkontakt
- Die Voraussetzungen und die Art des Kulturkontakts in Le Silence de la Mer
- Die Veränderungen im Verhältnis der Protagonisten im Laufe des Kulturkontakts
- Die Auswirkungen des Kulturkontakts auf die Protagonisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Novelle Le Silence de la Mer als ein wichtiges Werk der französischen Résistance-Bewegung vor und führt den Leser in die Thematik des Kulturkontakts ein. Die Arbeit fokussiert auf die Begegnung und Interaktion der Protagonisten, die als Vertreter ihrer jeweiligen Kulturen in Kontakt treten. Die Einleitung skizziert die Ziele der Arbeit und stellt die zentrale These vor, dass die Begegnung der Protagonisten als ein Kulturkontakt interpretiert werden kann.
2. Begriffsdefinitionen
Dieses Kapitel behandelt die Definitionen relevanter Fachbegriffe. Zunächst wird die Novelle als literarische Form beleuchtet, gefolgt von einer Analyse der Begriffe Kultur, Stereotypen, kulturelle Identität und Kulturkontakt. Diese Begriffe werden im Kontext des Kulturkontakts betrachtet und auf ihre Relevanz für die Analyse von Le Silence de la Mer untersucht.
3. Analyse des Kulturkontakts und seiner Darstellung in Le Silence de la Mer
Dieses Kapitel untersucht den Kulturkontakt in Vercors' Novelle. Es wird zunächst die Situation und die Voraussetzungen des Kulturkontakts in der Novelle beleuchtet. Anschließend wird die Begegnung der Protagonisten, insbesondere der Beginn des Kulturkontakts und die Sicht der Kulturen aufeinander, genauer analysiert. Der Fokus liegt auf den Veränderungen im Verhältnis der Protagonisten im Laufe des Kulturkontakts und auf den Auswirkungen des Kulturkontakts auf die Beteiligten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind der Kulturkontakt, die Novelle, Frankreich, Deutschland, Résistance, Stereotype, kulturelle Identität und die deutsche Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Kulturkontakts in Vercors' Le Silence de la Mer und analysiert die Auswirkungen dieser Begegnung auf die Protagonisten.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt die Novelle "Le Silence de la Mer"?
Sie beschreibt die Begegnung einer französischen Familie mit einem deutschen Offizier während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg und deren symbolisches Schweigen als Widerstand.
Was ist das Hauptthema dieser literaturwissenschaftlichen Analyse?
Im Fokus steht der "Kulturkontakt" zwischen den französischen Gastgebern und dem deutschen Offizier Werner von Ebrannac als Vertreter ihrer jeweiligen Kulturen.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Novelle?
Stereotype prägen die anfängliche Sicht der Protagonisten aufeinander und werden im Verlauf des Kulturkontakts durch die persönliche Interaktion herausgefordert.
Warum ist das Werk für die Résistance so bedeutend?
Es gilt als Aufruf zum geistigen Widerstand gegen die Besatzer und vereint literarischen Anspruch mit einer authentischen Darstellung des Lebensgefühls jener Zeit.
Wie verändert sich das Verhältnis der Protagonisten?
Trotz des Schweigens entwickelt sich eine komplexe Dynamik, die die Auswirkungen des kulturellen Kontakts auf die Identität der Beteiligten verdeutlicht.
- Arbeit zitieren
- Isabel Mund (Autor:in), 2013, Vercors’ "Le Silence de la Mer". Eine Novelle des Kulturkontakts zwischen Frankreich und Deutschland während der Besatzungszeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335226