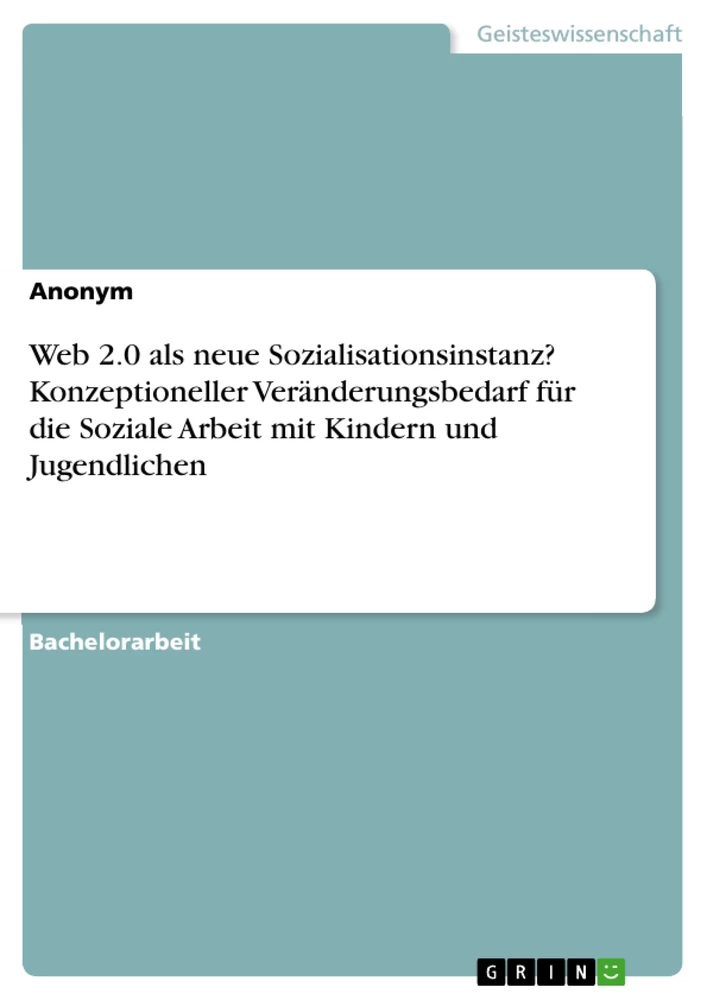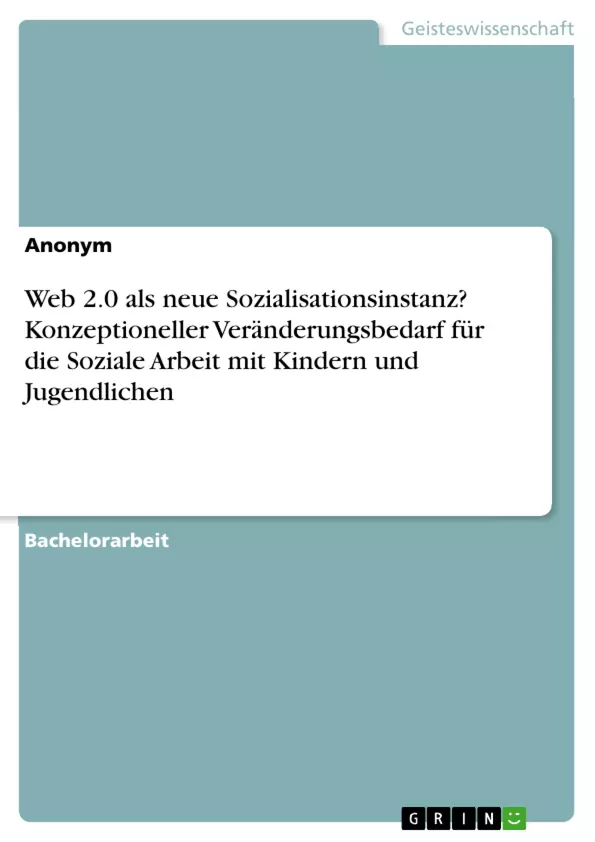Im Rahmen der Arbeit wurde eine qualitative Forschung mit insgesamt drei Interviews durchgeführt und ausgewertet.
Junge Menschen, welche in die heutige Welt hineingeboren werden, können für die Erkundung dieser für sie neuen Welt auf ein breites Spektrum an “neuen Werkzeugen“ digitaler Natur zurückgreifen, anhand derer sie sich ein Meinungsbild konstruieren und ihre Lebenswelt erkunden können. Eines dieser technischen Fortschritte hat sich in besonderem Maß in den Alltag unserer Gesellschaft integriert und in der Tagesstruktur vieler Menschen etabliert.
Das Web 2.0: Ein Schlagwort für eine Plattform, unter der eine Vielzahl kollaborativer und interaktiver Elemente des Internets subsumiert werden können. Das für den Begriff Web 2.0 kennzeichnende Merkmal der aktiven Mitgestaltung im Internet hat sich längst in der breiten Masse der Gesellschaft verselbstständigt. Die vielen wissenschaftlichen Diskurse und Studien der letzten Jahre sind Beleg für die schlagartige und flächendeckende Verbreitung des Internets als signifikantes Informations- und Kommunikationsmedium. Diese Entwicklung des Internets hat eine grundlegende Veränderung des Kommunikationsverhaltens und der Mediennutzung impliziert. Die zunehmend exponierte Stellung dieses weltweiten Verbundes von Rechnernetzwerken und die Diskussion um die Risiken einer solchen Entwicklung hat in Fachkreisen eine Debatte mit differenten Meinungen angestoßen. Durch die Welt der neuen Medien wird unsere Gesellschaftsstruktur verändert...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sozialisation in der Jugendphase
- 2.1 Sozialisation - Eine erste Annäherung
- 2.2 Jugend - Eine Begriffserklärung
- 2.3 Geschlechtsspezifische Sozialisation
- 2.4 Vergleiche der wichtigsten Sozialisationsinstanzen im Jugendalter
- 3. Herkunft und Bedeutung des Begriffes Web 2.0
- 3.1 Mediennutzung im digitalen Zeitalter (Rückblick/Zukunft)
- 3.2 Relevanz des Web 2.0 für Kinder und Jugendliche
- 3.3 Medienkompetenz - Kinder und ihr Umgang mit Medien
- 3.4 Wandel des Netzes und seiner Optionen
- 4. Digitale Ungleichheit - Soziale Unterschiede in der Mediennutzung
- 4.1 Medien als Orte informellen Lernens
- 4.2 Jugendalter - die Suche nach der Identität
- 4.3 Web 2.0 als Gradmesser der sozialen Partizipation
- 4.4 Neue gesellschaftliche Herausforderungen des Aufwachsens
- 4.5 Potentiale und Risiken für Einrichtungen der Sozialen Arbeit
- 5. Wahrnehmung der Medien durch Kinder und Jugendliche
- 5.1 Entwicklungspsychologische Phasen der Kindheit
- 5.2 Geschlechtsspezifische Medienwahrnehmung von Jungen und Mädchen
- 5.3 Wirkung von Medien am Beispiel Gewalt (oder Mobbing)
- 5.4 Cyber-Mobbing als eine neue Form der virtuellen Diffamierung
- 6. Sozialpädagogische Herausforderungen neuer Medien
- 6.1 Rollenverständnis für Fachkräfte der Sozialen Arbeit
- 6.2 Kinderschutz im Zeitalter des Web 2.0
- 6.3 Jugendarbeit 2.0?
- 6.4 Neue Dimensionen der Medienkompetenz im Web 2.0?
- 6.5 Web 2.0 als Lebensraum und Sozialisationsinstanz für Kinder und Jugendliche?
- 7. Auswertung der qualitativen Forschung
- 7.1 Forschungsstand
- 7.2 Qualitativer Forschungsprozess
- 7.2.1 Beschreibung der Forschungsmethode (Dokumentarische Methode)
- 7.2.2 Auswahl und Festlegung der Stichprobe
- 7.2.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews
- 7.3 Reflexion des Forschungsprozesses
- 7.4 Ergebnisse
- 7.4.1 Fallrekonstruktion Frau Bauer
- 7.4.2 Fallrekonstruktion Frau Schmitt
- 7.4.3 Fallrekonstruktion Herr Müller
- 7.5 Sinngenetische Typenbildung
- 7.6 Soziogenetische Typenbildung
- 7.7 Zusammenfassung der Ergebnisse sowie Verknüpfung zur Fragestellung und zur theoretischen Grundlage
- 7.8 Bedeutung der Ergebnisse für die Soziale Arbeit
- 8. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das Web 2.0 als eigenständige Sozialisationsinstanz für Kinder und Jugendliche fungiert und ob die Soziale Arbeit konzeptionelle Anpassungen in Bezug auf die Entwicklung des Internets vornehmen muss. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Web 2.0 auf die Sozialisationsprozesse von Kindern und Jugendlichen und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich für die Soziale Arbeit aus dieser Entwicklung ergeben.
- Sozialisationsprozesse im Kontext des Web 2.0
- Digitale Ungleichheit und die Suche nach Identität im Jugendalter
- Medienkompetenz und die Herausforderungen des Web 2.0 für Kinder und Jugendliche
- Neue Formen der Kommunikation und Interaktion im Web 2.0
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz des Web 2.0 für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen dar. Kapitel zwei beleuchtet die Bedeutung von Sozialisation und Jugend und analysiert die Rolle verschiedener Sozialisationsinstanzen. Kapitel drei untersucht die Entstehung und Bedeutung des Web 2.0 und beleuchtet die Auswirkungen des Internets auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Kapitel vier befasst sich mit der digitalen Ungleichheit und den Herausforderungen, die die Suche nach Identität im Jugendalter im digitalen Zeitalter mit sich bringt. Kapitel fünf untersucht die Wahrnehmung von Medien durch Kinder und Jugendliche und widmet sich insbesondere dem Thema Gewalt im Netz. Kapitel sechs beleuchtet die sozialpädagogischen Herausforderungen neuer Medien und thematisiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext des Web 2.0. Kapitel sieben präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Forschung und analysiert die Auswirkungen des Web 2.0 auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Abschließend wird ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
Schlüsselwörter
Web 2.0, Sozialisation, Kinder, Jugendliche, Digitale Ungleichheit, Medienkompetenz, Soziale Arbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Qualitative Forschung, Lebensweltorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Web 2.0 eine neue Sozialisationsinstanz?
Die Arbeit untersucht, ob das Internet durch seine interaktiven Möglichkeiten neben Familie und Schule als eigenständiger Raum fungiert, in dem Identität und Werte gebildet werden.
Was bedeutet "Digitale Ungleichheit" für Jugendliche?
Es beschreibt die sozialen Unterschiede in der Mediennutzung und den Zugang zu digitalen Ressourcen, was die soziale Partizipation und Bildungschancen beeinflussen kann.
Welche Risiken birgt das Web 2.0 für Kinder?
Zu den Risiken zählen Cyber-Mobbing, der Kontakt mit Gewaltinhalten und die Gefährdung des Kinderschutzes in virtuellen Räumen.
Wie muss sich die Soziale Arbeit anpassen?
Fachkräfte benötigen neue Medienkompetenzen und müssen Konzepte wie die "Jugendarbeit 2.0" entwickeln, um Jugendliche in ihrer digitalen Lebenswelt zu erreichen.
Was ist das Ziel der qualitativen Forschung in dieser Arbeit?
Durch Interviews mit Fachkräften (Fallrekonstruktionen) wird ermittelt, wie die Soziale Arbeit den Einfluss des Web 2.0 in der Praxis wahrnimmt und darauf reagiert.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Web 2.0 als neue Sozialisationsinstanz? Konzeptioneller Veränderungsbedarf für die Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335281