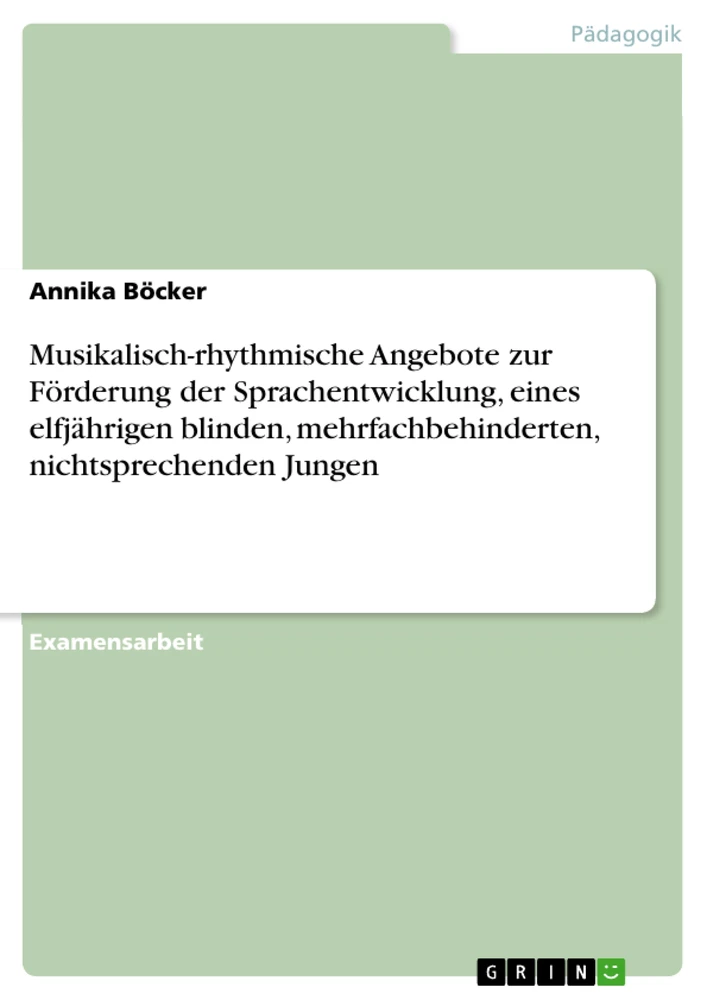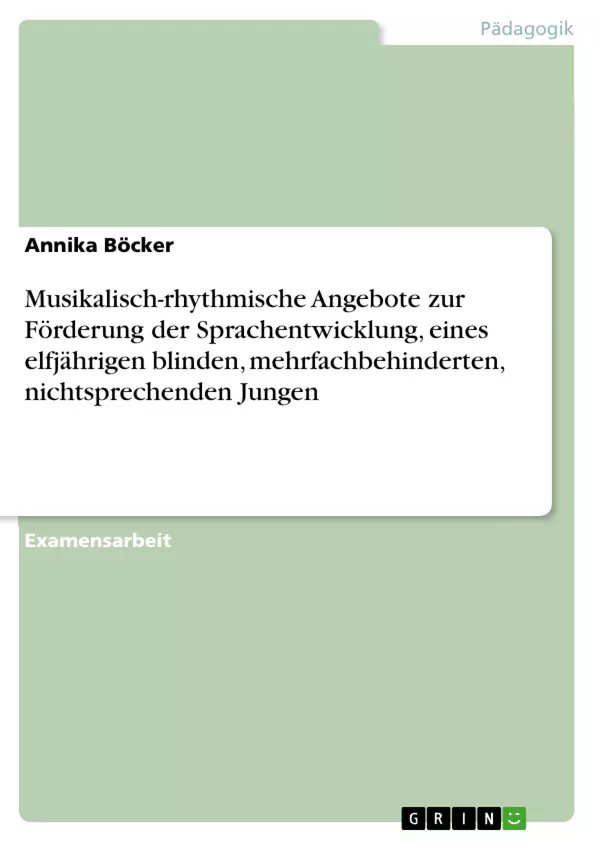Die vorliegende Abschlussarbeit entstand im Rahmen eines einjährigen Schwerpunktpraktikums innerhalb der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin in X..
Bei diesem Praktikum arbeitete ich im Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte mit sehgeschädigten Kindern, die sich auf Grund von Mehrfachbehinderungen gar nicht, oder kaum sprachlich ausdrücken können und eine gestörte Sprachentwicklung aufweisen.
Ein elfjähriger Junge, den ich als Fallbeispiel ausgewählt habe, ist eines von vier Kindern innerhalb der Klasse, in der ich als Praktikantin tätig war. Als ich den Jungen kennenlernte, konnte er ein paar einzelne Wörter sprachlich äußern und begann langsam ein Interesse an Sprache zu zeigen. Ich hatte dabei den Eindruck, dass man dieses aufkeimende Interesse nutzen müsse, um seine kommunikativen Fähigkeiten zu stärken und weiter auszubauen.
Da sowohl mein eigenes Interesse als auch der Schwerpunkt meiner pädagogischen Arbeit auf dem Bereich der Musik liegt, und der Junge ein sehr großes Interesse an musikalischen und rhythmischen Angeboten zeigt, habe ich mir die Frage gestellt, inwieweit sich Musik mit der Förderung der Sprachentwicklung kombinieren lässt. Daraus ergab sich für mich die Forschungsfrage, der ich mich in dieser Arbeit widme:
Können musikalisch-rhythmische Angebote die Entwicklung der Sprache fördern?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- SITUATIONSANALYSE - ZIELGRUPPE
- Beschreibung der Einrichtung
- Deskription des Personenkreises
- Mehrfachbehinderung
- Blindheit und Sehschädigung
- Nichtsprechende Menschen
- Auswirkungen auf die menschliche Entwicklung
- Fallbeispiel des Jungen K.
- Fallbeschreibung
- GRUNDLAGEN - THEORIEN
- Was ist Kommunikation?
- Sprache als Kommunikationsmittel
- Früher Spracherwerb bei normal entwickelten Kindern
- Bezüge zwischen Sprache und Musik
- Gemeinsame Merkmale
- Singen als Ausgangssprache der Menschheit
- Vorsprachliche und vormusikalische Kommunikationsformen
- Artikulationsorgan: Stimme
- Parallelen im Gehirn – Verarbeitung von Sprache und Musik
- Was Musik als Medium zur Förderung der Sprachkompetenz auszeichnet
- Kinderlied und Kindervers – Das verbindende Element
- METHODISCH-DIDAKTISCHE UMSETZUNG - REFLEXION
- Ziele der Angebote
- Methodisch-didaktisches Vorgehen
- Handlungssituationen
- Reflexion
- Entwicklungsbeschreibung und Ergebnisse der Förderung
- SCHLUSSFOLGERUNGEN
- Zusammenfassung
- Eigener Lernfortschritt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Förderung der Sprachentwicklung bei sehgeschädigten Kindern mit Mehrfachbehinderungen, die Schwierigkeiten im sprachlichen Ausdruck haben. Sie analysiert die besondere Situation dieser Zielgruppe und beleuchtet die Bedeutung von Sprache für die menschliche Entwicklung. Die Arbeit untersucht die Verbindung von Sprache und Musik und deren Nutzen für die Sprachförderung, wobei der Schwerpunkt auf Kinderliedern und -versen liegt.
- Herausforderungen in der Sprachentwicklung sehgeschädigter Kinder mit Mehrfachbehinderungen
- Die Bedeutung von Musik und Sprache als Kommunikationsmittel
- Gemeinsamkeiten und Verbindungen zwischen Sprache und Musik
- Die Einsatzmöglichkeiten von Musik in der Sprachförderung
- Die Rolle von Kinderliedern und -versen in der sprachlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Situationsanalyse der Einrichtung und der Zielgruppe. Es werden die Besonderheiten des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte und die Herausforderungen der Mehrfachbehinderung beleuchtet. Im Fokus steht das Fallbeispiel des Jungen K., ein sehgeschädigter, nichtsprechender Junge mit allgemeiner Entwicklungsverzögerung.
Kapitel 3 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Sprachentwicklung und den Verbindungen zu Musik. Es werden die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die menschliche Entwicklung, der normale Spracherwerb bei Kindern und die Gemeinsamkeiten zwischen Sprache und Musik beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf den musikalischen Elementen in der sprachlichen Entwicklung und der Verarbeitung von Sprache und Musik im Gehirn.
Das vierte Kapitel widmet sich der methodischen und didaktischen Umsetzung von musikalisch-rhythmischen Angeboten für den Jungen K. Es werden die Ziele der Angebote, die methodische Vorgehensweise und ausgewählte Handlungssituationen beschrieben. Im Zentrum steht die Reflexion der Erfahrungen und die Beschreibung der Ergebnisse der Sprachförderung.
Im fünften Kapitel werden die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammengefasst und die eigenen Lernerfahrungen der Autorin reflektiert. Es wird ein Fazit gezogen, das die Bedeutung von Musik für die Sprachförderung sehgeschädigter Kinder mit Mehrfachbehinderungen hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sprachentwicklung, Mehrfachbehinderung, Sehschädigung, nichtsprechende Menschen, Musik, Kinderlieder, Kinderverse, Sprachförderung, Kommunikation, Körperwahrnehmung, Selbstbild, neuronale Vernetzung und Ko-Konstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Können musikalische Angebote die Sprachentwicklung fördern?
Ja, musikalisch-rhythmische Angebote können die Sprachentwicklung unterstützen, da Musik und Sprache ähnliche neuronale Verarbeitungsmuster und Merkmale wie Rhythmus und Melodie teilen.
Warum ist Musik für blinde Kinder besonders wichtig?
Für blinde Kinder ist das Gehör ein primärer Kanal zur Welt. Musik bietet ihnen eine strukturierte akustische Orientierung und fördert die Kommunikationsbereitschaft.
Welche Rolle spielen Kinderlieder bei der Sprachförderung?
Kinderlieder verknüpfen Worte mit Melodien und Rhythmen, was das Einprägen von Lauten und Wörtern erleichtert und die Artikulation spielerisch trainiert.
Was versteht man unter "nichtsprechenden Menschen"?
Dies sind Personen, die aufgrund von Behinderungen keine Lautsprache zur Kommunikation nutzen können, aber oft über alternative Wege (wie Musik oder Gestik) erreichbar sind.
Wie hängen Körperwahrnehmung und Musik zusammen?
Rhythmische Angebote fördern die Körperwahrnehmung durch Vibrationen und Bewegung, was wiederum die Basis für die Entwicklung eines Selbstbildes und die Kommunikation ist.
- Citar trabajo
- Annika Böcker (Autor), 2015, Musikalisch-rhythmische Angebote zur Förderung der Sprachentwicklung, eines elfjährigen blinden, mehrfachbehinderten, nichtsprechenden Jungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335377