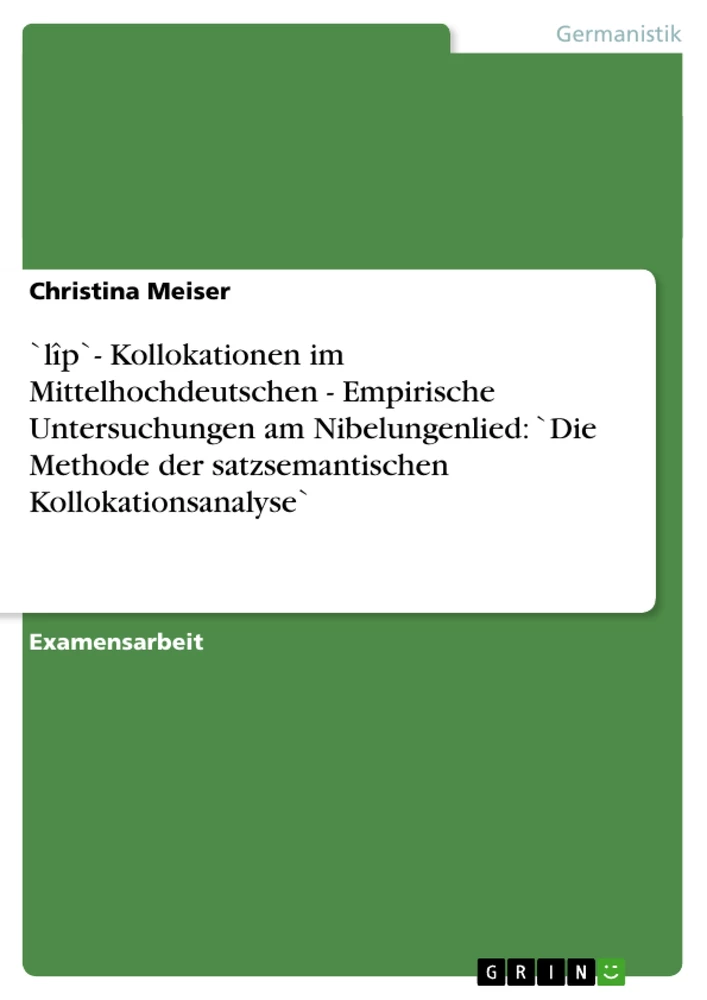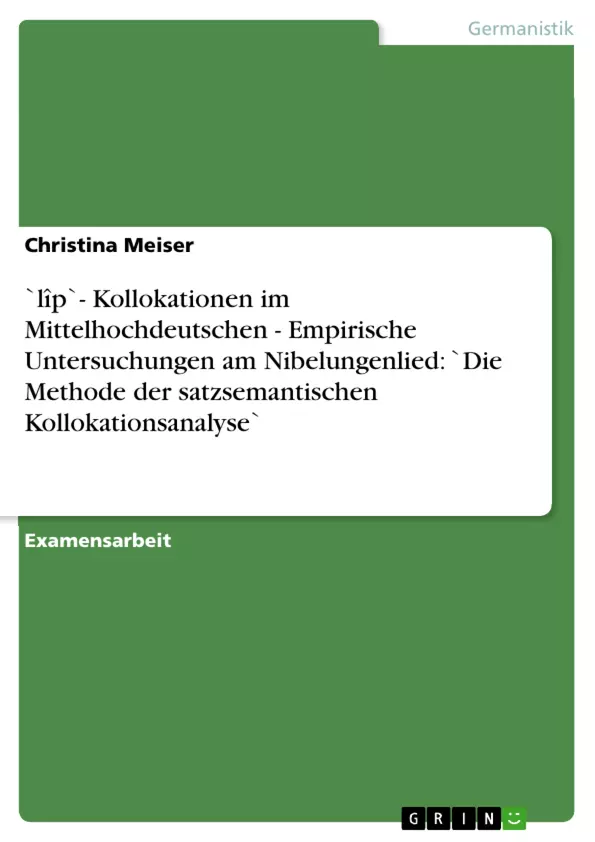„Uns ist in alten mæren / wunders vil geseit
von helden lobebæren / von grôzer arebeit,
von fröuden, hôchgezîten, / von weinen und von klagen,
von küener recken strîten / muget ir nu wunder hœren sagen.“ 1
Mit diesen Versen beginnt das Nibelungenlied, das bedeutendste mittelhochdeutsche Heldenepos. Es besteht aus zwei Teilen, wobei im ersten Teil Siegfrieds Tod im Mittelpunkt steht und im zweiten die Rache seiner Gattin Kriemhild. Der genaue Inhalt des Nibelungenliedes wird im ersten Kapitel dieser Arbeit beschrieben. In der deutschen Sage bezeichnen die Nibelungen die Nebelmänner , das sind die Mannen des Nibelung, des dämonischen Besitzers des Nibelungenhortes. Diesen Schatz behütet der mächtige Zwerg Alberich, ein Geist der Finsternis, den Siegried besiegt. Nach der Eroberung des Schatzes wird der Name Nibelungen auf die Burgunder übertragen, nur Siegfried, der Besitzer des Hortes, wird nie „Nibelung“ genannt.
Das Nibelungenlied wurde uns anonym überliefert und entstand wahrscheinlich um 1200, vermutlich im Umkreis des Bischofs Wolfger in Passau an der Donau. Die genaue Entstehungsgeschichte, Angaben über die Handschriften des Nibelungenliedes, sowie Vermutungen über seinen Verfasser finden wir ebenfalls im ersten Kapitel dieser Arbeit. Das Nibelungenlied besteht aus 39 Aventiuren und ist in etwa 2400 Strophen, vier paarweise reimenden Langzeilen, abgefasst.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, dem Nibelungenlied, während das zweite Kapitel den theoretischen Teil behandelt. Das Thema dieser Arbeit lautet „`lîp`- Kollokationen im Mittelhochdeutschen. Empirische Untersuchungen am Nibelungenlied: `Die Methode der satzsemantischen Kollokationsanalyse`“. Daher beginnt das zweite Kapitel zuerst mit einer Einführung in die Valenztheorie, wobei in dem Unterkapitel „Verben und ihre Mitspieler“ unter anderem die Entstehung des Valenzbegriffs oder auch die Bindung der Mitspieler an das Verb erklärt werden soll. Das nächste Unterkapitel behandelt die drei unterschiedlichen Typen von Valenzrahmen, die jeweils mit Beispielen des Nibelungenliedes erläutert werden und unter „Die Binnenstruktur von Valenzrahmen“ finden wir unter anderem Methoden zur Ermittlung des syntaktischen Minimums.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung ins Thema
- Kapitel 1: Das Nibelungenlied
- 1.1 Inhalt
- 1.2 Entstehung
- 1.3 Handschriften
- 1.4 Autor
- Kapitel 2: Theoretischer Teil
- 2.1 Einführung in die Valenztheorie
- 2.1.1 Verben und ihre Mitspieler
- 2.1.2 Typen von Valenzrahmen
- 2.1.3 Die Binnenstruktur von Valenzrahmen
- 2.2 Die Methode der satzsemantischen Kollokationsanalyse
- 2.2.1 Kollokationsauswertung nach Bergenholtz
- 2.2.2 Satzsemantische Funktionen der Bezugsstellen
- 2.2.3 Zusätze zum untersuchten Lexem
- 2.1 Einführung in die Valenztheorie
- Kapitel 3: Der Begriff „Lip“
- 3.1 Lesarten von „Lîp“
- 3.2 Untersuchung zu Phraseologismusverdacht
- Kapitel 4: Katalog
- 4.1 Aufbau des Katalogs
- 4.1.1 Fundort
- 4.1.2 Mittelhochdeutsche Textstelle
- 4.1.3 Übersetzung
- 4.1.4 Linguistische Analyse
- 4.1.5 Übersetzung von „lîp“
- 4.1.6 Kommentar
- 4.2 Katalog
- 4.1 Aufbau des Katalogs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kollokationen des mittelhochdeutschen Wortes „lîp“ im Nibelungenlied. Ziel ist es, mithilfe der satzsemantischen Kollokationsanalyse die verschiedenen Bedeutungsfacetten und Verwendungskontexte von „lîp“ aufzuzeigen und zu analysieren. Die Arbeit verbindet empirische Textanalyse mit theoretischen Grundlagen der Valenztheorie.
- Analyse der Kollokationen von „lîp“ im Nibelungenlied
- Anwendung der satzsemantischen Kollokationsanalyse
- Erläuterung der Valenztheorie und ihrer Relevanz für die Analyse
- Untersuchung verschiedener Lesarten von „lîp“
- Erstellung eines detaillierten Katalogs der „lîp“-Kollokationen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Das Nibelungenlied: Dieses Kapitel dient der Einführung in den Untersuchungsgegenstand: das Nibelungenlied. Es werden der Inhalt, die Entstehung, die verschiedenen Handschriften und die unbekannte Autorenschaft des mittelhochdeutschen Epos behandelt. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung des notwendigen Kontextes für die spätere linguistische Analyse, indem die historische und literarische Bedeutung des Werkes beleuchtet wird. Die Beschreibung der zwei Hauptteile des Epos – Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache – liefert den Rahmen für das Verständnis der später analysierten Textstellen.
Kapitel 2: Theoretischer Teil: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Analyse dar. Es beginnt mit einer Einführung in die Valenztheorie, erklärt den Valenzbegriff und die Bedeutung der „Mitspieler“ eines Verbs. Anschließend werden verschiedene Typen von Valenzrahmen vorgestellt und anhand von Beispielen aus dem Nibelungenlied illustriert. Ein wichtiger Bestandteil ist die detaillierte Beschreibung der Methode der satzsemantischen Kollokationsanalyse, einschließlich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Kollokationsauswertung nach Bergenholtz und einer Erläuterung der satzsemantischen Funktionen der Bezugsstellen, die für die Analyse der „lîp“-Kollokationen essentiell sind. Der theoretische Rahmen wird somit präzise definiert und auf die spezifischen Anforderungen der Arbeit zugeschnitten.
Kapitel 3: Der Begriff „Lip“: Das Kapitel widmet sich dem zentralen Begriff „lîp“. Es werden die verschiedenen möglichen Lesarten von „lîp“ vorgestellt und mit konkreten Beispielen aus dem Nibelungenlied belegt. Eine kurze Einführung in die Phraseologie dient der Untersuchung auf mögliche Phraseologismen, die im Zusammenhang mit „lîp“ im Text vorkommen. Die verschiedenen Interpretationen und Bedeutungsnuancen von „lîp“ werden systematisch erörtert, um den Weg für die nachfolgende detaillierte Katalogisierung im vierten Kapitel zu ebnen.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Mittelhochdeutsch, Kollokationen, „lîp“, Valenztheorie, Satzsemantik, Kollokationsanalyse, Phraseologie, Empirische Untersuchung, Linguistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nibelungenlied-Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kollokationen des mittelhochdeutschen Wortes „lîp“ im Nibelungenlied. Ziel ist die Analyse der verschiedenen Bedeutungsfacetten und Verwendungskontexte von „lîp“ mithilfe der satzsemantischen Kollokationsanalyse. Die Arbeit verbindet empirische Textanalyse mit theoretischen Grundlagen der Valenztheorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung in das Nibelungenlied (Inhalt, Entstehung, Handschriften). Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen, insbesondere die Valenztheorie und die Methode der satzsemantischen Kollokationsanalyse. Kapitel 3 befasst sich mit den verschiedenen Lesarten des Wortes „lîp“ und untersucht mögliche Phraseologismen. Kapitel 4 präsentiert einen Katalog aller analysierten „lîp“-Kollokationen mit detaillierten Informationen (Fundort, mittelhochdeutsche Textstelle, Übersetzung, linguistische Analyse, Übersetzung von „lîp“, Kommentar).
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die satzsemantische Kollokationsanalyse. Diese Methode wird im theoretischen Teil detailliert erklärt. Die Analyse basiert auf der Valenztheorie, die die Beziehungen zwischen Verben und ihren Ergänzungen beschreibt. Die Arbeit beinhaltet eine empirische Analyse des Nibelungenliedes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die umfassende Analyse der Kollokationen von „lîp“ im Nibelungenlied. Es soll aufgezeigt werden, welche Bedeutungsnuancen und Verwendungskontexte dieses Wort im mittelhochdeutschen Epos hat. Die Anwendung der satzsemantischen Kollokationsanalyse soll dabei einen strukturierten und wissenschaftlich fundierten Ansatz bieten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Valenztheorie, die die Abhängigkeiten zwischen Wörtern in einem Satz beschreibt, und die satzsemantische Kollokationsanalyse, eine Methode zur Untersuchung der Beziehungen zwischen Wörtern im Kontext. Die Methode der Kollokationsauswertung nach Bergenholtz wird kritisch diskutiert.
Was ist der Aufbau des Katalogs in Kapitel 4?
Der Katalog enthält für jede „lîp“-Kollokation folgende Informationen: Fundort im Nibelungenlied, die mittelhochdeutsche Textstelle, eine Übersetzung ins Neuhochdeutsche, eine linguistische Analyse, die Übersetzung von „lîp“ im jeweiligen Kontext und einen Kommentar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Mittelhochdeutsch, Kollokationen, „lîp“, Valenztheorie, Satzsemantik, Kollokationsanalyse, Phraseologie, Empirische Untersuchung, Linguistische Analyse.
Wer ist der Autor des Nibelungenliedes?
Die Autorenschaft des Nibelungenliedes ist unbekannt. Die Arbeit geht nicht auf die Frage der Autorschaft im Detail ein, sondern konzentriert sich auf die linguistische Analyse des Textes.
Wie wird der Begriff „lîp“ in der Arbeit behandelt?
Kapitel 3 widmet sich explizit den verschiedenen Lesarten und Bedeutungsnuancen des Wortes „lîp“. Es werden konkrete Beispiele aus dem Nibelungenlied analysiert und ein möglicher Phraseologismusverdacht untersucht. Diese Analyse legt die Grundlage für den detaillierten Katalog in Kapitel 4.
- Citation du texte
- Christina Meiser (Auteur), 2004, `lîp`- Kollokationen im Mittelhochdeutschen - Empirische Untersuchungen am Nibelungenlied: `Die Methode der satzsemantischen Kollokationsanalyse`, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33556