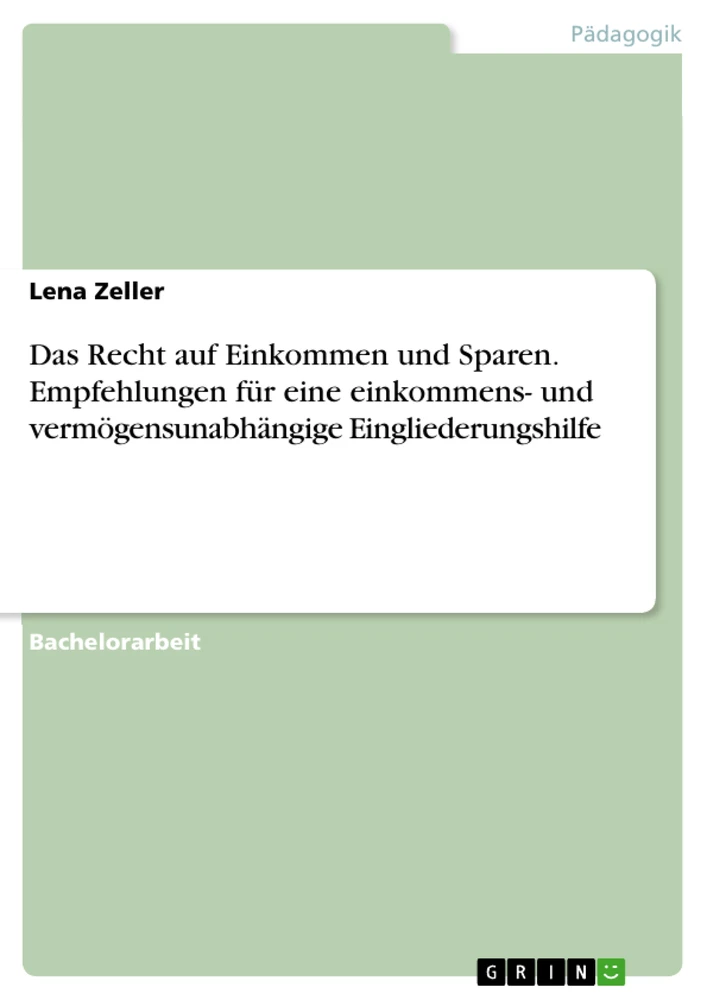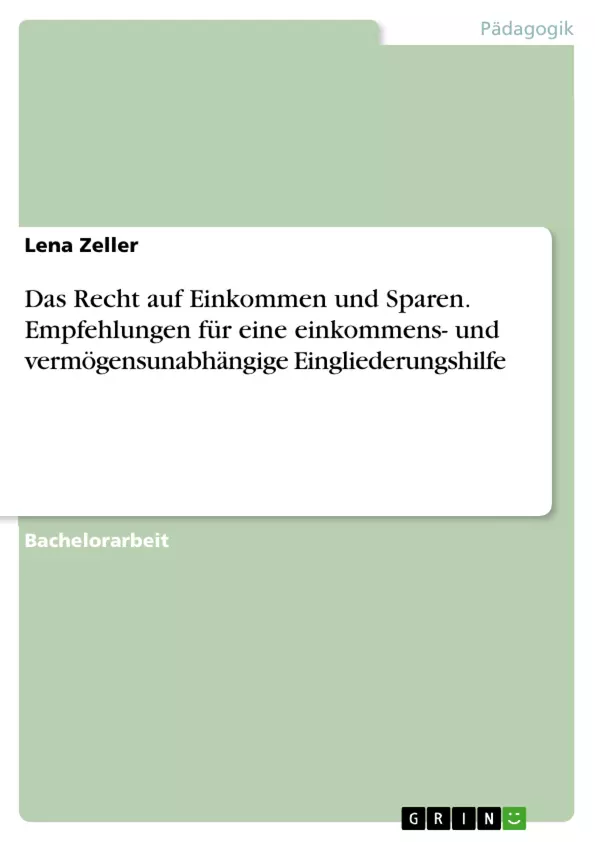Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist eine Leistung der Sozialhilfe im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe. Sie wurde im Jahr 1961 verabschiedet und ist seitdem in ihrer Grundstruktur unverändert. Mittlerweile ist die Eingliederungshilfe die finanziell bedeutendste Hilfeart der Sozialhilfe und die Anzahl der Leistungsempfänger_innen steigt jährlich, dementsprechend steigen die Ausgaben der Eingliederungshilfe. Die Einkommens- und Vermögensabhängigkeit dieser Leistung wird bereits seit 1973 immer wieder kritisiert und diskutiert.
In der vorliegenden Bachelorthesis wird die Diskussion der vergangenen Jahrzehnte aufgezeigt, der Fokus jedoch auf die aktuelle Diskussion gelegt. Die 2013 initiierte Petition „Recht auf Sparen und gleiches Einkommen auch für Menschen mit Behinderungen“ sowie die begleitende Berichterstattung in den Medien haben mein Interesse an dieser Thematik geweckt. Aus diesem Grund entschied ich mich dazu, meine Abschlussarbeit zu nutzen, um die Einkommens- und Vermögensanrechnung im Rahmen der Eingliederungshilfe vor dem Hintergrund meines im Bachelorstudium erworbenen Wissens kritisch zu betrachten.
Die Fragen wer die Reform der Eingliederungshilfe hin zu einer einkommens- und vermögensunabhängigen Leistung fordert und was die Argumente dieser Akteur_innen sind, bildeten die Ausgangslage für eine umfangreiche Recherche. Analysiert wurden Positionen von Interessensvertretungen behinderter Menschen sowie denen der aktuell im Bundestag vertretenden Fraktionen.
Den ersten Teil der Bachelorthesis bildet eine Einführung in die rechtlichen Grundlagen der Eingliederungshilfe sowie die Beschreibung ihrer Nutzer_innen und eine Einführung in die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die für die aktuelle Diskussion entscheidend ist. Die Zusammenstellung der rechtlichen Grundlagen ist dabei bewusst nah am Gesetzestext formuliert, damit die Sinnhaftigkeit der Rechtsvorschriften nicht durch eigenen Sprachgebrauch verfälscht wird. In dem zweiten Teil wird die „Begründung einer einkommens- und vermögensunabhängigen Eingliederungshilfe anhand der UN-Behindertenrechtskonvention“ der Humboldt Law Clinic für Grund- und Menschenrechte vorgestellt, die 2013 in Kooperation mit der Interessensvertretung Selbstbestimmtes Leben in Deutschland e.V. entstanden ist. Weiterhin liegen die Schwerpunkte auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Gesetz zur Sozialen Teilhabe des Forums behinderter Jurist_innen [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eingliederungshilfe
- Leistungsberechtigte
- Aufgaben, Ziele und Leistungen
- Medizinische Rehabilitation
- Berufliche Rehabilitation
- Soziale Rehabilitation
- Weitere Leistungen
- Subsidiaritätsgrundsatz
- Sachliche und örtliche Zuständigkeit
- Ausgaben
- Einnahmen
- Einkommensanrechnung
- Vermögensanrechnung
- Unterhaltspflicht
- Ausnahmen
- UN-Behindertenrechtskonvention
- Der Behinderungsbegriff
- Gerichtliche Praxis
- Angemessene Vorkehrungen
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- Verstoß gegen Grundgesetz (GG)
- Verstoß gegen BRK
- Systemwidrige Einordnung in Sozialhilfe
- Diskussion
- Gesetz zur Sozialen Teilhabe (GST)
- Änderung des SGB XII
- Änderung des SGB IX
- Budget- und Assistenzleistungen
- Persönliche Unterstützung
- Teilhabegeld
- Weitere Leistungen
- Zuständigkeit und Kostentragung
- Ähnliche Gesetzesentwürfe und Forderungen
- Online Petition
- Spare
- Auswirkung auf Partnerschaft
- Entschließung des Bundesrates
- Strukturelle und inhaltliche Reform
- Zeitliche Umsetzung
- Beschlüsse der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister
- Finanzierung
- Bewertung
- Bundespolitik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Recht auf Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Sie analysiert die aktuelle Situation und die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention und das Gesetz zur Sozialen Teilhabe. Die Arbeit untersucht, inwieweit die bestehende Eingliederungshilfe den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird, und welche Reformen notwendig sind, um das Recht auf Einkommen und Sparen zu gewährleisten.
- Die Rechtslage im Hinblick auf Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen in Deutschland
- Die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Umsetzung in der deutschen Rechtsordnung
- Die Rolle der Eingliederungshilfe und ihre Auswirkungen auf die finanzielle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen
- Die Bedeutung des Rechts auf Sparen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Mögliche Reformansätze zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den aktuellen Stand der Debatte um das Recht auf Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen dar.
Kapitel 2 beleuchtet die Eingliederungshilfe in Deutschland und deren Leistungen, insbesondere im Hinblick auf finanzielle und wirtschaftliche Aspekte.
Kapitel 3 untersucht die UN-Behindertenrechtskonvention und analysiert, ob die deutsche Rechtsordnung die darin festgehaltenen Prinzipien zur Verwirklichung des Rechts auf Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen umsetzt.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Gesetz zur Sozialen Teilhabe und seinen Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Menschen mit Behinderungen.
Kapitel 5 betrachtet verschiedene Initiativen und Entwicklungen, wie Online Petitionen, Entscheidungen des Bundesrates und Beschlüsse der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die sich mit der Thematik des Rechts auf Einkommen und Sparen von Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Eingliederungshilfe, UN-Behindertenrechtskonvention, Recht auf Einkommen, Recht auf Sparen, finanzielle Selbstbestimmung, Menschen mit Behinderungen, Gesetz zur Sozialen Teilhabe, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Rechtslage, Reformansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem mit der Einkommensanrechnung bei der Eingliederungshilfe?
Menschen mit Behinderungen müssen oft ihr Einkommen und Vermögen bis auf geringe Schonbeträge einsetzen, um Unterstützung zu erhalten, was ihre finanzielle Selbstbestimmung einschränkt.
Was fordert die Petition "Recht auf Sparen"?
Sie fordert eine einkommens- und vermögensunabhängige Eingliederungshilfe, damit behinderte Menschen wie Nicht-Behinderte Geld ansparen und über ihr Einkommen verfügen können.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die Konvention betont das Recht auf volle Teilhabe und Selbstbestimmung; Kritiker sehen in der aktuellen Rechtslage einen Verstoß gegen diese internationalen Standards.
Was ist das "Gesetz zur Sozialen Teilhabe" (GST)?
Ein Gesetzentwurf von Interessenverbänden, der eine Reform der Eingliederungshilfe hin zu einer bedarfsorientierten statt einkommensabhängigen Leistung vorsieht.
Wie wirkt sich die aktuelle Regelung auf Partnerschaften aus?
Oft wird auch das Einkommen des Partners herangezogen, was dazu führen kann, dass behinderte Menschen finanziell extrem abhängig von ihren Partnern werden.
- Citar trabajo
- Lena Zeller (Autor), 2014, Das Recht auf Einkommen und Sparen. Empfehlungen für eine einkommens- und vermögensunabhängige Eingliederungshilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335621