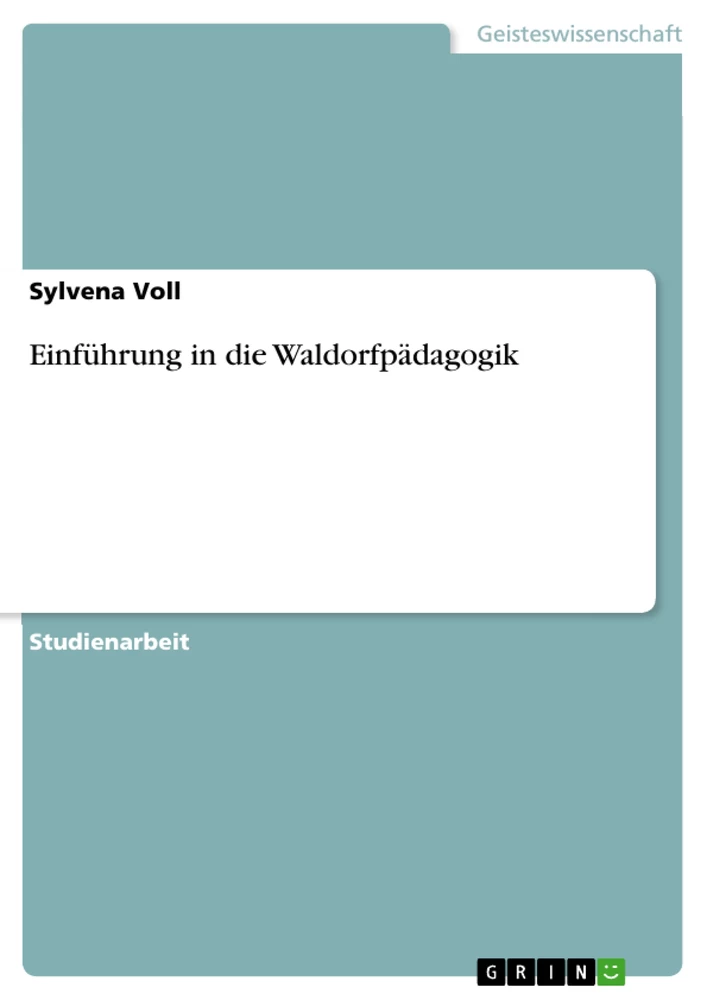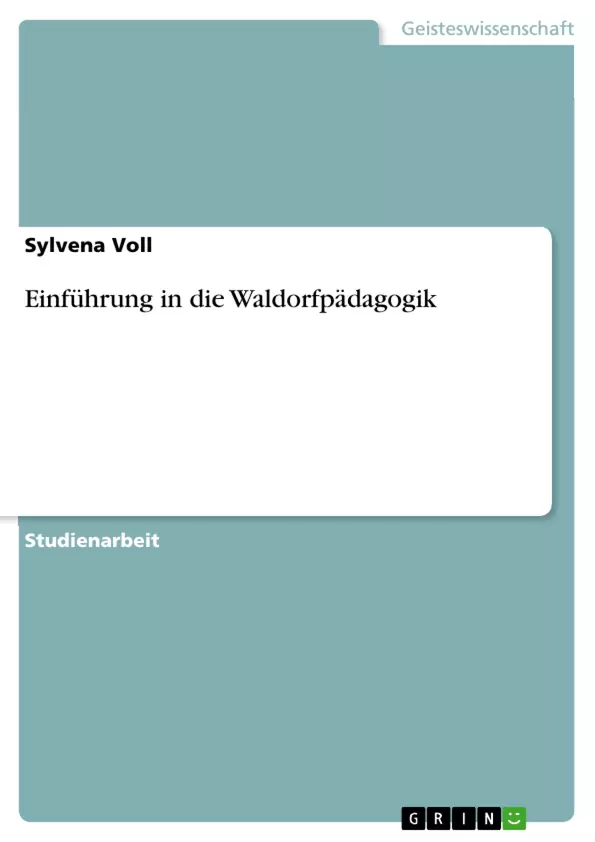Ich finde es sehr interessant, dass in der Waldorfpädagogik zunächst bei den Urzuständen angesetzt wird. Es ist heutzutage sehr wichtig, dass Kinder den Bezug zur Natur und Umwelt nicht verlieren. Viele Kinder, besonders in den Großstädten, haben kaum Naturverständnis. Deshalb ist es wichtig, sie von klein auf mit ihrer Umwelt vertraut zu machen. Wie viele Kinder gibt es, die glauben, Kühe seien lila? Sicherlich viel zu viele. Das kommt daher, dass sich die Eltern kaum noch intensiv mit ihren Kindern beschäftigen können, weil neben dem Beruf kaum noch Zeit frei ist. Also lernen die Kinder zum Teil viel aus den Medien. Die tolle bunte Welt die einem dort vorgegaukelt wird hat allerdings nichts mit der Realität zu tun.
Sicher gibt es auch andere pädagogische Richtungen, welche sich mit den Urzuständen beschäftigen. In der Waldorfpädagogik ist dies aber sehr ausgeprägt. Die Kinder bekommen keine Zensuren, sondern nur eine Einschätzung über die soziale und schulische Entwicklung. Ist der Jugendliche dann besser oder schlechter auf sein Leben vorbereitet? Fühlt er sich gestärkt, weil er weiß, was er wie in seiner Persönlichkeit ändern kann? Ist diese Methode überhaupt sinnvoll oder sollte es überall Benotungen geben? Bereiten die Fächer wirklich allumfassend auf die Zukunft vor? Diese und andere Fragen werde ich versuchen, in meiner Arbeit zu klären.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Wer war Rudolf Steiner?
2. Reformbestrebungen in der Schule
3. Die Schulgründung
4. Merkmale der Schule und einige Fächer
5. Die pädagogischen Grundlagen der Waldorfschule
6. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Einleitung
In meiner Studienarbeit möchte ich mich mit dem Thema Waldorfpädagogik auseinander setzen. Ich möchte die Pädagogik in der Waldorfschule näher betrachten. Dabei werde ich auf einige wichtige Lehrfächer intensiver eingehen.
Ich finde es sehr interessant, dass in der Waldorfpädagogik zunächst bei den Urzuständen angesetzt wird. Es ist heutzutage sehr wichtig, dass Kinder den Bezug zur Natur und Umwelt nicht verlieren. Viele Kinder, besonders in den Großstädten, haben kaum Naturverständnis.[1] Deshalb ist es wichtig, sie von klein auf mit ihrer Umwelt vertraut zu machen. Wie viele Kinder gibt es, die glauben, Kühe seien lila? Sicherlich viel zu viele. Das kommt daher, dass sich die Eltern kaum noch intensiv mit ihren Kindern beschäftigen können, weil neben dem Beruf kaum noch Zeit frei ist.
Sicher gibt es auch andere pädagogische Richtungen, welche sich damit beschäftigen. In der Waldorfpädagogik ist dies aber sehr ausgeprägt. Die Kinder bekommen keine Zensuren, sondern nur eine Einschätzung über die soziale und schulische Entwicklung. Ist der Jugendliche dann besser oder schlechter auf sein Leben vorbereitet? Fühlt er sich gestärkt, weil er weiß, was er wie in seiner Persönlichkeit ändern kann? Ist diese Methode überhaupt sinnvoll oder sollte es überall Benotungen geben? Bereiten die Fächer wirklich allumfassend auf die Zukunft vor? Diese und andere Fragen werde ich versuchen, in meiner Arbeit zu klären.
Doch zunächst möchte ich erst einmal den Begründer der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, vorstellen und die Entstehung der ersten Schule erläutern.
1. Wer war Rudolf Steiner?
Rudolf Steiner wurde am 27.02.1861 in Kraljevic (Grenzlinie zwischen Mittel- und Osteuropa, heute Kroatien) geboren. Der Vater war ursprünglich Jäger. Als Steiner 2 Jahre war trat der Vater in den Dienst bei der Bahnstation an der Semmeringbahn. Im 8. Lebensjahr siedelte die Familie nach Neudörfel, Nähe Wien über.
Mit 9 Jahren bekam er sein erstes Geometriebuch in die Hand und war seit dem von der Mathematik fasziniert. Er bestand das Abitur mit Auszeichnung und begann an der Technischen Hochschule in Wien zu studieren. Er belegte hauptsächlich naturwissenschaftliche Fächer. Mit der Zeit wendete er sich aber verstärkt den Philosophen des deutschen Idealismus zu.
Er unterrichtete als Hauslehrer in der Familie Specht einen 10jährigen Jungen,
der an Wasserkopf litt und als kaum bildungsfähig galt. Durch methodisch geregeltes, übendes Lernen konnte der Junge wieder die Schule besuchen, Abitur machen und Arzt werden.
Entscheidend für den weiteren Lebensweg Steiners war die Begegnung mit Karl-Julius Schröer, welcher Vorlesungen über die deutsche Literatur hielt und als erster Goethes „Faust“ heraus gab. Schröer empfiehlt Steiner an Josef Kirschner weiter. Kirschner beauftragt den 21jährigen Steiner, Goethes natur-wissenschaftliche Schriften herauszugeben. Dabei erkennt Steiner Goethes eigentliche Leistungen, den ganzheitlichen Forschungsansatz.
Dieser Methode folgt auch der anthroposophische[2] Forschungsansatz, welcher den forschenden Menschen selbst reflektiert. Der Anteil des Menschen am Erkenntnisprozess soll damit deutlich werden. Die Erkenntnisfähigkeit soll durch bewusste Wahrnehmbarkeit erhöht werden.
Hierbei gibt es drei Arten von Schulungen.
1. die Denkschulung: von innen willentliche Steuerung des Gedankenstromes
bewusst durch Konzentrationsübungen
2. die Gefühlsschulung: welche Gefühlseindrücke wirken in welcher Weise und
was wollen sie mir sagen?
Zurückhaltung von Urteils- und Begriffsbildung
3. die Willensschulung: wird zum Beobachtungs- und Übungsfeld
[...]
[1] Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. (Hrsg.): Vom Waldorfkindergarten.
Stuttgart 2001
[2] Anthroposophie: (griech.: Menschenweisheit) christlich orientierte Weltanschauung, die den Anspruch
auf wissenschaftliche Erforschung der übersinnlichen Welt erhebt. A. versucht eine umfassende
Deutung aller Natur- und Kulturbereiche, sowie eine freiheitliche und ganzheitliche Lösung der polit-
ischen und wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Rudolf Steiner?
Rudolf Steiner (1861–1925) war der Begründer der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie. Er entwickelte ein ganzheitliches Bildungskonzept, das auf naturwissenschaftlichen und philosophischen Ansätzen basiert.
Welche Rolle spielt die Natur in der Waldorfpädagogik?
Der Bezug zur Natur und Umwelt ist ein zentraler Pfeiler. Kindern soll von klein auf ein tiefes Naturverständnis vermittelt werden, um der Entfremdung von der Realität, besonders in Großstädten, entgegenzuwirken.
Gibt es in Waldorfschulen Noten?
Nein, in der Waldorfpädagogik erhalten die Kinder keine klassischen Zensuren. Stattdessen gibt es detaillierte Einschätzungen über die soziale und schulische Entwicklung des Kindes.
Was sind die drei Schulungsarten des anthroposophischen Ansatzes?
Steiner unterscheidet zwischen der Denkschulung (Konzentrationsübungen), der Gefühlsschulung (Reflexion von Gefühlseindrücken) und der Willensschulung.
Wann wurde die erste Waldorfschule gegründet?
Die erste Waldorfschule entstand aus Reformbestrebungen im frühen 20. Jahrhundert unter der Leitung von Rudolf Steiner, um eine ganzheitliche Bildung jenseits rein intellektueller Wissensvermittlung zu ermöglichen.
- Quote paper
- Sylvena Voll (Author), 2002, Einführung in die Waldorfpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3356