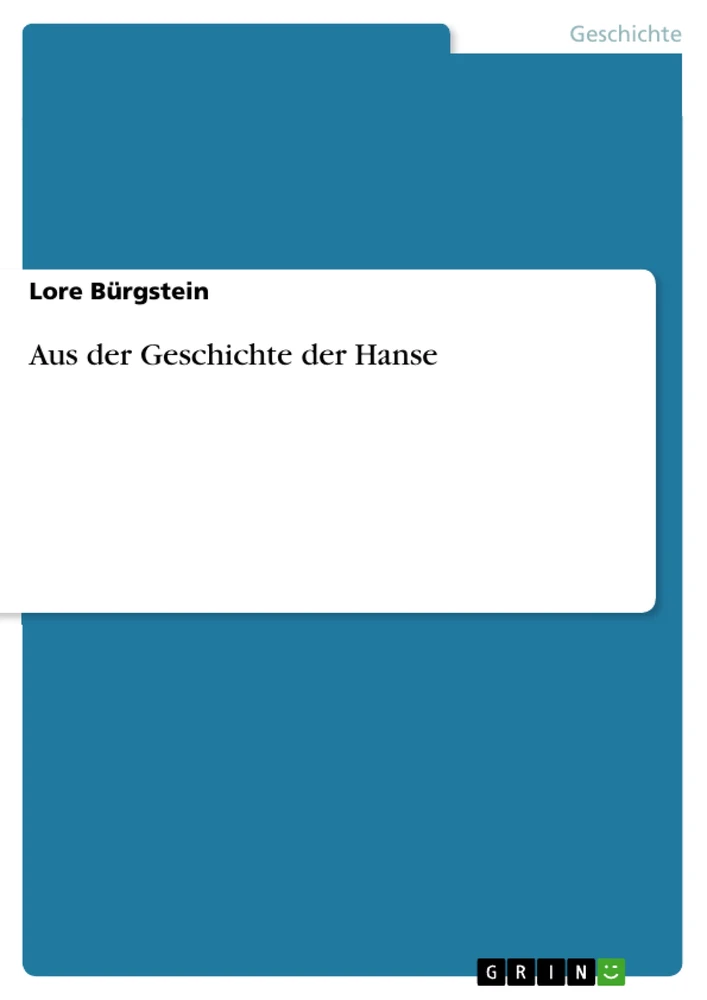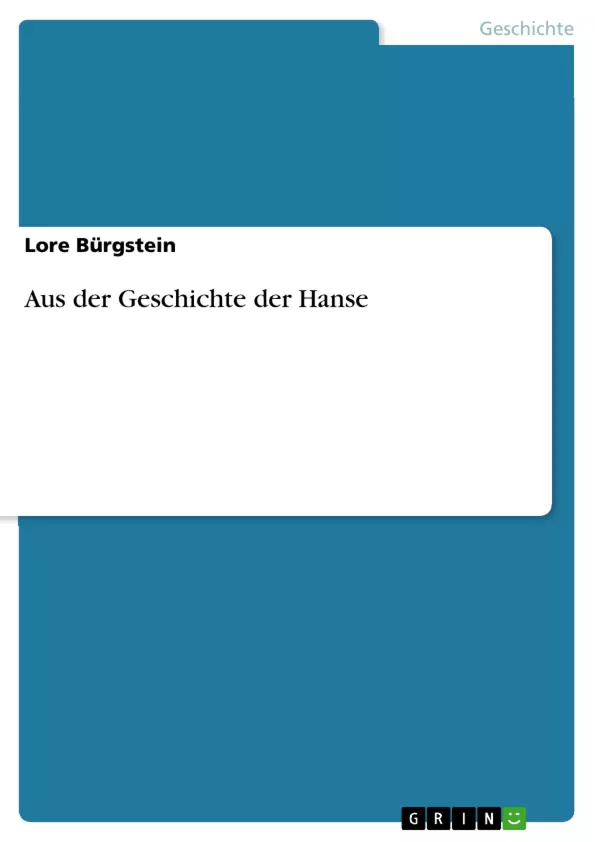Gegen Ende des 10. Jahrhunderts begann der Prozeß der Herauslösung der Städte aus dem Landbezirk, in dem sie bis dahin lagen. Sie bildeten einen eigenen Gerichtsbezirk unter einem Stadtrichter, der vom Stadtherren eingesetzt wurde. Vertreter des Stadtherren war der Vogt oder Schultheiß. Die Mehrzahl der Bewohner der Städte war von dem Stadtherren oder von anderen adligen Grundherren personenrechtlich abhängig (Hörige, Zensuale, Ministeriale), die Freien in der Minderzahl. 1184-88 bestätigte Kaiser Barbarossa Privilegien, die für die Entwicklung des Städtewesens und der bürgerlichen Freiheiten wichtig waren. So verbriefte er das Recht der persönlichen Freiheit den Bewohnern von Lübeck und Bremen. Um die siebziger Jahre des 12. Jahrhunderts begann auch im Norden des Reiches das Zeitalter der Städtegründungen östlichder Elbe, nachdem Lübeck 1158 das zweite Mal gegründet worden war, Rostock folgte 1218. Durch Zölle, Steuern und andere Einnahmen flossen den Landesherrenerhebliche Geldeinnahmen aus ihren Städten als Trägern der neuen Geldwirtschaft zu. Und die Städte stellten einen erheblichen Teil der militärischen Stärke ihres Landesherren. Bei jeder Stadtgründung wurde ein schon bewährtes Stadtrecht übernommen oder vom Stadtherren eines bestimmt. Das älteste Stadtrecht war das Soester von 1150, welches zum Teil in das Lübecker von 1227 und 1236 integriert wurde, neben welchem noch das Magdeburger von 1181 bestand, alle waren weit verbreitet. Unter Willkürrecht verstand man das Recht, die inneren Angelegenheiten selbst durch Verfügungen ordnen zu dürfen, wobei das Gemeindemitglied durch seinen Eid zur Einhaltung der Willküren (Kohre) gebunden war. Die hoheitlichen Rechte betrafen die an den Stadtherren übergegangenen königlichen Regalien von Zoll und Münze, das Befestigungsrecht sowie das Militärwesen und die Verfügung über Einnahmen aller Art. Die hohe Gerichtsbarkeit behielt der Stadtherr auch meist in der Hand, ebenso das Satzungsrecht (Gebot und Verbot zu erlassen). In Lübeck befand sich die Hochgerichtsbarkeit seit 1263 in bürgerlicher Hand. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil:
- Die Städtehanse
- Die Vorgeschichte der Städtehanse
- Einführung
- Das Bündnis der wendischen Städte
- Die Stilllegung des Handels in Brügge 1280
- Die Blockade gegen Norwegen 1284
- Die Krise in der Hanse Anfang des 14. Jahrhunderts und der schwarze Tod
- Die Städtehanse konstituiert sich
- Die Organisation des Brügger Kontors
- Die Versammlung der Vertreter der Städte 1356 in Lübeck
- Der Peterhof in Nowgorod und das Bergener Kontor werden der Städtehanse unterstellt
- Das Londoner Hansekontor unterwirft sich der Oberleitung der Städte
- Der Hansetag 1358 in Lübeck und die Blockade Flanderns
- Die Städtehanse wird nordeuropäische Großmacht
- Die Aktivitäten des Königs Waldemar IV. Atterdag und die Hanse
- Die Kölner Konföderation von 1367
- Der Stralsunder Frieden von 1370
- Die Vorgeschichte der Städtehanse
- Große Kaufleute zur Zeit der Städtehanse
- Einführung
- Johann Wittenborch
- Johann Nagel
- Jacob Plescow
- Die Brüder Veckinchusen
- Francesco di Marco Datini
- Zweiter Teil:
- Die Etappen der Hansischen Geschichtsschreibung
- Dritter Teil:
- Was war die Hanse?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk analysiert die Geschichte der Hanse als ein bedeutendes Phänomen der mittelalterlichen Wirtschaft und Politik. Es beleuchtet die Herausbildung und Entwicklung des hansischen Handels und seine Ausdehnung auf ein riesiges Gebiet, das von Nordfrankreich bis nach Nordwestrußland reichte. Das Werk konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Etappen der hansischen Geschichte, die Schlüsselmomente der Konsolidierung und Ausbreitung des Handels sowie auf die großen Persönlichkeiten, die den hansischen Handel maßgeblich prägten. Darüber hinaus geht das Werk auf die Anfänge der hansischen Geschichtsschreibung und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit ein.
- Die Herausbildung der Hanse aus der Gotländischen Genossenschaft
- Die Konsolidierung der Hanse als Städtebund
- Die Macht und der Einfluß der Hanse in Nordeuropa
- Die wichtigsten Akteure und Unternehmer des hansischen Handels
- Die Entwicklung der hansischen Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1.1: Die Vorgeschichte der Städtehanse: Die Anfänge des städtischen Lebens im 10. Jahrhundert, die Entwicklung des Städtewesens und der bürgerlichen Freiheiten, die Bedeutung von Lübeck als zentrale Stadt im Ostseehandel, das Bündnis der wendischen Städte und die ersten Bündnisse zwischen den deutschen Städten zur Sicherung des Landfriedens.
- Kapitel 1.2: Die Städtehanse konstituiert sich: Die Organisation des Brügger Kontors, die Versammlung der Vertreter der Städte 1356 in Lübeck, die Unterordnung des Peterhofs in Nowgorod und des Bergener Kontors unter die Oberleitung der Städte, die Unterwerfung des Londoner Hansekontors, der Hansetag 1358 in Lübeck und die Blockade Flanderns.
- Kapitel 1.3: Die Städtehanse wird nordeuropäische Großmacht: Die Aktivitäten des Königs Waldemar IV. Atterdag und die Hanse, die Kölner Konföderation von 1367 als Kriegsbündnis, die Eroberung Kopenhagens und die Sicherung des Sunds, der Stralsunder Frieden von 1370 und die Festigung der Hanse als politische Macht ersten Ranges in Nordeuropa.
- Kapitel 2.1: Einführung: Die Rolle des hansischen Kaufmanns als Vermittler zwischen den Produktionszentren, die Vermögenslage der Hansekaufleute und die soziale Struktur der Hansestädte, die Entwicklung der Handelstechniken und die Unterscheidung zwischen Eigengeschäft und Handelsgesellschaft.
- Kapitel 2.2: Johann Wittenborch: Die Geschäftsaktivitäten von Johann Wittenborch als Kaufmann und Bürgermeister von Lübeck, seine Handelsbeziehungen zu Flandern, England, Schonen, Preußen, Livland und Rußland, seine Rolle im Krieg gegen Dänemark und sein tragischer Tod.
- Kapitel 2.3: Johann Nagel: Die Karriere eines großen schwedischen Kaufmanns deutscher Abstammung, sein Handel mit Kupfer und anderen schwedischen Erzeugnissen, seine Geschäftsverbindungen zu Flandern und Lübeck, sein Aufstieg zum Bürgermeister von Stockholm.
- Kapitel 2.4: Jacob Plescow: Die Familie Plescow und ihre Übersiedlung von Wisby nach Lübeck, die Handelsverbindungen und die politischen Aktivitäten von Jacob Plescow, seine Rolle als Bürgermeister von Lübeck, Diplomat und Finanzexperte, seine Bedeutung für die Einigung der Hanse und den Stralsunder Frieden.
- Kapitel 2.5: Die Brüder Veckinchusen: Die Brüder Hildebrand und Sivert Veckinchusen als erfolgreiche Hansekaufleute, ihre Handelsbeziehungen zu Brügge, Nowgorod, Livland, Köln und Venedig, die Gründung der Venedyschen Selschap und ihr Scheitern.
- Kapitel 2.6: Francesco di Marco Datini: Die Lebensgeschichte des toskanischen Kaufmanns Francesco di Marco Datini, seine Handelsaktivitäten in Avignon, Prato und Florenz, seine Beziehungen zur Kirche und seine Bedeutung als Vertreter der Renaissance im Handel.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Werkes sind: Hanse, Städtehanse, Kaufleute, Handel, Wirtschaft, Politik, Nordeuropa, Ostsee, Lübeck, Brügge, Bergen, Nowgorod, Gotland, Waldemar IV. Atterdag, Stralsunder Frieden, Kölner Konföderation, Hansische Geschichtsschreibung, Georg Sartorius, Georg Waitz, Dietrich Schäfer, Fritz Rörig, Ahasver von Brandt, Philippe Dollinger, Ernst Pitz, Gesellschaftshandel, Privilegien, Städtebund, Interessengemeinschaft.
- Die Städtehanse
- Quote paper
- Dr. med. Lore Bürgstein (Author), 2016, Aus der Geschichte der Hanse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336191