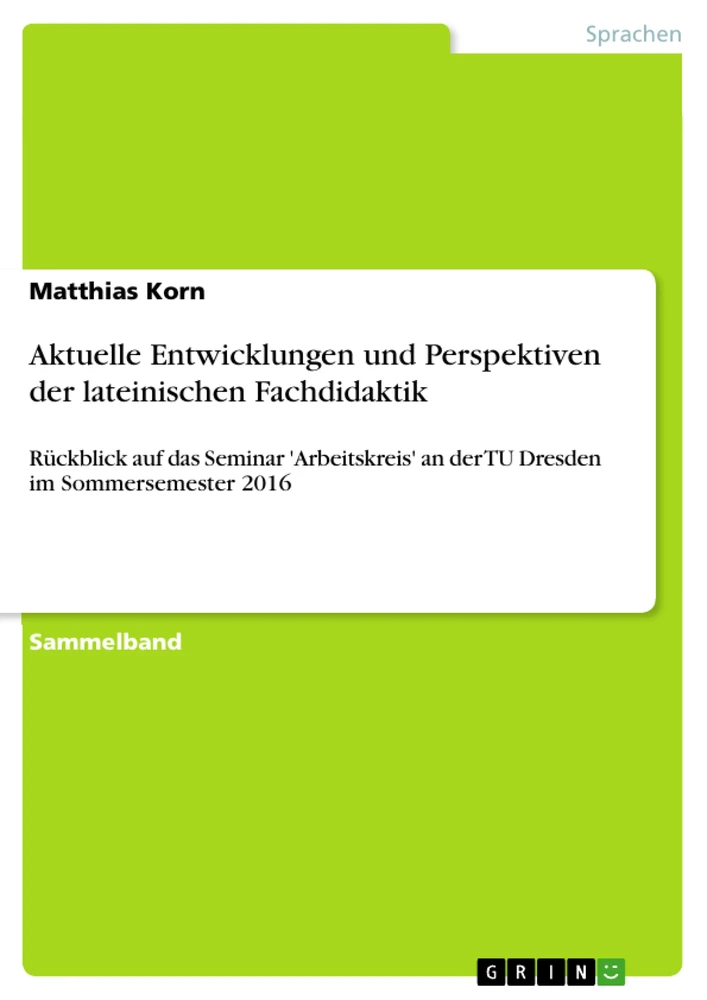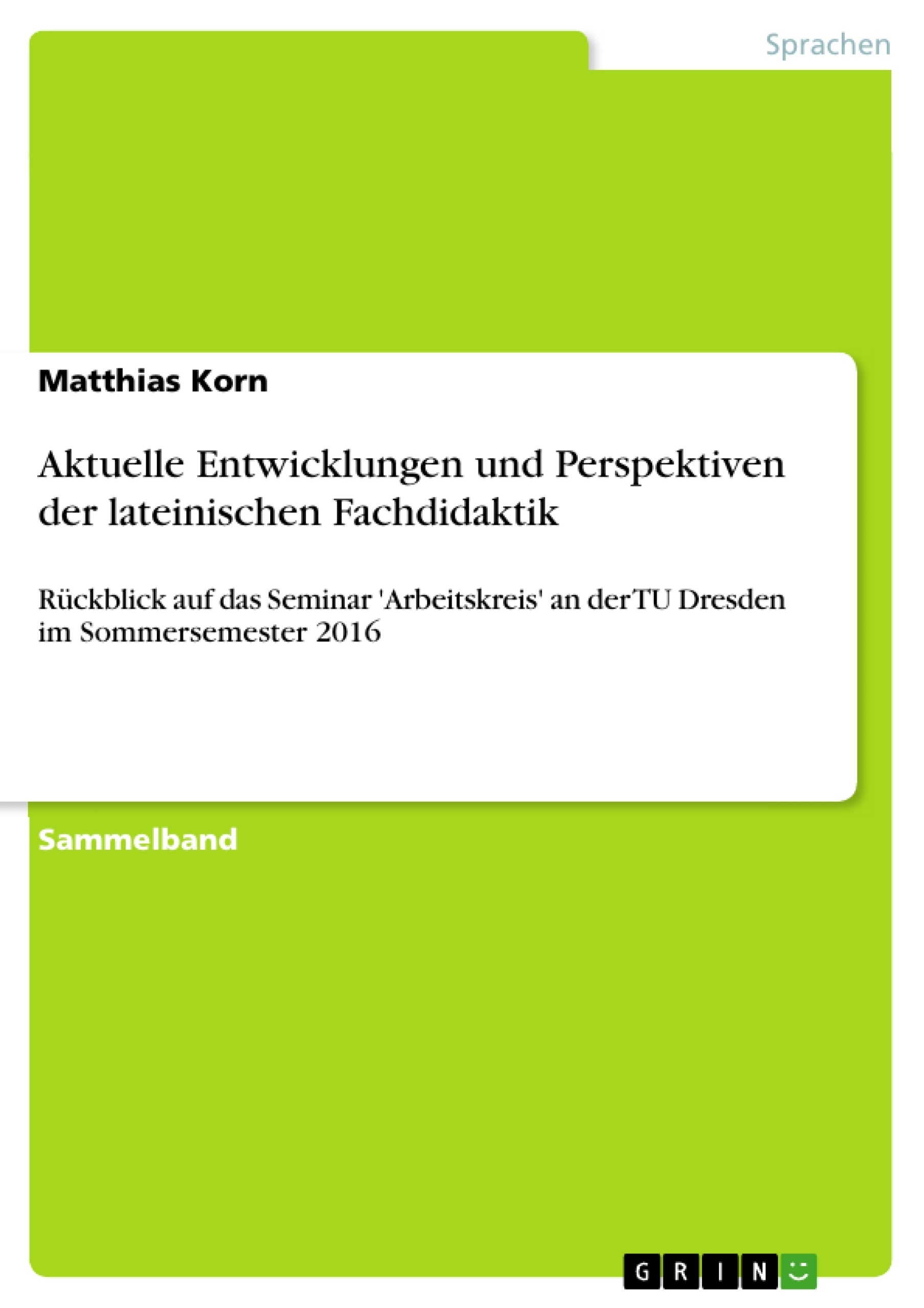Dieser Sammelband ist im Sommersemester 2016 aus dem vom Herausgeber veranstalteten Seminar 'Arbeitskreis: Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der lateinischen Fachdidaktik' an der TU Dresden hervorgegangen. Er enthält neben den wesentlichen Seminardokumenten und -ergebnissen Beiträge von Teilnehmern und Kollegen, die teils auf das Seminar zurückblicken, teils in die fachdidaktische Zukunft schauen.
Ziel des Seminars war es, ausgehend von einer möglichst fundierten Analyse des Ist-Stands des Lateinunterrichts in Deutschland die Perspektiven herauszuarbeiten, die sich daraus für eine zielführende Weiterentwicklung des Lateinunterrichts ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis:
- Vorwort
- Ziel, Inhalt und Stoffverteilung des Seminars
- Inhaltsverzeichnis:
- Michael Baumann: Wie wichtig ist das Nachdenken über die Fachdidaktik?
- Johanna Trompke: Latein neu denken
- Kristina Pflugbeil: Wesentliche Erkenntnisse der Studie von Florian zum Schüler-vorgehen beim selbstständigen Übersetzen aus dem Lateinischen
- Melanie Achtert: Ein kurzes Feedback zum Kurs
- Markus Scholz: Neue Wege oder alte Pfade? – Der neue Stowasser im Faktencheck
- Viviane Pietsch: Aquilonia – Einige kurze Beobachtungen von Interesse für (zukünftige) magistri magistraeque des Faches Latein
- Anna Philina Burmester: Hinweise zur kritischen Nutzung zugelassener Lehrbücher in der Spracherwerbsphase
- Susi Voigt: Die unterrichtliche Arbeit mit Wörternetzen im altsprachlichen Unterricht am Beispiel von Prima Nova Lektion 11
- Anja Behrendt – Matthias Korn: Wesentliche Entwicklungsperspektiven für die Fachdidaktik der Schulfremdsprache Latein:
- Matthias Korn: Gewichtete Inhaltszusammenfassungen zu den einzelnen Seminar-sitzungen:
- Anlage 1: Stoffverteilungsplan für das Seminar
- Anlage 2: Ausschnitt aus einem Lehrbuch, das die Problematik der Schwerpunktsetzung im Bereich der Morphosyntax zeigt
- Susan Gaugenrieder: Quo vadis, Lingua Latina – und nimmst du mich mit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Broschüre fasst die Ergebnisse eines Seminars über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der lateinischen Fachdidaktik zusammen. Sie soll die Perspektiven für eine zielführende Weiterentwicklung des Lateinunterrichts in Deutschland aufzeigen, ausgehend von einer Analyse des Ist-Zustands.
- Die zunehmende Begründungsbedürftigkeit altsprachlicher Bildung im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen.
- Die Notwendigkeit, die Relevanz und Bedeutung des Lateinunterrichts in der Gegenwart und Zukunft zu stärken.
- Die Herausforderung, das Fach Latein im Wettbewerb mit anderen Fremdsprachen und Bildungsangeboten attraktiv zu halten.
- Die Notwendigkeit, einseitige Kompetenzausrichtungen im Unterricht zu vermeiden und alternative Aufgabenformate zu entwickeln.
- Die Relevanz der Wortschatzarbeit und die Bedeutung der Semantik im Lateinunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
- Michael Baumann untersucht die Wichtigkeit der Fachdidaktik und die Notwendigkeit, Latein neu zu gestalten, um seine Attraktivität für Schüler zu erhöhen.
- Johanna Trompke plädiert für ein "neu gedachtes" Latein, das neben der Sprache auch Kultur und Geschichte in angemessener Weise integriert.
- Kristina Pflugbeil fasst die Ergebnisse einer Studie zum Schüler-Vorgehen beim selbstständigen Übersetzen aus dem Lateinischen zusammen und zeigt die Bedeutung der Wortbedeutungen im Übersetzungs- und Verstehensprozess.
- Melanie Achtert präsentiert Feedback zum Seminar und beleuchtet die wichtigsten Punkte, die die Teilnehmer aus dem Kurs mitgenommen haben.
- Markus Scholz analysiert die Neuerungen im überarbeiteten Stowasser Wörterbuch und diskutiert seine Relevanz für die heutige Generation von Lernenden.
- Viviane Pietsch berichtet von ihren Beobachtungen auf den Aquilonia 2016 und diskutiert neue Ansätze in der Fachdidaktik und die Bedeutung des Austauschs zwischen Lehrkräften.
- Anna Philina Burmester kritisiert Defizite in gängigen Lehrbüchern und plädiert für eine kritische Nutzung dieser Materialien im Unterricht.
- Susi Voigt stellt die Arbeit mit Wörternetzen im altsprachlichen Unterricht am Beispiel von Prima Nova Lektion 11 vor.
- Anja Behrendt und Matthias Korn analysieren die Entwicklung der Schülerzahlen im Fach Latein und identifizieren die wesentlichen Entwicklungsperspektiven für die Fachdidaktik.
- Matthias Korn bietet eine Zusammenfassung der Inhalte der einzelnen Seminar-Sitzungen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder der Broschüre sind: Fachdidaktik Latein, Entwicklungsperspektiven, Lateinunterricht, Schülerzahlen, Kompetenzen, Rekodierung, Dekodierung, Textverstehen, Wortschatzarbeit, Semantik, Morphosyntax, Lehrbücher, EPA, Leistungserhebung, Bildungsgerechtigkeit, Inklusion.
- Arbeit zitieren
- Dr. Matthias Korn (Herausgeber:in), 2016, Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der lateinischen Fachdidaktik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336219