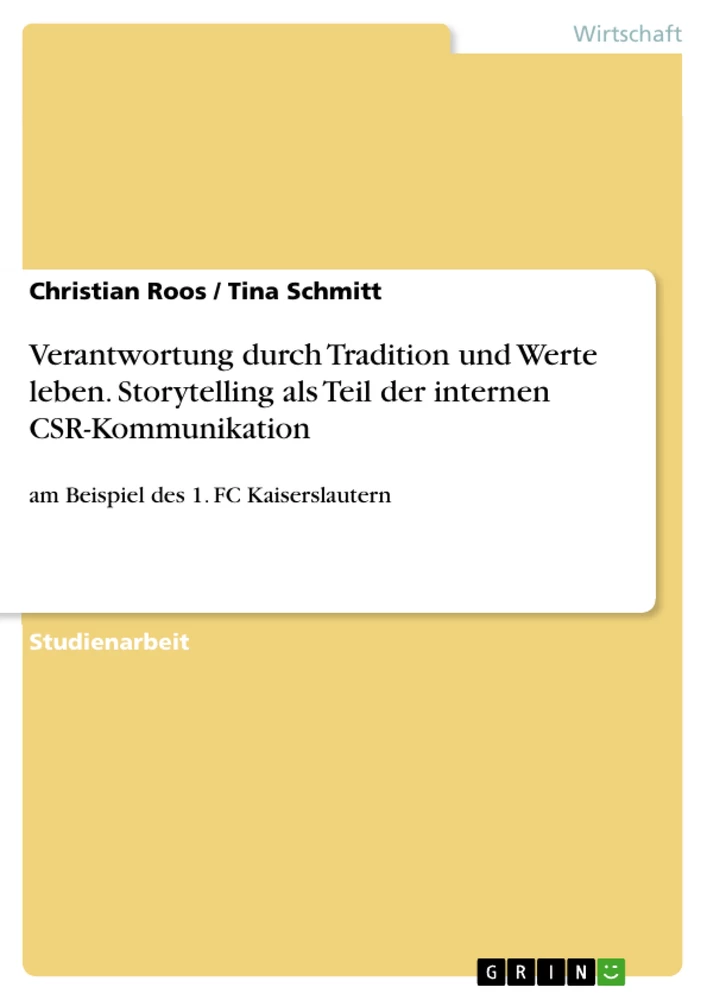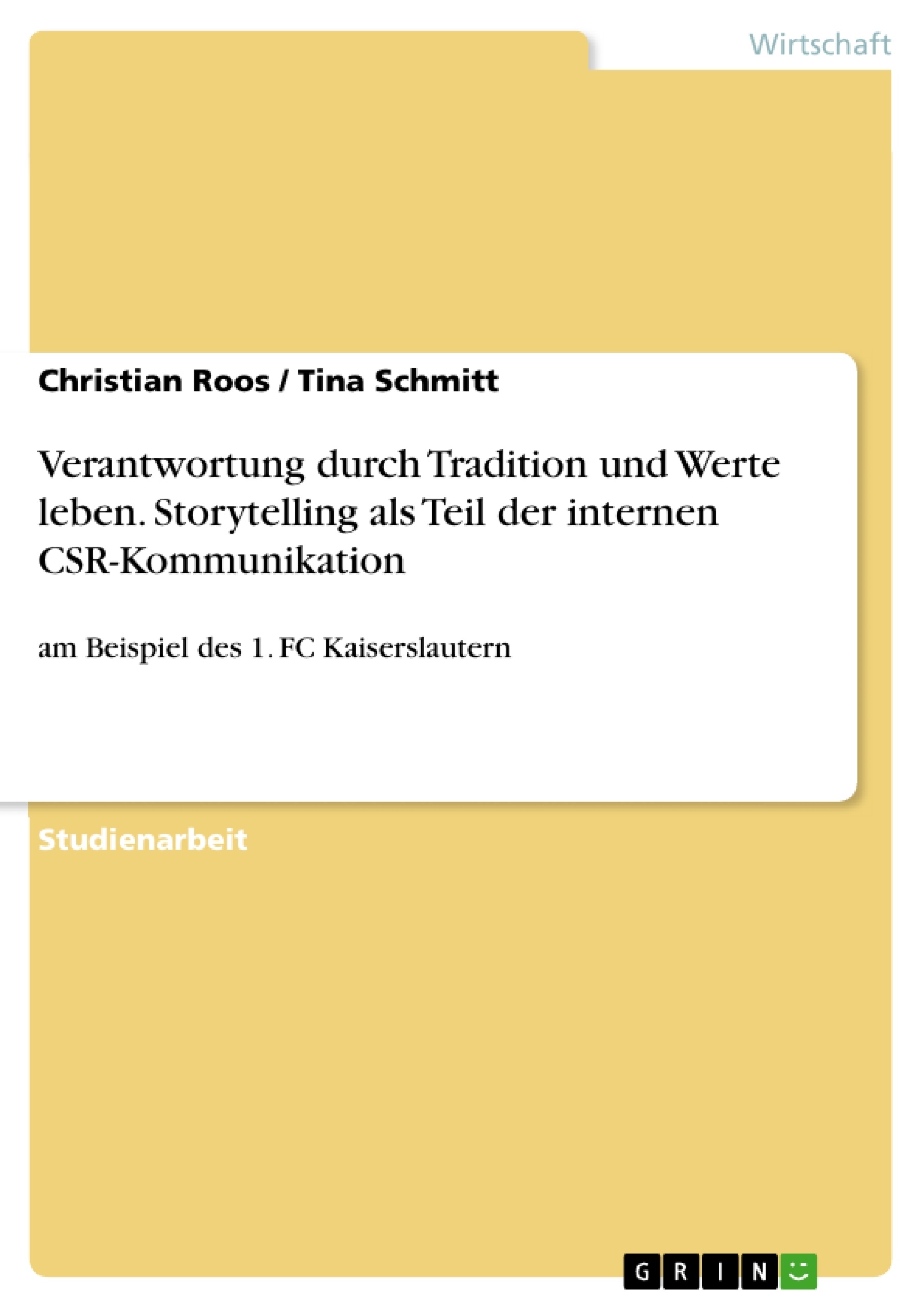Durch den Wertewandel innerhalb der Gesellschaft, den Veränderungen und Krisensituationen im Wirtschaftssystem, neuen Kommunikationsformen und Medien und einem stetig wachsenden Einfluss seitens der Stakeholder verändern sich die Rahmenbedingungen und Organisationen werden dazu gezwungen, proaktiv zu handeln. Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, nachhaltiges Wirtschaften und ein konturenscharfes Wertebild sind deshalb längst mehr als bloße Trends, die von außen gern gesehen werden. Vielmehr sind diese Schlagworte aus strategischer Sicht für Unternehmen und Organisationen unverzichtbare Grundbausteine, um Erfolgspotentiale, Wettbewerbsvorteile sowie Legitimität aufzubauen und zu erhalten. Darüber hinaus soll und muss daraus resultierend auf operativer Ebene wirtschaftlicher Erfolg realisiert werden.
Auch der Sport, insbesondere der in dieser Arbeit fokussierte deutsche Profifußball lebt und fördert aus seiner Tradition heraus die eingangs genannten Werte. In Bezug auf die glaubwürdige Kommunikation spezifischer CSR-Werte erhält die interne CSR-Kommunikation einen wichtigen Stellenwert. Nicht zuletzt deshalb richtet sich der Fokus dieser wissenschaftlichen Betrachtung auf den Einsatz des Storytelling, welchem als strategischem Instrument der internen Wertekommunikation exemplarisch auch im Profifußball eine tragende Rolle widerfährt.
In der Gesamtheit soll die Analyse einen differenzierten Standpunkt zur Thematik der CSR-Kommunikation ermöglichen. U. a. soll dabei exemplarisch dargestellt werden, ob und inwiefern sich Organisationen ausgehend von eigenen gewachsenen Traditionen und Werten sowie mithilfe strategisch verankerter gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme gegenüber ihren Stakeholdern kommunikativ positionieren und damit ihre Legitimitätsgrundlage sichern können. Zudem gilt es zu untersuchen, inwiefern die CSR-Kommunikation ‒ bspw. gemessen an gesellschaftlichen, unternehmerischen, ökologischen, kommunikativen und sozialen Aspekten ‒ die laufenden Wertschöpfungsprozesse und Erfolgspotentiale einer Organisation beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung (CR + TS)
- 2 Grundlagen der CSR-Kommunikation (TS)
- 2.1 Definitorische Annäherung...
- 2.1.1 Begriffsverständnis der CSR und Internen CSR.
- 2.1.2 Werte als Identitätsgrundlage...........
- 2.2 Ziele und Motive der CSR-Kommunikation.......
- 2.3 Zielgruppen und Instrumente der CSR-Kommunikation............
- 2.4 Chancen und Risiken der CSR-Kommunikation.......
- 3 Wertemanagement als Teil der CSR-Kommunikation (CR)..............
- 3.1 Werte und Traditionen als Basis der Identitätsstiftung..
- 3.2 Klassifikation und Funktionen von Unternehmenswerten.......
- 4 Storytelling als Teil der internen CSR-Kommunikation (TS)........
- 4.1 Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten der Wertevermittlung als Grundlage des Storytelling.....
- 4.2 Storytelling als strategisches Instrument der Wertekommunikation
- 5 Gelebtes Storytelling am Beispiel des Traditionsvereins 1. FC Kaiserslautern (CR)....
- 5.1 Bedeutung der CSR-Kommunikation im dt. Profifußball
- 5.2 Die tradierten FCK-Werte als Identitätsbasis.
- 5.2.1 Sportliche und ideelle Identitätskerne als Traditionsverein.......
- 5.2.2 Verankerung des Storytelling in der internen Wertekommunikation ...................
- 5.2.3 Instrumente der CSR- und Heritage-Kommunikation .........
- 6 Fazit (CR + TS)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Storytelling als Teil der internen CSR-Kommunikation am Beispiel des 1. FC Kaiserslautern. Sie analysiert, wie der Verein seine traditionellen Werte und die damit verbundene Identität durch Storytelling strategisch in der internen Kommunikation nutzt, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Die Arbeit beleuchtet dabei den Wandel der Rahmenbedingungen für Unternehmen im Kontext von CSR und den damit verbundenen Herausforderungen für die interne Kommunikation.
- CSR-Kommunikation und deren Bedeutung für Unternehmen im Wandel
- Werte und Traditionen als Grundlage für die Identitätsstiftung im Unternehmen
- Storytelling als strategisches Instrument der internen Wertekommunikation
- Die Rolle des Storytelling im dt. Profifußball am Beispiel des 1. FC Kaiserslautern
- Die Bedeutung der internen CSR-Kommunikation für die Legitimitätsgrundlage von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der CSR-Kommunikation und Storytelling ein und erläutert die Relevanz dieser Themen für Unternehmen im Wandel. Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen der CSR-Kommunikation, definiert den CSR-Begriff und beschreibt Ziele, Motive, Zielgruppen und Instrumente der CSR-Kommunikation. Kapitel 3 widmet sich dem Wertemanagement als Teil der CSR-Kommunikation und analysiert die Bedeutung von Werten und Traditionen für die Identitätsstiftung. Kapitel 4 fokussiert auf das Storytelling als strategisches Instrument der internen Wertekommunikation und untersucht dessen Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten. Kapitel 5 analysiert anhand des Beispiels des 1. FC Kaiserslautern, wie Storytelling im Profifußball gelebt werden kann und beleuchtet die Bedeutung der CSR-Kommunikation im dt. Profifußball.
Schlüsselwörter
CSR-Kommunikation, Interne CSR-Kommunikation, Storytelling, Wertemanagement, Traditionen, Wertevermittlung, Identitätsbildung, Profifußball, 1. FC Kaiserslautern, Stakeholder, Legitimität, Erfolgspotentiale, Wirtschaftlichkeit.
- Quote paper
- Christian Roos (Author), Tina Schmitt (Author), 2014, Verantwortung durch Tradition und Werte leben. Storytelling als Teil der internen CSR-Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336290