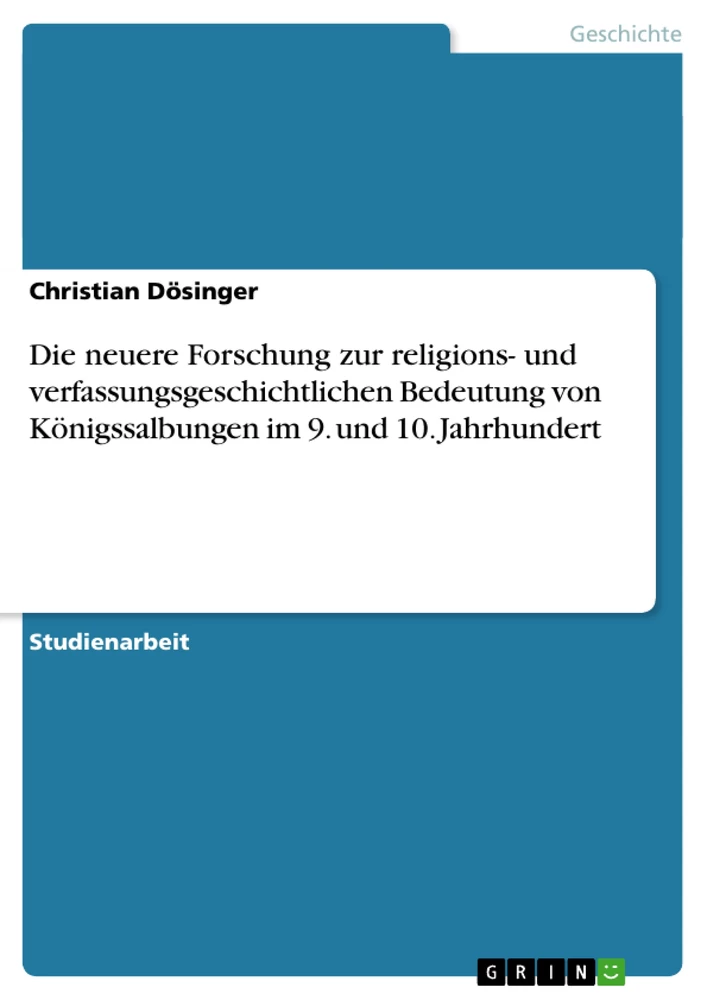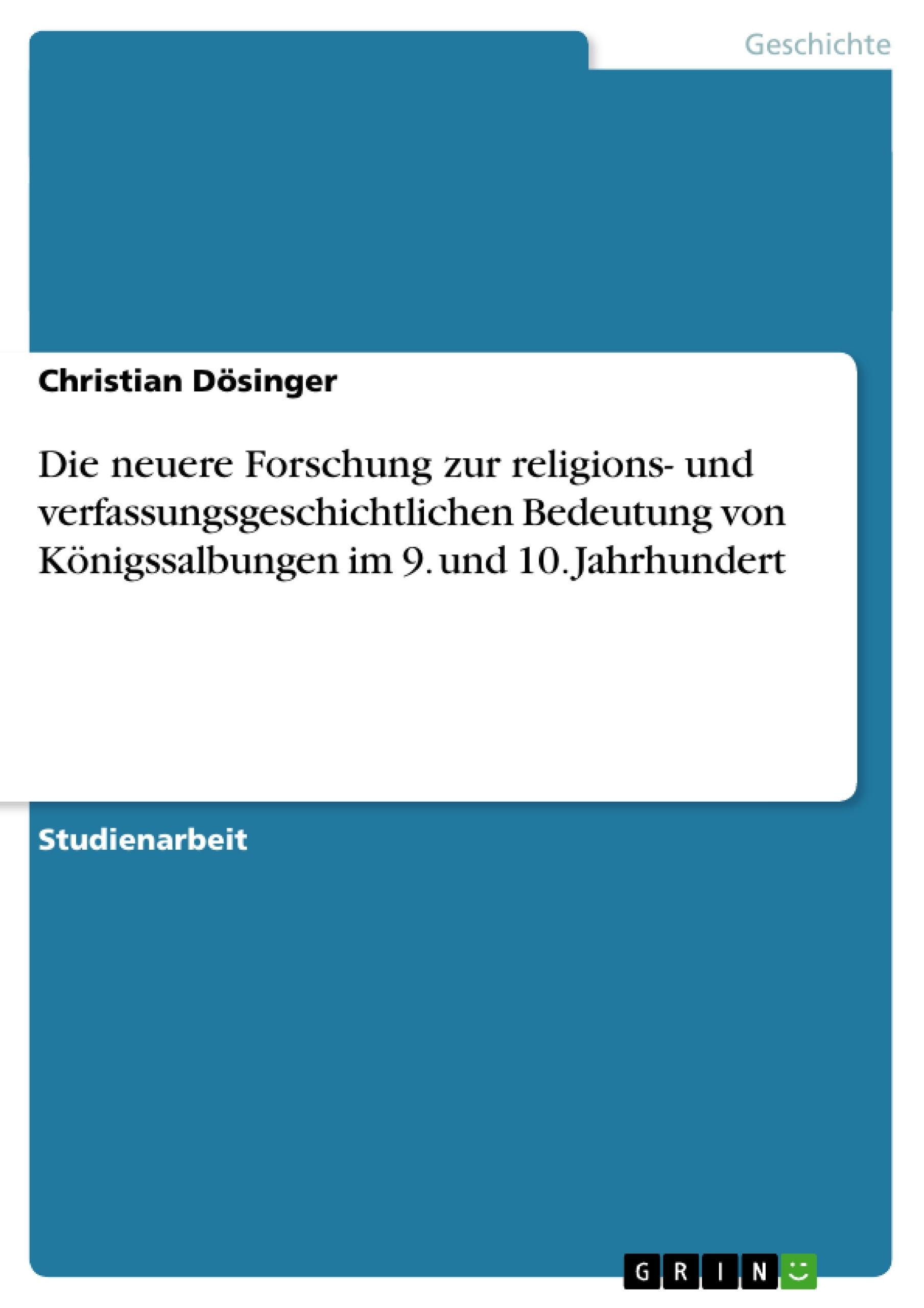Innerhalb dieser Arbeit soll die Bedeutung von Königssalbungen aus religiöser und aus verfassungsrechtlicher Perspektive analysiert werden, wobei eine konkrete Trennung nicht immer ohne Probleme möglich ist, da in der Mediävistik unter Verfassung vielmehr der „Gesamtaufbau der Gesellschaft“ 3 verstanden wird. Innerhalb solcher sozialen Ordnungen gilt es Normen und Ordnungen zu betrachten und die Spannung zwischen Anspruch, den eine Salbung für den Gesalbten König ausdrückt, und Wirklichkeit zu erforschen. Die Vielzahl der in der modernen Forschung herausgearbeiteten Salbungsmotive der Herrscher rufen eine Überschneidung sakraler und verfassungsrechtlicher Beweggründe hervor. Inwieweit dieses Sakrament nicht nur als religiöses, sondern auch als politisches Instrument eingesetzt wurde, soll anhand aktueller Forschungsansätze untersucht werden.
Das Spektrum der Literatur ist besonders auf dem Gebiet des Sakralkönigtums und des Problems verschiedener königlicher Legitimationsgrundlagen reichhaltig. Aufgrund der großen Vielfalt und wissenschaftlichen Ergiebigkeit des Themengebietes kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings keine zeitlich lückenlose Analyse erfolgen. Vielmehr sollen verschiedene Probleme an einzelnen Aspekten und Beispielen in der Forschungsliteratur und in den Quellen untersucht werden. Die Analyse wird sich dabei auf wenige Schwerpunkte konzentrieren und keinesfalls den gesamten Zeitraum des neunten und zehnten Jahrhunderts abdecken, was jedoch dafür eine gründlichere kritische Betrachtung der entsprechenden Darstellungen der neueren Forschung erlaubt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gliederung
- 2. Einleitung
- 3. Legitimation des Herrschers im 9. und 10. Jahrhundert
- 3.1. Die Königssalbung als sakrales und verfassungsrechtliches Kommunikationsmedium
- 3.2. „Rex et sacerdos“ und Gottesstellvertreterschaft
- 3.3. Der Herrscher als oberste Machtinstanz - Königssalbung als verfassungsrechtliches Instrument
- 4. Fazit
- 5. Quellenverzeichnis
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung von Königssalbungen im 9. und 10. Jahrhundert aus religiöser und verfassungsrechtlicher Perspektive. Sie untersucht, ob die Salbung einen entscheidenden Einfluss auf die Legitimation und Position der Herrscher hatte und ob sich im Laufe des untersuchten Zeitraums Veränderungen in ihrer Bedeutung feststellen lassen. Die Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte Aspekte und Beispiele aus der neueren Forschung und den Quellen.
- Die religiöse und verfassungsrechtliche Bedeutung der Königssalbung
- Die Rolle der Salbung in der Herrschaftslegitimation
- Der Vergleich der Bedeutung der Salbung im 9. und 10. Jahrhundert
- Die Analyse der unterschiedlichen Forschungsansätze zum Thema
- Die Untersuchung des Verhältnisses von Sakralität und Politik im Kontext der Königssalbung
Zusammenfassung der Kapitel
2. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die Ablehnung der Königssalbung durch Heinrich I. im Jahr 919 als Ausgangspunkt nimmt. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Königssalbung im 9. und 10. Jahrhundert und untersucht den Einfluss der Salbung auf die religiöse und verfassungsrechtliche Position der Herrscher. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Bedeutung von Königssalbungen aus religiöser und verfassungsrechtlicher Perspektive an, wobei die Schwierigkeit einer strikten Trennung beider Aspekte betont wird. Die Einleitung hebt die Reichhaltigkeit der Literatur zum Thema Sakralkönigtum hervor, schränkt den Umfang der Analyse aber auf ausgewählte Schwerpunkte ein, um eine gründlichere Betrachtung zu ermöglichen.
3. Legitimation des Herrschers im 9. und 10. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die Legitimation des Herrschers im 9. und 10. Jahrhundert im Kontext der Königssalbung. Es beleuchtet die Königssalbung als komplexes Kommunikationsmedium mit sakralen und verfassungsrechtlichen Implikationen. Es analysiert die Verbindung von Königtum und Priestertum („Rex et sacerdos“) sowie die Rolle der Salbung als Instrument der verfassungsrechtlichen Legitimation. Das Kapitel vergleicht unterschiedliche Forschungsansätze zu den Motiven und Funktionen der Königssalbung und diskutiert die Herausforderung, die Bedeutung dieses Rituals für das Verständnis mittelalterlicher Herrschaftspraxis zu erfassen. Die Ausführungen beziehen sich auf die Debatte um die Verbreitung ritueller Handlungen im Frühmittelalter und untersuchen kritisch die Quellenbasis und die Argumentation verschiedener Historiker wie Althoff und Leyser zu diesem Thema. Es wird die Komplexität der Thematik hervorgehoben und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Faktoren betont.
Schlüsselwörter
Königssalbung, Sakralkönigtum, Legitimation, Herrschaftspraxis, Frühmittelalter, Ottonen, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, Religiosität, Verfassung, Ritual, Kommunikationsmedium, Forschungsansätze, Althoff, Leyser.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Legitimation des Herrschers im 9. und 10. Jahrhundert durch Königssalbung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Bedeutung von Königssalbungen im 9. und 10. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der religiösen und verfassungsrechtlichen Perspektive, untersucht den Einfluss der Salbung auf die Legitimation und Position der Herrscher und mögliche Veränderungen im Laufe des Zeitraums.
Welche Aspekte werden im Detail untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die religiöse und verfassungsrechtliche Bedeutung der Königssalbung, ihre Rolle in der Herrschaftslegitimation, einen Vergleich ihrer Bedeutung im 9. und 10. Jahrhundert, verschiedene Forschungsansätze zum Thema und das Verhältnis von Sakralität und Politik im Kontext der Königssalbung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Legitimation des Herrschers im 9. und 10. Jahrhundert, unterteilt in Unterkapitel zur Königssalbung als Kommunikationsmedium, „Rex et sacerdos“, und der Salbung als verfassungsrechtliches Instrument, sowie ein Fazit, Quellen- und Literaturverzeichnis. Die Einleitung behandelt die Ablehnung der Königssalbung durch Heinrich I. und die zentrale Forschungsfrage. Das Hauptkapitel analysiert die Königssalbung als komplexes Kommunikationsmedium mit sakralen und verfassungsrechtlichen Implikationen, beleuchtet verschiedene Forschungsansätze und diskutiert die Herausforderungen bei der Interpretation der Quellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Königssalbung, Sakralkönigtum, Legitimation, Herrschaftspraxis, Frühmittelalter, Ottonen, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, Religiosität, Verfassung, Ritual, Kommunikationsmedium, Forschungsansätze, Althoff, Leyser.
Welche Quellen und Literatur wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die neuere Forschung und Quellen. Genannt werden explizit die Historiker Althoff und Leyser, genaue Quellenangaben befinden sich im Quellen- und Literaturverzeichnis.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Bedeutung der Königssalbung im 9. und 10. Jahrhundert für die religiöse und verfassungsrechtliche Position der Herrscher und der Einfluss der Salbung auf deren Legitimation.
Wie wird die Komplexität der Thematik behandelt?
Die Arbeit betont die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeit einer strikten Trennung zwischen religiösen und verfassungsrechtlichen Aspekten der Königssalbung. Sie berücksichtigt unterschiedliche Forschungsansätze und diskutiert kritisch die Quellenbasis und die Argumentation verschiedener Historiker.
- Citation du texte
- Christian Dösinger (Auteur), 2004, Die neuere Forschung zur religions- und verfassungsgeschichtlichen Bedeutung von Königssalbungen im 9. und 10. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33653