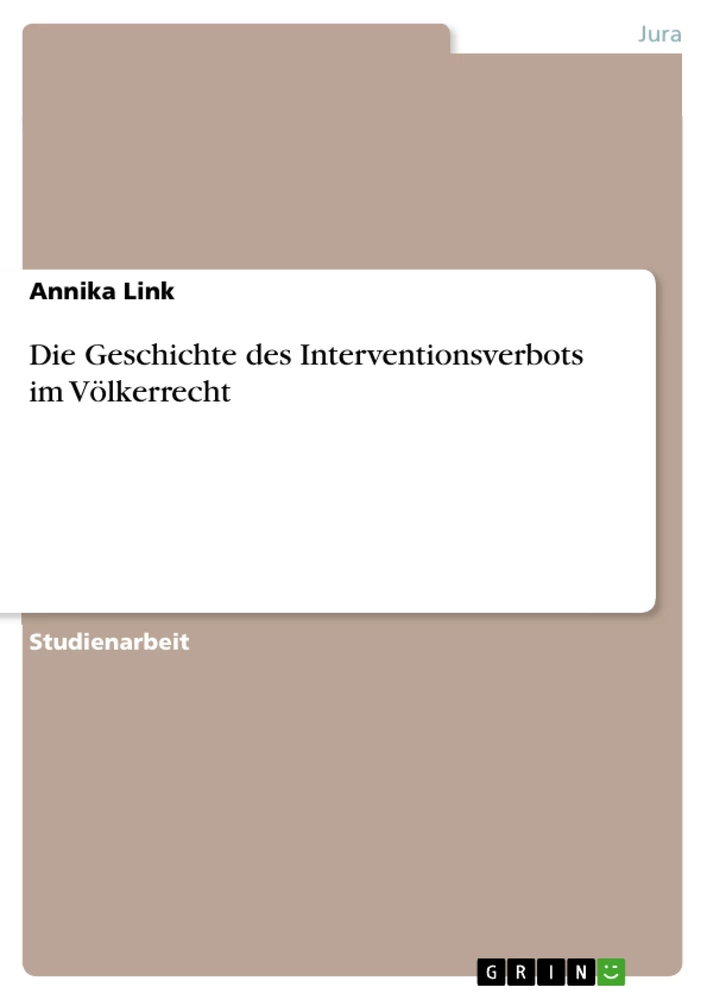In der vorliegenden Arbeit wird die Problematik des Themas anhand der geschichtlichen Entwicklung und der Resolutionspraxis der Vereinten Nationen bis hin zur heutigen Aktualität nahebringend erläutert.
In der vorliegenden Arbeit wird dem erweiterten Interventionsbegriff der Vorrang gegeben, der eine Trennung zwischen rechtmäßiger und rechtswidriger Einflussnahme hervorhebt.
Noch vor über 215 Jahren herrschte die Vorstellung, dass Staaten politische oder wirtschaftliche Zielsetzungen international mit Gewalt, Zwang oder Druck rechtswirksam durchsetzten konnten. Kein Staat musste seine Interessendurchsetzung durch Anwendung von Gewalt oder Druck rechtfertigen.
Inzwischen hat sich das Bild geändert. Die Geschichte des Interventionsverbots zeigt einerseits eine Wandelbarkeit und andererseits eine Beständigkeit des Prinzips. Es fügt sich den Gegebenheiten an, auch wenn bis heute noch kein Katalog erstellt wurde, der ein Interventionsverbot kategorisch festschreiben würde. Der Stellenwert hat demnach nicht an Wert verloren. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Regelung in Form des Interventionsverbots ist inzwischen allgemein anerkannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Interventionsbegriff
- Entwicklung von Gewalt- und Interventionsverbot
- Gewohnheitsrechtlicher Charakter
- Geschichtlicher Überblick
- Entwicklung in Europa: Heilige Allianz
- Entwicklung in Amerika: Monroe-Doktrin
- Zusammenfassung
- Interventionsverbot in der Praxis der Satzungen und Resolutionen
- Satzung und Resolutionspraxis
- Interventionsdeklaration
- Friendly Relation Deklaration
- Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten
- Deklaration über die Unzulässigkeit der Intervention und Einmischung in die inneren Angelegenheiten
- Zusammenfassung
- Satzung und Resolutionspraxis
- Interventionsverbot der Gegenwart
- Gleichgewichtsprinzip
- Zusammenfassung
- Rechtfertigungsgründe im Interventionsverbot
- Intervention auf Einladung
- Ersuchen einer Intervention
- Humanitäre Intervention
- Geschehnisse auf der Krim
- Bewertung der derzeitigen Lage
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte des Interventionsverbots im Völkerrecht. Sie untersucht die Entwicklung des Verbots von der Entstehung bis zur Gegenwart und analysiert die verschiedenen Aspekte des Interventionsverbots, wie z.B. seine rechtlichen Grundlagen, seine praktische Anwendung und seine Bedeutung für die internationale Ordnung.
- Entwicklung des Interventionsverbots im Völkerrecht
- Rechtliche Grundlagen des Interventionsverbots
- Praktische Anwendung des Interventionsverbots
- Bedeutung des Interventionsverbots für die internationale Ordnung
- Rechtfertigungsgründe für Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Interventionsverbots im Völkerrecht ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Interventionsbegriff und seiner Entwicklung. Das dritte Kapitel bietet einen geschichtlichen Überblick über das Interventionsverbot, wobei die Entwicklung in Europa und Amerika im Fokus steht. Das vierte Kapitel analysiert das Interventionsverbot in der Praxis der Satzungen und Resolutionen. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Interventionsverbot der Gegenwart. Das sechste Kapitel behandelt das Gleichgewichtsprinzip. Das siebte Kapitel fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen. Das achte Kapitel analysiert die Rechtfertigungsgründe für Interventionen. Das neunte Kapitel bietet eine abschließende Zusammenfassung der Arbeit.
Schlüsselwörter
Interventionsverbot, Völkerrecht, Gewaltverbot, Gewohnheitsrecht, Heilige Allianz, Monroe-Doktrin, Interventionsdeklaration, Friendly Relation Deklaration, Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, Deklaration über die Unzulässigkeit der Intervention und Einmischung in die inneren Angelegenheiten, Gleichgewichtsprinzip, Rechtfertigungsgründe, Humanitäre Intervention, Einmischung, Souveränität.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Interventionsverbot im Völkerrecht?
Es verbietet Staaten, sich in die inneren und äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates durch Zwang, Gewalt oder Druck einzumischen, um dessen Souveränität zu achten.
Was war die Monroe-Doktrin?
Die Monroe-Doktrin war ein US-politisches Prinzip, das die Einmischung europäischer Mächte in Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents als feindseligen Akt betrachtete.
Gibt es Ausnahmen vom Interventionsverbot?
Ja, anerkannte Ausnahmen sind die Intervention auf Einladung eines Staates, Ersuchen um Hilfe oder in extremen Fällen die humanitäre Intervention zum Schutz von Menschenrechten.
Was ist die „Friendly Relation Deklaration“?
Eine Resolution der UN-Generalversammlung, die die Grundsätze des Völkerrechts, einschließlich des Gewalt- und Interventionsverbots, präzisiert und bekräftigt.
Wie hat sich das Interventionsverbot historisch gewandelt?
Früher galt das Recht des Stärkeren ohne Rechtfertigungszwang. Heute ist das Interventionsverbot allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht und Kernbestandteil der UN-Charta.
- Quote paper
- Annika Link (Author), 2014, Die Geschichte des Interventionsverbots im Völkerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336545