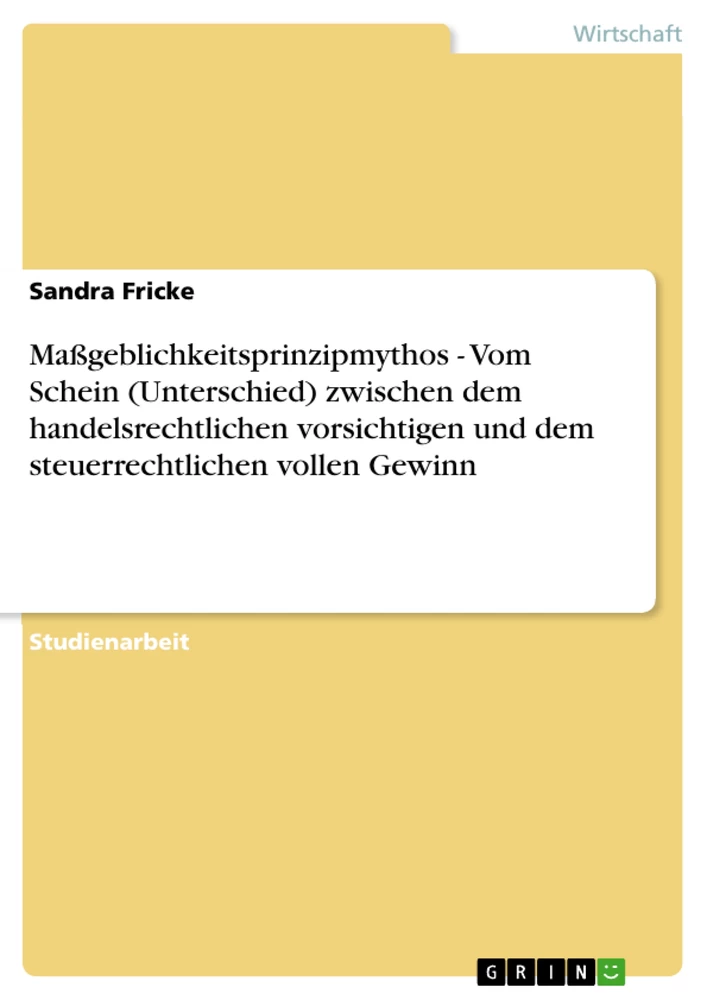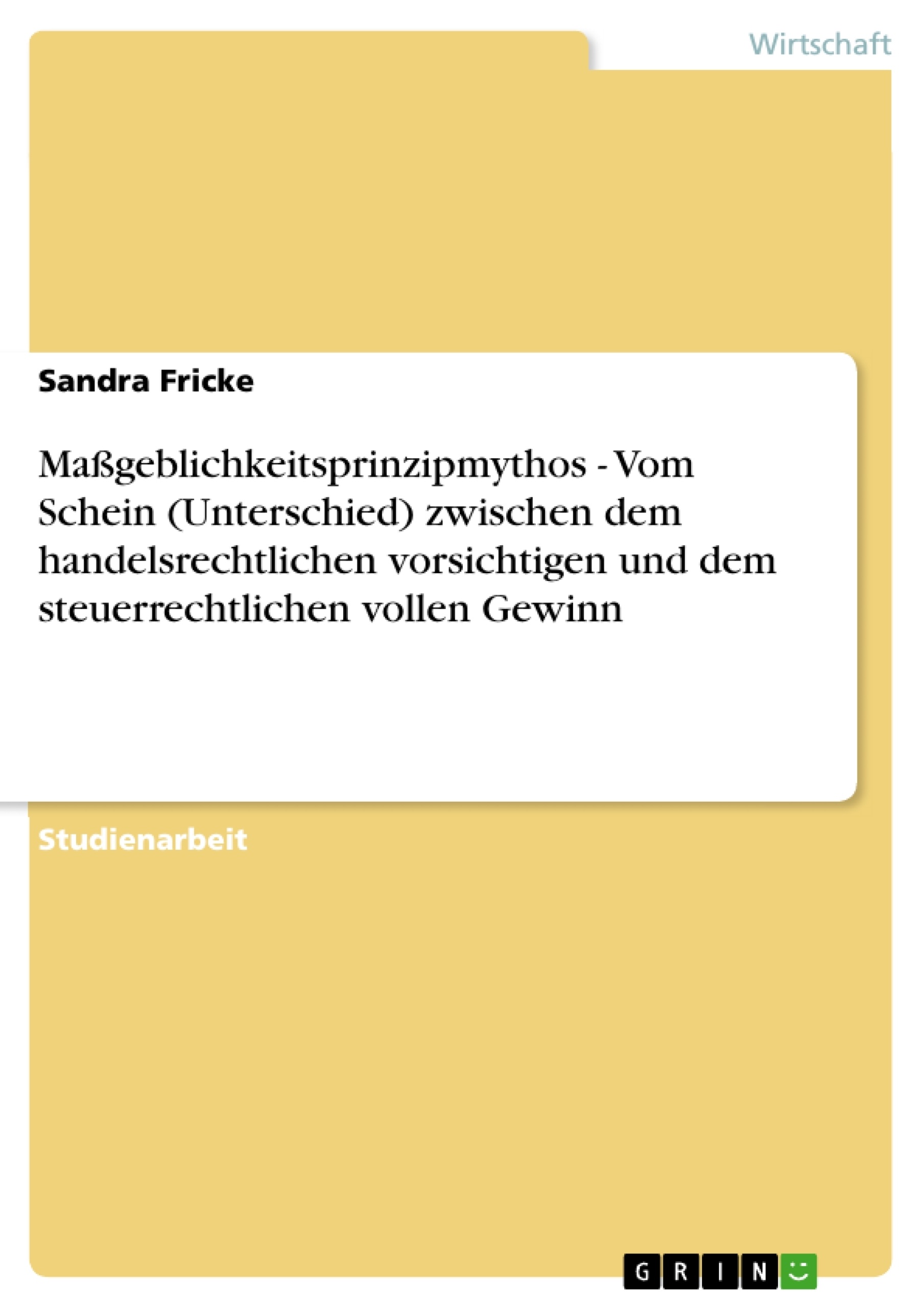Das Verhältnis der Steuerbilanz zum Handelsrecht bestimmt sich nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz (§ 5 EStG), d.h. grundsätzlich nach der Handelsbilanz, vorbehaltlich steuerrechtlicher Sondernormen. Damit wird das handelsrechtliche Gläubigerschutzprinzip in das Steuerrecht integriert. Das in Deutschland gesetzlich verankerte Maßgeblichkeitsprinzip erfährt gegenwärtig durch die Globalisierung der Märkte und die weltweite Angleichung der Rechnungslegungssysteme eine neue Akzentuierung. In jüngster Zeit mehren sich die Stimmen, die eine Abkehr vom Gläubigerschutzprinzip und/oder eine Abkopplung der Steuerbilanz von der Handelsbilanz fordern. Die Befürworter des Prinzips sehen in der Einheitsbilanz die ideale Lösung, die Vereinfachung und Bequemlichkeit bei der Erfüllung der handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegungspflichten sichert. Die Gegner bezeichnen die Maßgeblichkeit als ,,lästige Fessel" für eine je eigenständige Handels- und Steuerbilanzpolitik und verwerfen die Idee der Einheitsbilanz wegen ihrer unterschiedlichen Zwecksetzungen völlig. In diesem Aufsatz wird versucht ein umfassendes Verständnis von Geschichte, Gegenwart und möglicher Zukunft des Maßgeblichkeitsprinzips zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Entwicklung und aktueller Stand der Maßgeblichkeit in Dtl.
- Der Maßgeblichkeitsgrundsatz im einzelnen
- Beachtung der handelsrechtlichen GoB
- Zwingendes Handelsrecht
- Handelsrechtliche Ansatzwahlrechte
- Die Umkehrung des Maßgeblichkeitsprinzips
- Sinn und Zweck der Maßgeblichkeit
- Zweckeignung und Einheit der Rechtsordnung
- These 1: Steuer- und Handelsbilanz haben verschiedene Zwecke und sind somit unvereinbar
- (Anti) These 2: Die Ziele beider Bilanzen sind vereinbar
- Schutzfunktion
- Praktikabilität
- Zweckeignung und Einheit der Rechtsordnung
- Maßgeblichkeitsgrundsatz ohne Zukunft?
- Alternativen zur Maßgeblichkeitsprinzip
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Maßgeblichkeitsprinzip im deutschen Steuerrecht. Sie untersucht die historische Entwicklung des Prinzips, seinen aktuellen Stand und die Diskussion um seine Zukunft. Dabei werden die Argumente für und gegen das Prinzip sowie alternative Rechnungslegungsmodelle beleuchtet.
- Das Verhältnis zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz
- Die Rolle des Gläubigerschutzes im Steuerrecht
- Die Auswirkungen der Globalisierung und der Internationalisierung der Rechnungslegung auf das Maßgeblichkeitsprinzip
- Alternative Rechnungslegungsmodelle
- Die Frage nach der Zukunft des Maßgeblichkeitsprinzips
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und stellt das Maßgeblichkeitsprinzip als zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des Prinzips in Deutschland dargestellt. Das dritte Kapitel untersucht die einzelnen Aspekte des Maßgeblichkeitsgrundsatzes, darunter die Beachtung der handelsrechtlichen GoB, das zwingende Handelsrecht und handelsrechtliche Ansatzwahlrechte. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Umkehrung des Maßgeblichkeitsprinzips. Im fünften Kapitel werden die Sinn und Zweck der Maßgeblichkeit analysiert, inklusive der Frage nach der Vereinbarkeit von Steuer- und Handelsbilanz.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind das Maßgeblichkeitsprinzip, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Gläubigerschutz, Globalisierung, Rechnungslegung, Einheitsbilanz, GoB, § 5 EStG, BiRiLiG.
Häufig gestellte Fragen zum Maßgeblichkeitsprinzip
Was besagt das Maßgeblichkeitsprinzip nach § 5 EStG?
Es besagt, dass die handelsrechtliche Bilanz grundsätzlich maßgeblich für die steuerrechtliche Gewinnermittlung ist, sofern keine speziellen steuerlichen Normen entgegenstehen.
Was ist der Unterschied zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz?
Die Handelsbilanz dient primär dem Gläubigerschutz und der Information, während die Steuerbilanz die Grundlage für eine gerechte Besteuerung bildet.
Warum wird die Maßgeblichkeit heute oft kritisiert?
Durch die Globalisierung und internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) wird das deutsche Prinzip als "lästige Fessel" für eine eigenständige Bilanzpolitik gesehen.
Was bedeutet "Umkehrung der Maßgeblichkeit"?
Dies beschreibt Fälle, in denen steuerrechtliche Wahlrechte zwingend in die Handelsbilanz übernommen werden müssen, um steuerlich anerkannt zu werden.
Was ist das Ziel der Einheitsbilanz?
Das Ziel ist die Vereinfachung, indem eine einzige Bilanz sowohl handelsrechtlichen als auch steuerrechtlichen Anforderungen genügt.
- Quote paper
- Sandra Fricke (Author), 2001, Maßgeblichkeitsprinzipmythos - Vom Schein (Unterschied) zwischen dem handelsrechtlichen vorsichtigen und dem steuerrechtlichen vollen Gewinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3366