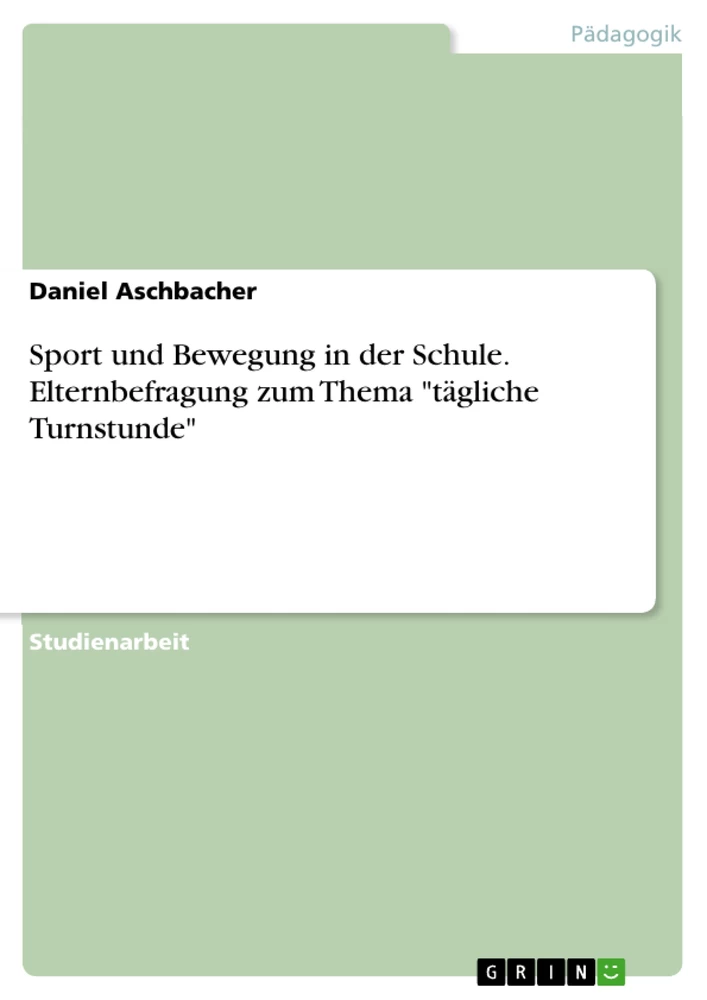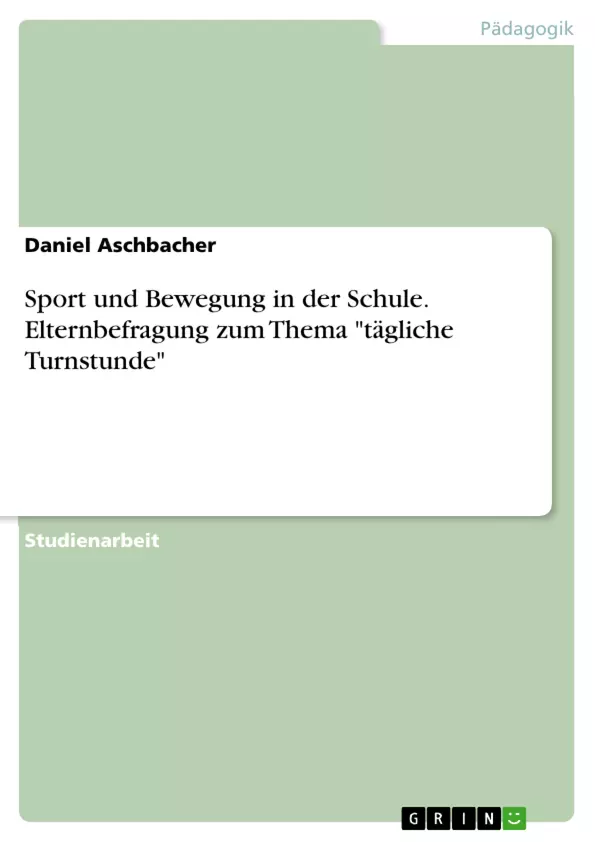Ziel dieser Arbeit ist es, weit weg vom medialen Interesse, den politischen Idealen und anderen pädagogischen Expertenkreisen, die Einstellungen der betroffenen Eltern zu erheben, ob eine tägliche Turnstunde sinnvoll beziehungsweise umsetzbar wäre. Befragt wurden jene Erziehungsberechtigten, deren Sprösslinge momentan die Oberstufe besuchen. Die Elternteile stellen aus Sicht der Umsetzung einen wichtigen Stellenwert dieser Initiative dar. Daher sind diese Akteure im Fokus dieser Arbeit, da sie zum Teil in der medialen Diskussion weitgehend vernachlässigt wurden.
Kinder und Jugendliche verbringen heutzutage ihre Schulzeit zu häufig im Sitzen. Im Gegensatz zur Vermittlung von theoretischem Wissen nimmt Sport und Bewegung in der Schule oft nur eine sekundäre Stellung ein. Aus dem Gesundheitsbericht der WHO geht hervor, dass sich ein Großteil der Bevölkerung der Industriestaaten im Alltag und in der Freizeit zu wenig bewegt. Nur mehr 28 % der Kinder und Jugendlichen in Österreich betreiben Sport. Dies sind 25% der Mädchen und 33% der Burschen. Zudem sind 28 % der Buben und 25 % der Mädchen zwischen 6 und 18 Jahren übergewichtig oder fettleibig. 40 % der Kinder mit Symptomen der Fettleibigkeit im Alter von 7 Jahren weisen diese auch als Erwachsene auf. Mangelnde Bewegung ist die Ursache für viele chronische Krankheitsbilder.
Der Sportunterricht sollte somit einen wichtigen Stellenwert im Schulleben einnehmen. Dort können laut Hartmann nicht nur Stress und Aggressionen abgebaut werden, sondern gilt es heute zusätzlich als gesichert, dass sich sportliche Aktivität auch positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt, wie bereits im Jahre 2000 in einem Modellversuch „Tägliche Sportstunde“ von Klaus Bös und Frank Obst die Auswirkungen von einer täglichen Sportstunde bei Grundschülern untersucht wurde. Dementsprechend sollte der Schulsport ein wichtiger Ausgleich im Schulalltag sein, sowohl im Sinne einer motorischen Leistungsverbesserung, der Gesundheit, des Sozialverhaltens und darüber hinaus der positiven Auswirkungen auf das Selbstkonzept, als auch in Bezug auf eine Verbesserung der allgemeinen schulischen Leistung der Kinder und Jugendlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Aktueller Forschungsstand
- 1.3 Grundgedanke und Legitimation der täglichen Turnstunde
- 2. Empirische Erhebung
- 2.1 Methodik
- 2.1.1 Datenerhebung
- 2.1.2 Stichprobe
- 2.1.3 Auswertung
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Teilnehmer/Schulen
- 3.2 Alter der befragten Elternteile
- 3.3 Höchste abgeschlossene Ausbildungen der befragten Elternteile
- 3.4 Informationsquellen der befragten Elternteile
- 3.5 Befürwortung tägliche Turnstunde
- 3.6 Mehrwerte tägliche Turnstunde
- 3.7 Umsetzbarkeit tägliche Turnstunde
- 3.8 Auswirkungen der täglichen Turnstunde
- 3.9 Wichtigkeit, dass Kind Sport betreibt
- 3.10 Sportausübung in der Freizeit
- 4. Diskussion
- 4.1 Limitation
- 4.2 Schlussfolgerung
- 5. Zusammenfassung/Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob eine tägliche Turnstunde in österreichischen Schulen sinnvoll und notwendig ist. Dazu wurden Eltern von Schülern befragt, um ihre Meinung und Einstellung zu diesem Thema zu erfassen. Die Arbeit analysiert die Ergebnisse der Befragung und diskutiert die Relevanz einer täglichen Turnstunde im Hinblick auf die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
- Bedeutung von Bewegung und Sport für die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Aktuelle Situation des Sportunterrichts in Österreich
- Elternmeinung zur Einführung einer täglichen Turnstunde
- Potenzielle Auswirkungen einer täglichen Turnstunde auf die schulische Leistung und das Sozialverhalten von Kindern
- Mögliche Herausforderungen und Chancen der Implementierung einer täglichen Turnstunde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit dar, beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und begründet die Notwendigkeit einer täglichen Turnstunde. Kapitel 2 beschreibt die empirische Erhebungsmethode, inklusive Datenerhebung, Stichprobe und Auswertung. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Befragung, unterteilt in verschiedene Kategorien, wie z.B. Teilnehmer/Schulen, Alter der Eltern, Ausbildungsgrad der Eltern, Informationsquellen der Eltern, Befürwortung der täglichen Turnstunde, Mehrwerte der täglichen Turnstunde, Umsetzbarkeit der täglichen Turnstunde, Auswirkungen der täglichen Turnstunde, Wichtigkeit, dass Kind Sport betreibt und Sportausübung in der Freizeit. Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse der Befragung und beleuchtet mögliche Limitationen der Studie. Die Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Tägliche Turnstunde, Bewegung, Sportunterricht, Gesundheit, Entwicklung, Elternmeinung, Schulische Leistung, Sozialverhalten, Implementierung, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen
Warum fordern Experten eine „tägliche Turnstunde“ in Schulen?
Aufgrund steigender Zahlen von Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern sowie den positiven Effekten von Sport auf die kognitive Leistungsfähigkeit.
Wie stehen Eltern zur Einführung einer täglichen Sportstunde?
Die Studie untersucht die Einstellungen von Eltern von Oberstufenschülern, um deren Befürwortung und Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit zu erfassen.
Welche gesundheitlichen Vorteile hat regelmäßiger Schulsport?
Sport hilft beim Abbau von Stress und Aggressionen, verbessert die motorischen Fähigkeiten und beugt chronischen Krankheiten wie Adipositas vor.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Sport und schulischer Leistung?
Ja, Modellversuche zeigen, dass sich tägliche Bewegung positiv auf die Konzentration und die allgemeine schulische Leistungsfähigkeit auswirkt.
Was sind die größten Hürden für die Umsetzung der täglichen Turnstunde?
Oft scheitert die Umsetzung an fehlenden Raumkapazitäten, organisatorischen Problemen im Stundenplan oder mangelnden personellen Ressourcen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Aschbacher (Autor:in), 2013, Sport und Bewegung in der Schule. Elternbefragung zum Thema "tägliche Turnstunde", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336760