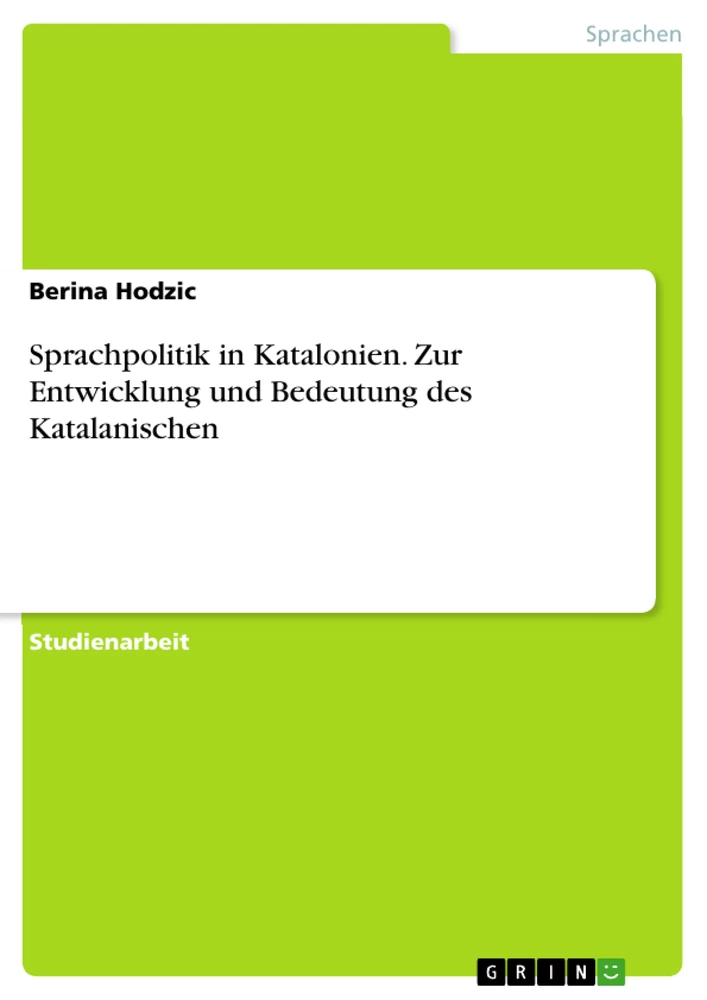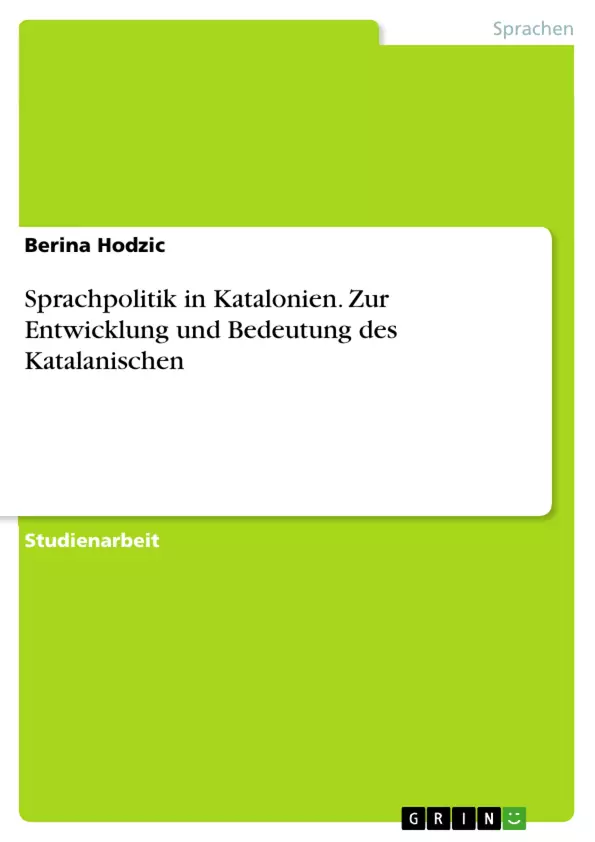Nicht nur beim Bau der traditionellen Castells ist der Zusammenhalt der Katalanen stark. Auch beim Erhalt und der Verteidigung der eigenen Sprache beweisen sie Durchhaltevermögen und gelten als Sinnbild für eine selbstbewusste Gemeinschaft, die mit großem Stolz ihre Sprache und Kultur vertritt. Nach jahrelanger Unterdrückung und dem Kampf um Eigenständigkeit hat sich das Katalanische heute durchgesetzt und ist ein wichtiges Element der katalanischen Identität geworden. Wie es jedoch zur sprachlichen Normalisierung gekommen ist, welche Bedeutung die Sprache für die Katalanen im Laufe ihrer Entwicklung und Ausbreitung eingenommen hat und inwiefern die Sprachpolitik in öffentlichen Bereichen Kataloniens umgesetzt wird bzw. werden kann, wird im Rahmen dieser Seminararbeit dargestellt. Der Umfang der Arbeit wird, bis auf wenige Ausnahmen in den Kapiteln sieben und acht, auf die autonome Gemeinschaft Kataloniens begrenzt.
Zunächst wird mithilfe der Werke von Germán Colón (1989) und Karl-Heinz Röntgen (2000) ein kurzer Überblick über das Verbreitungsgebiet, sowie die Sprachgeschichte des Katalanischen gegeben. Daran anknüpfend wird die Sprachpolitik nach dem Franquismus beschrieben, wobei im Anschluss zusätzlich der kooffizielle Status des Katalanischen und die notwendigen gesetzlichen Erweiterungen erörtert werden. Wichtigste Orientierung hierbei geben Christian H. Münchs „Sprachpolitik und gesellschaftliche Alphabetisierung“ (2006), sowie auch die spanischen Gesetzestexte.
Kapitel fünf stützt sich auf Carsten Sinners Arbeit (1996) und zeigt in welchem Ausmaß Katalanisch das Kastilische beeinflusst. Dazu werden wesentliche Eigenschaften in den Bereichen der Aussprache, Morphosyntax und Lexik erarbeitet. Anschließend wird anhand von Emili Boix-Fusters „Language and identity in Catalonia“ (2008) das Verhältnis von Sprache und Identität erklärt, um somit ihre Bedeutung für das katalanische Volk zu unterstreichen.
Der letzte Teil der Arbeit widmet sich der Präsenz des Katalanischen in den Bereichen der Medien und des Schulwesens. Hierzu wird primär das öffentlich zugängliche Material der Generalitat de Catalunya, sowie die „Sprachgesetzgebung in Katalonien“ von Thomas Gergen (2000) verwendet. Das letzte Kapitel wird um eine Diskussion zu den aktuellen Problemen der Sprachregelungen in der Schule erweitert. Den Abschluss der Seminararbeit bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbreitungsgebiet des Katalanischen
- Die katalanische Sprachgeschichte
- Sprachpolitik in Katalonien ab 1975
- Kooffizialität
- Das Spanische in Katalonien
- Aussprache
- Morphosyntax
- Lexik
- Katalanisch als Identitätsstifter
- Katalanisch in den Medien
- Katalanisch im Schulwesen
- Umsetzung der Regelungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung und Bedeutung des Katalanischen in den katalanischsprachigen Regionen Spaniens, insbesondere Kataloniens. Sie beleuchtet die Sprachgeschichte, die Sprachpolitik nach dem Franquismus und die Rolle des Katalanischen als Identitätsstifter. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Spanischen auf das Katalanische sowie die Präsenz der Sprache in den Medien und im Schulwesen analysiert.
- Entwicklung und Bedeutung des Katalanischen
- Sprachpolitik in Katalonien nach dem Franquismus
- Katalanisch als Identitätsstifter
- Einfluss des Spanischen auf das Katalanische
- Katalanisch in den Medien und im Schulwesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Arbeit und erläutert die Bedeutung des Katalanischen für die katalanische Identität. Kapitel zwei beschreibt das Verbreitungsgebiet des Katalanischen und gibt einen kurzen Überblick über die Anzahl der Sprecher. Kapitel drei beleuchtet die Geschichte der katalanischen Sprache von der römischen Eroberung bis zum Ende des Franquismus. Kapitel vier behandelt die Sprachpolitik in Katalonien nach 1975, insbesondere den kooffiziellen Status des Katalanischen. Kapitel fünf analysiert den Einfluss des Spanischen auf das Katalanische in den Bereichen Aussprache, Morphosyntax und Lexik. Kapitel sechs untersucht das Verhältnis von Sprache und Identität in Katalonien und unterstreicht die Bedeutung des Katalanischen als Identitätsstifter. Kapitel sieben und acht behandeln die Präsenz des Katalanischen in den Medien und im Schulwesen.
Schlüsselwörter
Katalanisch, Sprachgeschichte, Sprachpolitik, Identität, Kooffizialität, Spanisch, Medien, Schulwesen, Katalonien, Franquismus.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Status hat die katalanische Sprache heute?
Katalanisch ist in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien kooffiziell neben Kastilisch (Spanisch) und wird in Schulen und Behörden aktiv genutzt.
Wie beeinflusste der Franquismus die katalanische Sprache?
Unter der Diktatur Francos wurde das Katalanische in der Öffentlichkeit unterdrückt und aus dem Bildungswesen verbannt, was den Widerstand und Stolz der Katalanen stärkte.
Was bedeutet "sprachliche Normalisierung"?
Es bezeichnet den Prozess, das Katalanische wieder zur gewöhnlichen Sprache in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens (Medien, Schule, Verwaltung) zu machen.
Welche Rolle spielt die Sprache für die katalanische Identität?
Die Sprache ist das wichtigste Element der kulturellen Identität und dient als verbindendes Merkmal der selbstbewussten Gemeinschaft.
Wie wird Katalanisch im Schulsystem umgesetzt?
Es herrscht ein Immersionsmodell, bei dem Katalanisch die primäre Unterrichtssprache ist, um sicherzustellen, dass alle Schüler beide Sprachen beherrschen.
- Quote paper
- Berina Hodzic (Author), 2016, Sprachpolitik in Katalonien. Zur Entwicklung und Bedeutung des Katalanischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336790