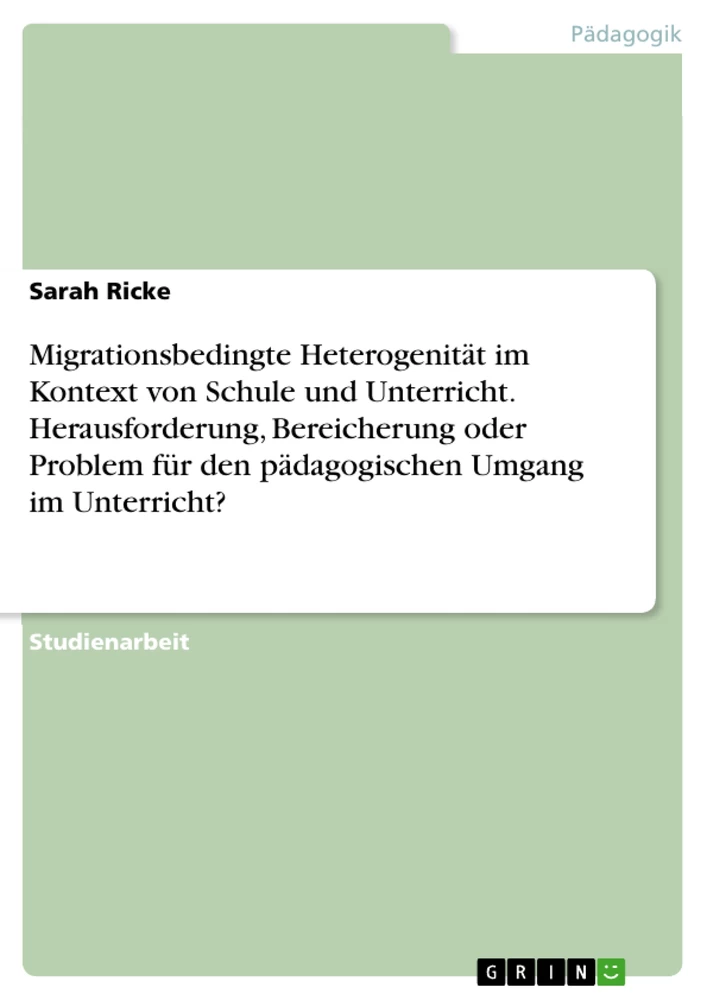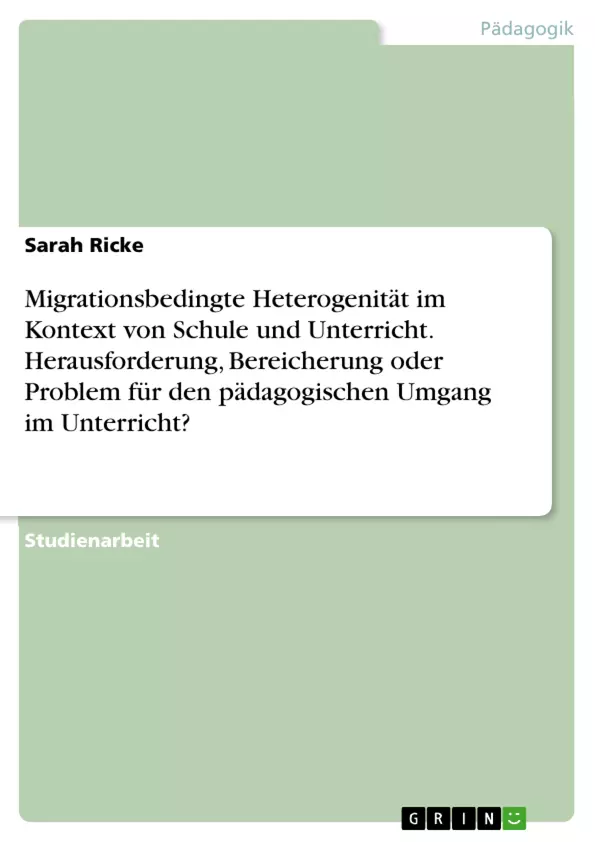Durch Entwicklungen wie Globalisierung, zunehmende Migrationsbewegungen und gesellschaftliche Individualisierungsprozesse leben wir in einer multikulturellen Gesellschaft und das Bewusstsein darüber ist gegenwärtig sehr ausgeprägt. Damit steigt natürlich auch die Anzahl von Schüler und Schülerinnen (im Weiteren als SuS abgekürzt) mit Migrationshintergrund in den Klassen der Schulen. Dass diese Unterschiedlichkeit von Kindern in Lerngruppen Schule und Unterricht vor eine Herausforderung stellt, ist keinesfalls neu. Doch eine Vorstellung davon, was das konkret für den schulischen Unterricht und einer konstruktiven Umsetzung bedeutet, ist weiterhin nur schwach vorhanden.
Das belegen die Ergebnisse von internationalen Vergleichsstudien (wie PISA, TIMSS), in denen das deutsche Schulsystem erhebliche Defizite im Umgang mit Heterogenität aufweist und der enorme Abstand in Bildungserfolg- und leistung von SuS mit Migrationshintergrund im Vergleich zu deutschen SuS alarmiert. Diese Befunde gelten als zentraler Anlass für umfangreiche Kritik am deutschen Schulsystem, das nach wie vor auf die Homogenität von SuS im Unterricht ausgelegt ist und mit seinem traditionell dominierenden passiven und substitutiven Umgang der wachsenden Heterogenität nicht gerecht werden kann. Zudem wirkt auch die Ausprägung der pädagogischen Sicht als Anlass, die individuellen Lernvoraussetzungen und Persönlichkeiten von SuS stärker wahrzunehmen und durch diese Subjektorientierung bestmöglich zu fördern. Dies zeigt sich in der zunehmenden Verbreitung von konstruktivistischer Lerntheorie und Didaktik im Lehrerhandeln und der Konzipierung von Unterricht.
Folglich wird eine neue pädagogische Haltung eingefordert, die Heterogenität von SuS nicht länger ignoriert oder gar als Belastung wahrnimmt, sondern die damit verbundenen Chancen erkennt und auch zu nutzen weiß. Wie diese Forderungen und Erwartungen aber von Lehrpersonen als pädagogische Akteure im Unterricht umgesetzt werden als auch umgesetzt werden können, welche Aspekte in Lehrerhandeln für das Gelingen bzw. Misslingen im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität eine Rolle spielen, damit soll sich in dieser Hausarbeit auseinandergesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG: Wachsende migrationsbedingte Heterogenität als Herausforderung für Schule und Unterricht
- 2. PROBLEMFELD: Migrationsbedingte Heterogenität im Kontext von Schule und Unterricht
- 2.1. Begriffliche Annäherung: migrationsbedingte Heterogenität
- 2.2. Entwicklungen, Differenzen und Erklärungsansätze
- 3. HANDLUNGSFELD UNTERRICHT: Pädagogischer Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität
- 3.1. Pädagogischer Umgang im Unterricht und Forschungsbefunde.
- 3.2. Reflexionshilfen für Lehrpersonen zu ausgewählten Problembereichen im Unterricht
- 4. FAZIT: Vom Wollen zum Können im pädagogischen Umgang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität im schulischen Kontext. Sie untersucht die Herausforderungen, die diese Heterogenität für Schule und Unterricht mit sich bringt, und beleuchtet gleichzeitig die Chancen, die in dieser Vielfalt liegen. Das Ziel ist es, den pädagogischen Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität zu reflektieren und Wege aufzuzeigen, wie die Lernvoraussetzungen und Persönlichkeiten aller Schülerinnen und Schüler optimal gefördert werden können.
- Migrationsbedingte Heterogenität als Herausforderung und Chance für Schule und Unterricht
- Begriffliche Klärung von migrationsbedingter Heterogenität und ihre Bedeutung im schulischen Kontext
- Entwicklungen, Differenzen und Erklärungsansätze im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität
- Pädagogische Handlungsmöglichkeiten und Forschungsbefunde im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität
- Reflexionshilfen für Lehrpersonen im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der migrationsbedingten Heterogenität in Schule und Unterricht ein. Sie beleuchtet die wachsende kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft und die Herausforderungen, die dies für das deutsche Schulsystem darstellt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Problemfeld der migrationsbedingten Heterogenität. Es analysiert den Begriff und die in Zusammenhang stehenden Termini wie Kultur und soziale Milieus im Hinblick auf bildungsrelevante Zusammenhänge. Im dritten Kapitel wird das Handlungsfeld Unterricht betrachtet. Es werden pädagogische Ansätze im Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität vorgestellt und Forschungsbefunde aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Migrationsbedingte Heterogenität, Schule, Unterricht, pädagogischer Umgang, kulturelle Vielfalt, soziale Milieus, Differenz, Zugehörigkeit, Forschungsbefunde, Lehrkräfte, Bildungschancen, Inklusion, Interkulturelle Kompetenz.
- Quote paper
- Sarah Ricke (Author), 2015, Migrationsbedingte Heterogenität im Kontext von Schule und Unterricht. Herausforderung, Bereicherung oder Problem für den pädagogischen Umgang im Unterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336804