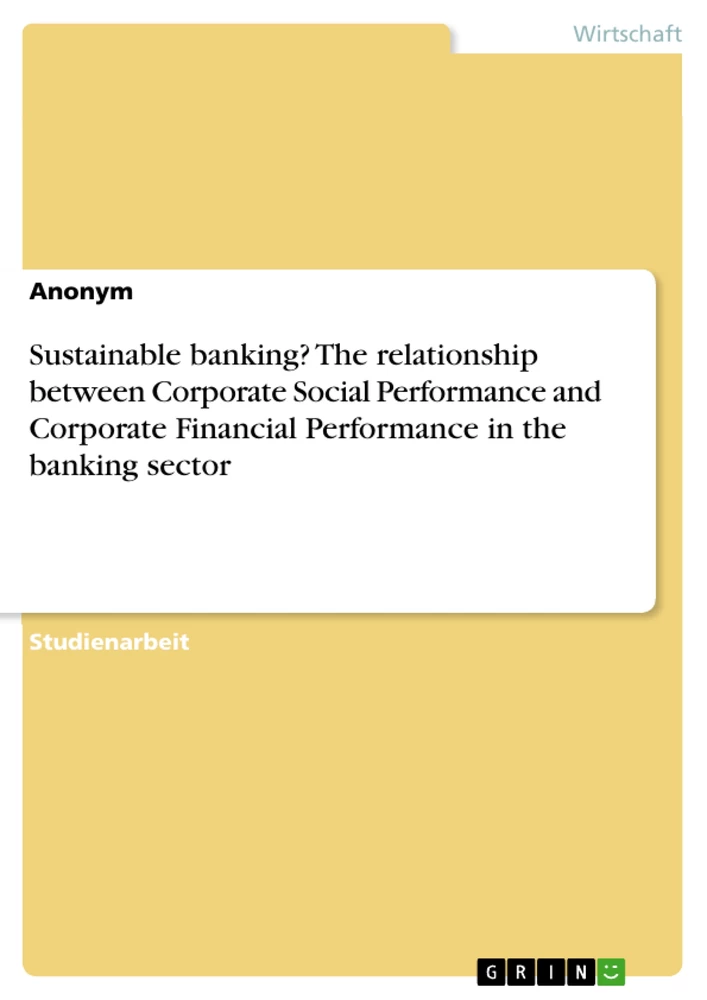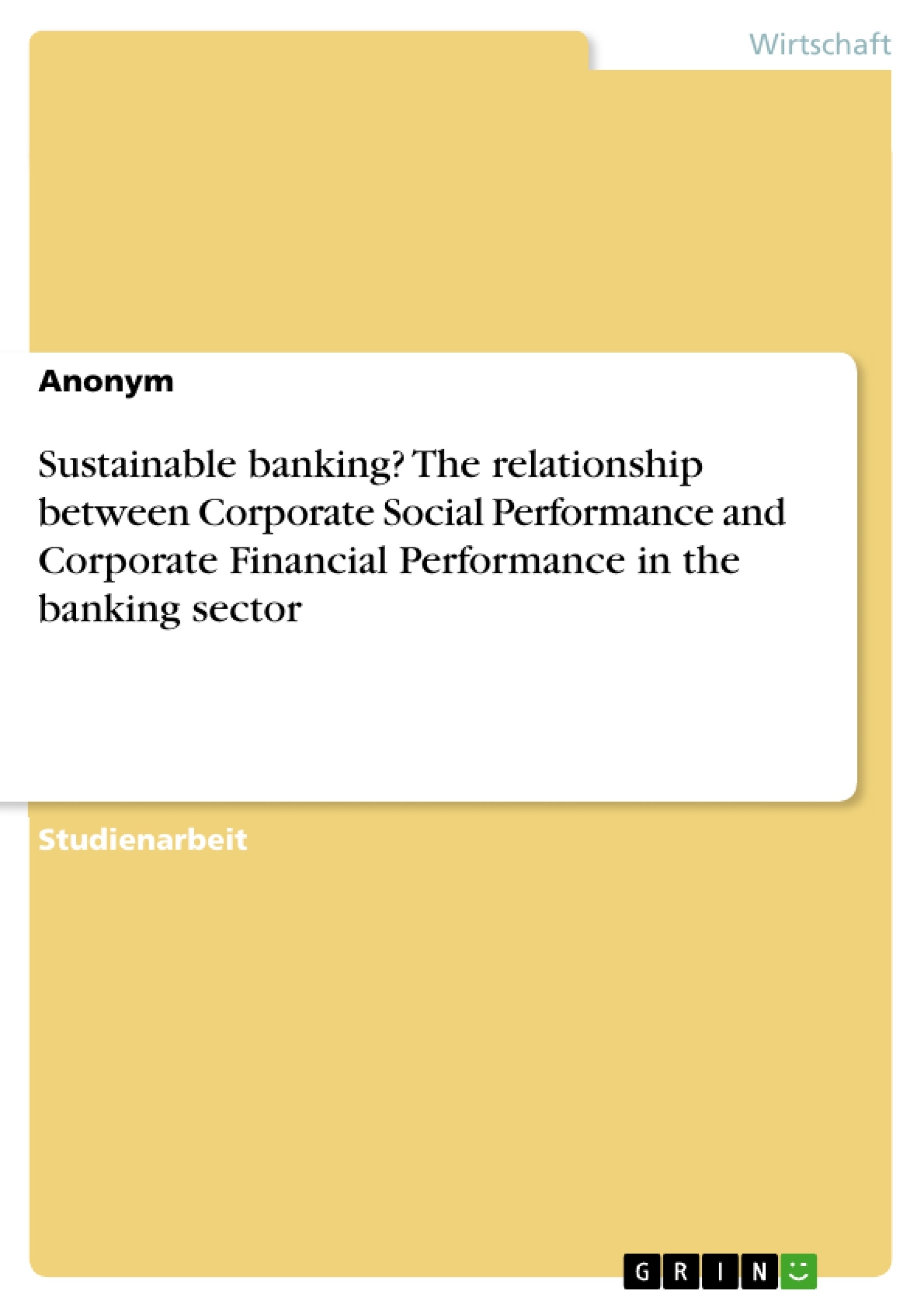Diese Seminararbeit widmet sich der Frage, welche Auswirkungen sich aus dem gesellschaftlichen Engagement von Banken auf den finanziellen Erfolg ergeben. Um die Beziehung zwischen der gesellschaftlichen und finanziellen Performance zu untersuchen, wird zunächst in Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen eingegangen. Anschließend werden in Kapitel 3 mögliche Beziehungen zwischen den zwei zu untersuchenden Variablen erläutert. Darauf aufbauend werden in Kapitel 4 und 5 die Messansätze vorgestellt, die zur Messung der gesellschaftlichen Engagements und des Unternehmenserfolges herangezogen werden. In Kapitel 6 folgen beispielhafte Studien, die bis dato die Beziehung zwischen CSP und CFP untersucht haben.
Noch vor einigen Jahren hielten Banken an dem Anhaltspunkt fest, dass ihre Tätigkeiten aus ethischer Sicht nicht relevant sind und die Geschäfte den Shareholder-Value maximieren und sich allein an die Gesetze der Finanzmathematik halten müssen. Es wurde der Standpunkt vertreten, dass durch die Rationalität der Marktteilnehmer/innen und die volle Offenlegung der Vertragsbedingungen keine Ausrichtung der Banken an ethischen Kriterien wie Fairness erforderlich ist.
Die Forderung nach einer Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung hat seit den letzten Jahren, vor allem der Finanzkrise, jedoch stark zugenommen. Durch die Globalisierung der Märkte und den Wunsch der Gesellschaft nach mehr Übernahme an Verantwortung sind Banken einem enormen Druck ausgesetzt CSR auszuüben und somit nach den gesellschaftlichen Werten und Normen zu handeln.
Dem CSR-Konzept liegt der Gedanke zu Grunde, dass Banken jenseits der ökonomischen Dimension zur Übernahme von Verantwortung für Herausforderungen verpflichtet sind, da sie eine zunehmenden Gestaltungsmacht und Größe aufweisen und „wo es ein großes Maß an Einfluss und Macht gibt, muss es auch ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein und moralischem Bewusstsein geben, weil Macht selbst ein moralisches oder ethisches Phänomen ist.“ Die öffentliche Forderung nach einer Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung der Banken wird in der Literatur kontrovers diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporate Social Responsibility
- Definition
- Das Konzept nach Carroll
- Anwendungsgebiete im Bankensektor
- Mögliche Beziehungen zwischen CSP und CFP
- Negative Beziehung
- Positive Beziehung
- Gemischte Beziehung
- Keine Beziehung
- Die Messung der gesellschaftlichen Performance
- Messansätze
- Inhaltsanalysen
- Fragebogenerhebungen
- Reputationsanalysen
- Eindimensionale Indikatoren
- Ethische Ratings (Multidimensionale Indikatoren)
- Die Messung der finanziellen Performance
- Messansätze
- Marktbasierte Bewertung
- Buchhaltungsbasierte Bewertung
- Beurteilung der Beziehung zwischen CSP und CFP auf Grundlage empirischer Ergebnisse
- Durchgeführte Studien
- Beurteilung der Studien
- Stichprobenanalyse
- Ergebnisse der Stichprobenanalyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Corporate Social Performance (CSP) und Corporate Financial Performance (CFP) im Bankensektor. Ziel ist es, die verschiedenen theoretischen Ansätze und empirischen Erkenntnisse zu dieser Thematik zusammenzufassen und zu analysieren. Dabei werden die verschiedenen Messmethoden für CSP und CFP sowie die unterschiedlichen Modelle der Beziehung zwischen den beiden Variablen beleuchtet.
- Definition und Konzept von Corporate Social Responsibility (CSR)
- Mögliche Beziehungen zwischen CSP und CFP
- Messung von CSP und CFP
- Empirische Studien zur Beziehung zwischen CSP und CFP
- Bewertung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Seminararbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Das Kapitel "Corporate Social Responsibility" definiert den Begriff CSR und stellt verschiedene Konzepte, insbesondere das von Carroll, vor. Es werden auch Anwendungsgebiete von CSR im Bankensektor aufgezeigt. Das Kapitel "Mögliche Beziehungen zwischen CSP und CFP" diskutiert verschiedene theoretische Ansätze zur Beziehung zwischen CSP und CFP, wie die negative, positive, gemischte und keine Beziehung. Die Kapitel "Die Messung der gesellschaftlichen Performance" und "Die Messung der finanziellen Performance" befassen sich mit den verschiedenen Methoden zur Messung von CSP und CFP. Das Kapitel "Beurteilung der Beziehung zwischen CSP und CFP auf Grundlage empirischer Ergebnisse" analysiert verschiedene empirische Studien und bewertet deren Ergebnisse. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Seminararbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance, Corporate Financial Performance, Bankensektor, Nachhaltigkeit, Ethik, ethische Ratings, empirische Studien, Messung, Beziehung, Stakeholder.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet CSP und CFP im Bankensektor?
CSP steht für Corporate Social Performance (gesellschaftliche Leistung) und CFP für Corporate Financial Performance (finanzieller Erfolg). Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen beiden.
Gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Gewinn bei Banken?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Modelle: positive, negative, gemischte oder gar keine Beziehungen. Empirische Studien liefern hierzu unterschiedliche Ergebnisse.
Wie wird die gesellschaftliche Performance (CSP) gemessen?
Zur Messung werden Inhaltsanalysen von Berichten, Reputationsanalysen, Fragebögen und multidimensionale Indikatoren wie ethische Ratings herangezogen.
Wie hat die Finanzkrise die Sicht auf CSR bei Banken verändert?
Seit der Krise ist der gesellschaftliche Druck auf Banken enorm gestiegen, Verantwortung über die reine Gewinnmaximierung (Shareholder-Value) hinaus zu übernehmen und ethische Kriterien einzuhalten.
Welche Rolle spielt das CSR-Konzept von Carroll in dieser Arbeit?
Carrolls Konzept dient als theoretische Grundlage, um die verschiedenen Ebenen der Verantwortung (ökonomisch, rechtlich, ethisch und philanthropisch) im Bankensektor einzuordnen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Sustainable banking? The relationship between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance in the banking sector, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336838