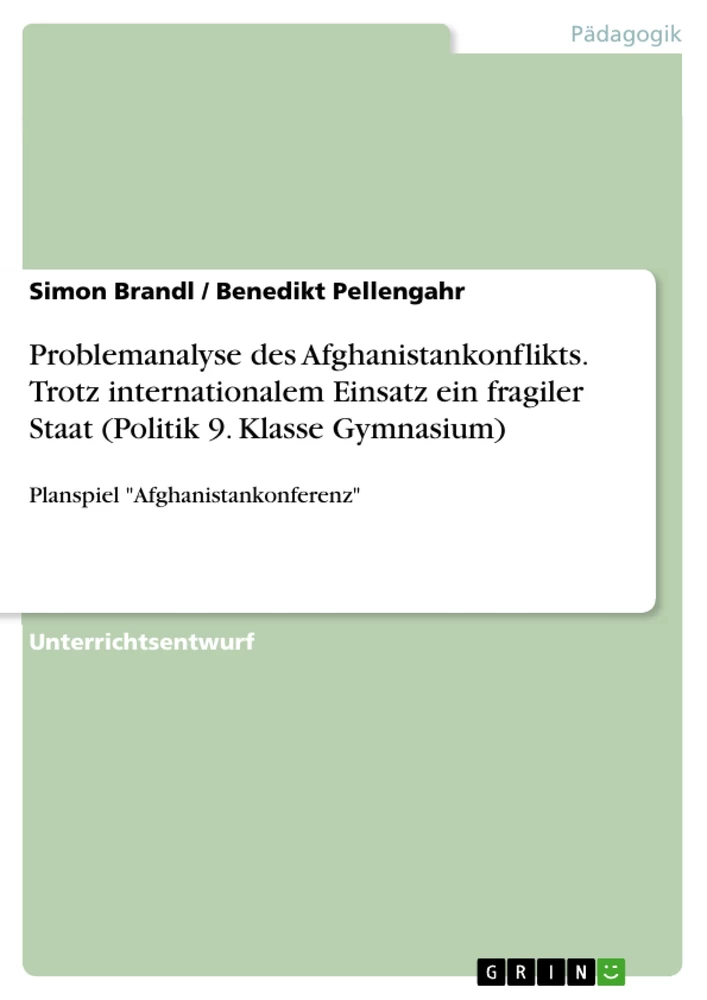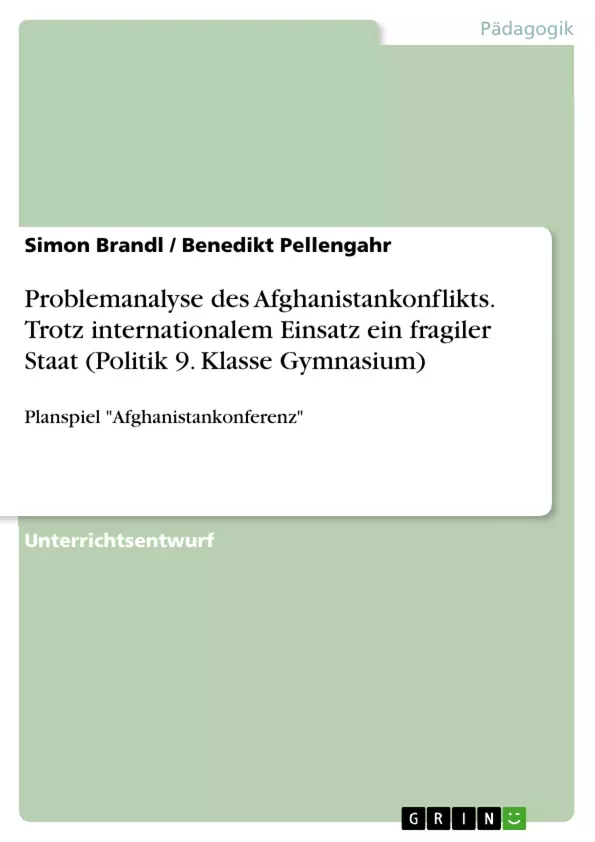Der Titel der sich über zwölf Unterrichtsstunden erstreckenden Unterrichtseinheit lautet „Afghanistan: Trotz internationalem Einsatz ein fragiler Staat”. Die dazugehörige Leitkompetenz unserer Unterrichtseinheit gestaltet sich wie folgt: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die Schwäche des afghanischen Zentralstaats als zentrales Element des Afghanistankonfliktes zu identifizieren und zu beurteilen, inwieweit eine Konsensbildung unter ausschlaggebenden Akteuren zu einer Lösung des Problems beitragen könnte. Speziell wird das Thema anhand des Planspiels „Afghanistankonferenz“ erarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werkstück 1| Die Lernvoraussetzungen: Lerngruppe & Kompetenzen (Simon Brandl)
- 1. Schritt I - Beschreibung der Lerngruppe
- 2. Schritt II – Förderung von Kompetenzbereichen
- 3. Schritt III - Reflexion des Werkstücks
- Werkstück 2| Afghanistan – Eine kategoriale Sachanalyse (Benedikt Pellengahr)
- 4. Schritt I - Die kategoriale Sachanalyse
- 4.1. Grundlagen einer kategorialen Sachanalyse nach Henkenborg
- 4.2. Der Afghanistankonflikt: Eine kategoriale Sachanalyse
- 4.2.1. Dimension Handeln: Akteure, Interessen & Knappheit
- 4.2.2. Dimension Prozesse: Gewordenheit & Öffentlichkeit
- 4.2.3. Dimension System: Macht & Herrschaft, Recht und Institutionen
- 4.2.4. Dimension Sinn: Deutungsmuster & Gemeinwohl
- 5. Schritt II – Gegenüberstellung von Lernenden und Fachwissenschaft
- 6. Schritt III - Reflexion des Werkstücks
- 4. Schritt I - Die kategoriale Sachanalyse
- Werkstück 3| Lernweg: Strukturierung von Lernprozess & Inhalten (Simon Brandl)
- 7. Schritt I: Die aspektorientierte Strukturierung des Themas anhand eines Lernwegs
- 8. Schritt II – Konkretisierung der Unterrichtseinheit
- 9. Schritt III - Reflexion des Werkstücks
- Werkstück 4| Übersicht zur Unterrichtseinheit
- 10. Lernschritte & Inhaltskompetenzen
- Werkstück 5| Planung einer Einzelstunde (Benedikt Pellengahr)
- 11. Schritt I – Unterrichtsentwurf einer Einzelstunde
- 11.1. Verlauf: 9. Unterrichtsstunde der Unterrichtseinheit
- 11.2. Didaktisches Konzept der 9. Unterrichtsstunde
- 12. Schritt II – Reflexion des Werkstücks
- 11. Schritt I – Unterrichtsentwurf einer Einzelstunde
- Werkstück 6| Reflexion von Seminar & eigenem Lernprozess
- 13. Schritt I-Gesamtreflexion durch Benedikt Pellengahr
- 14. Schritt II - Gesamtreflexion durch Simon Brandl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Portfolio dokumentiert den kooperativen Arbeitsprozess und dessen Ergebnisse im Seminar "Unterricht im Fach 'Politik und Wirtschaft' – Konzeption und Gestaltung". Es fokussiert den Afghanistankonflikt und entwickelt eine Unterrichtseinheit dazu. Die Arbeit gliedert sich in Werkstücke, die jeweils von einem Autor verantwortet werden, aber in Kooperation entstehen.
- Analyse der Lernvoraussetzungen einer Lerngruppe
- Kategoriale Sachanalyse des Afghanistankonflikts
- Entwicklung eines Lernwegs für die Unterrichtseinheit
- Konkrete Planung einer Einzelstunde
- Reflexion des Arbeitsprozesses und des Seminars
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung des Portfolios, welches den kooperativen Arbeitsprozess im Seminar "Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft" dokumentiert. Es wird der Fokus auf den Afghanistankonflikt gelegt, der aufgrund seiner Komplexität eine inhaltliche Schwerpunktsetzung erfordert. Das Portfolio gliedert sich in einzelne Werkstücke, die jeweils von einem der Autoren verantwortet werden und eine detaillierte fachdidaktische Konzeption einer Unterrichtseinheit darstellen. Die einzelnen Werkstücke bauen aufeinander auf, beginnend mit der Analyse der Lernvoraussetzungen bis hin zur Planung einer Einzelstunde und der abschließenden Reflexion des gesamten Prozesses.
Werkstück 1| Die Lernvoraussetzungen: Lerngruppe & Kompetenzen: Dieses Werkstück, verfasst von Simon Brandl, analysiert die Lernvoraussetzungen der Lerngruppe. Es beschreibt die Lerngruppe anhand von Videosequenzen und Diagnoseergebnissen, wobei das Politikbewusstsein der Schüler im Kontext Krieg und Frieden untersucht wird. Das Werkstück identifiziert die Stärken und Schwächen der Lerngruppe und benennt die Kompetenzen, die im Unterricht besonders gefördert werden sollten. Die Analyse berücksichtigt die Heterogenität der Lerngruppe und das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrer.
Werkstück 2| Afghanistan – Eine kategoriale Sachanalyse: Benedikt Pellengahr führt in diesem Werkstück eine kategoriale Sachanalyse des Afghanistankonflikts durch. Aufbauend auf den Grundlagen der kategorialen Sachanalyse nach Henkenborg werden die Dimensionen Handeln (Akteure, Interessen, Knappheit), Prozesse (Gewordenheit, Öffentlichkeit), System (Macht, Herrschaft, Recht und Institutionen) und Sinn (Deutungsmuster, Gemeinwohl) analysiert. Die Analyse beleuchtet die komplexen Zusammenhänge des Konflikts und liefert eine fachwissenschaftliche Grundlage für die Entwicklung der Unterrichtseinheit.
Werkstück 3| Lernweg: Strukturierung von Lernprozess & Inhalten: Simon Brandl strukturiert in diesem Werkstück den Lernprozess anhand eines aspektorientierten Lernwegs. Dieser Lernweg integriert die Ergebnisse der vorherigen Analysen und konkretisiert die Inhalte der Unterrichtseinheit. Das Werkstück beschreibt den geplanten Ablauf des Lernprozesses und legt die didaktischen Schwerpunkte fest. Es verbindet die theoretischen Überlegungen mit der praktischen Umsetzung im Unterricht.
Werkstück 4| Übersicht zur Unterrichtseinheit: Dieses Werkstück bietet eine Zusammenfassung der Lernschritte und Inhaltskompetenzen der gesamten Unterrichtseinheit. Es liefert einen Überblick über den gesamten Lernprozess und die zu vermittelnden Inhalte. Es dient als Orientierungshilfe und stellt die Verbindung zwischen den einzelnen Werkstücken her.
Werkstück 5| Planung einer Einzelstunde: Benedikt Pellengahr plant in diesem Werkstück detailliert eine Einzelstunde der Unterrichtseinheit. Der Entwurf umfasst den Verlauf der Stunde, das didaktische Konzept und die methodischen Entscheidungen. Es wird auf die spezifischen Bedürfnisse der Lerngruppe und die Ergebnisse der vorherigen Analysen eingegangen. Die Planung zeigt die praktische Anwendung der entwickelten Konzepte.
Schlüsselwörter
Afghanistankonflikt, kategoriale Sachanalyse, Politikbewusstsein, Lernvoraussetzungen, Unterrichtseinheit, fachdidaktische Konzeption, Lernweg, Kompetenzförderung, Unterrichtsplanung.
Häufig gestellte Fragen zum Portfolio "Unterricht im Fach 'Politik und Wirtschaft'"
Was ist das Thema des Portfolios?
Das Portfolio dokumentiert den kooperativen Arbeitsprozess und dessen Ergebnisse im Seminar "Unterricht im Fach 'Politik und Wirtschaft' – Konzeption und Gestaltung". Es fokussiert den Afghanistankonflikt und entwickelt eine vollständige Unterrichtseinheit dazu.
Welche Werkstücke beinhaltet das Portfolio?
Das Portfolio gliedert sich in sechs Werkstücke. Werkstück 1 analysiert die Lernvoraussetzungen einer Lerngruppe. Werkstück 2 beinhaltet eine kategoriale Sachanalyse des Afghanistankonflikts. Werkstück 3 entwickelt einen Lernweg für die Unterrichtseinheit. Werkstück 4 bietet eine Übersicht zur gesamten Unterrichtseinheit. Werkstück 5 plant detailliert eine Einzelstunde. Werkstück 6 reflektiert den Seminar- und den eigenen Lernprozess.
Wer sind die Autoren des Portfolios?
Das Portfolio wurde kooperativ von Simon Brandl und Benedikt Pellengahr verfasst. Die einzelnen Werkstücke werden jeweils von einem der Autoren verantwortet.
Welche Methoden werden im Portfolio verwendet?
Das Portfolio verwendet verschiedene Methoden, darunter die Analyse von Lernvoraussetzungen, die kategoriale Sachanalyse nach Henkenborg, die Entwicklung eines aspektorientierten Lernwegs und die detaillierte Planung einer Einzelstunde. Es werden Videosequenzen und Diagnoseergebnisse zur Analyse der Lerngruppe herangezogen.
Welche Aspekte des Afghanistankonflikts werden analysiert?
Die kategoriale Sachanalyse des Afghanistankonflikts untersucht die Dimensionen Handeln (Akteure, Interessen, Knappheit), Prozesse (Gewordenheit, Öffentlichkeit), System (Macht, Herrschaft, Recht und Institutionen) und Sinn (Deutungsmuster, Gemeinwohl).
Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?
Die Unterrichtseinheit ist modular aufgebaut und gliedert sich in verschiedene Lernschritte und Inhaltskompetenzen. Der Ablauf des Lernprozesses und die didaktischen Schwerpunkte sind detailliert beschrieben.
Welche Kompetenzen werden in der Unterrichtseinheit gefördert?
Die Unterrichtseinheit zielt auf die Förderung verschiedener Kompetenzen ab, die im Werkstück 1 im Kontext der Analyse der Lernvoraussetzungen der Lerngruppe identifiziert werden. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Afghanistankonflikts und der Entwicklung kritischer Denkfähigkeiten.
Wie wird der Lernprozess reflektiert?
Der Lernprozess wird sowohl im Rahmen der einzelnen Werkstücke als auch in einem abschließenden Kapitel reflektiert, welches Gesamtreflexionen von beiden Autoren beinhaltet. Die Reflexion umfasst den kooperativen Arbeitsprozess und den individuellen Lernfortschritt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Portfolio?
Schlüsselwörter sind: Afghanistankonflikt, kategoriale Sachanalyse, Politikbewusstsein, Lernvoraussetzungen, Unterrichtseinheit, fachdidaktische Konzeption, Lernweg, Kompetenzförderung, Unterrichtsplanung.
Wozu dient dieses Portfolio?
Das Portfolio dient der Dokumentation eines kooperativen Arbeitsprozesses im Rahmen eines Seminars zum Thema "Unterricht im Fach Politik und Wirtschaft". Es zeigt die Entwicklung einer kompletten Unterrichtseinheit zum Afghanistankonflikt, von der Analyse der Lernvoraussetzungen bis zur Planung einer konkreten Unterrichtsstunde.
- Arbeit zitieren
- Simon Brandl (Autor:in), Benedikt Pellengahr (Autor:in), 2015, Problemanalyse des Afghanistankonflikts. Trotz internationalem Einsatz ein fragiler Staat (Politik 9. Klasse Gymnasium), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337196