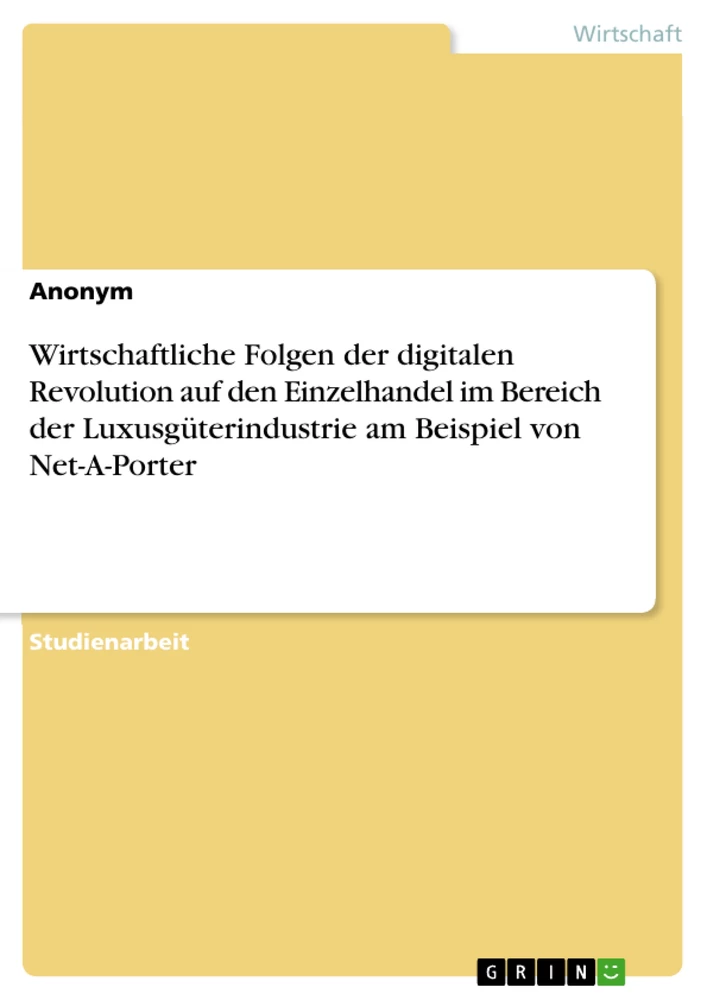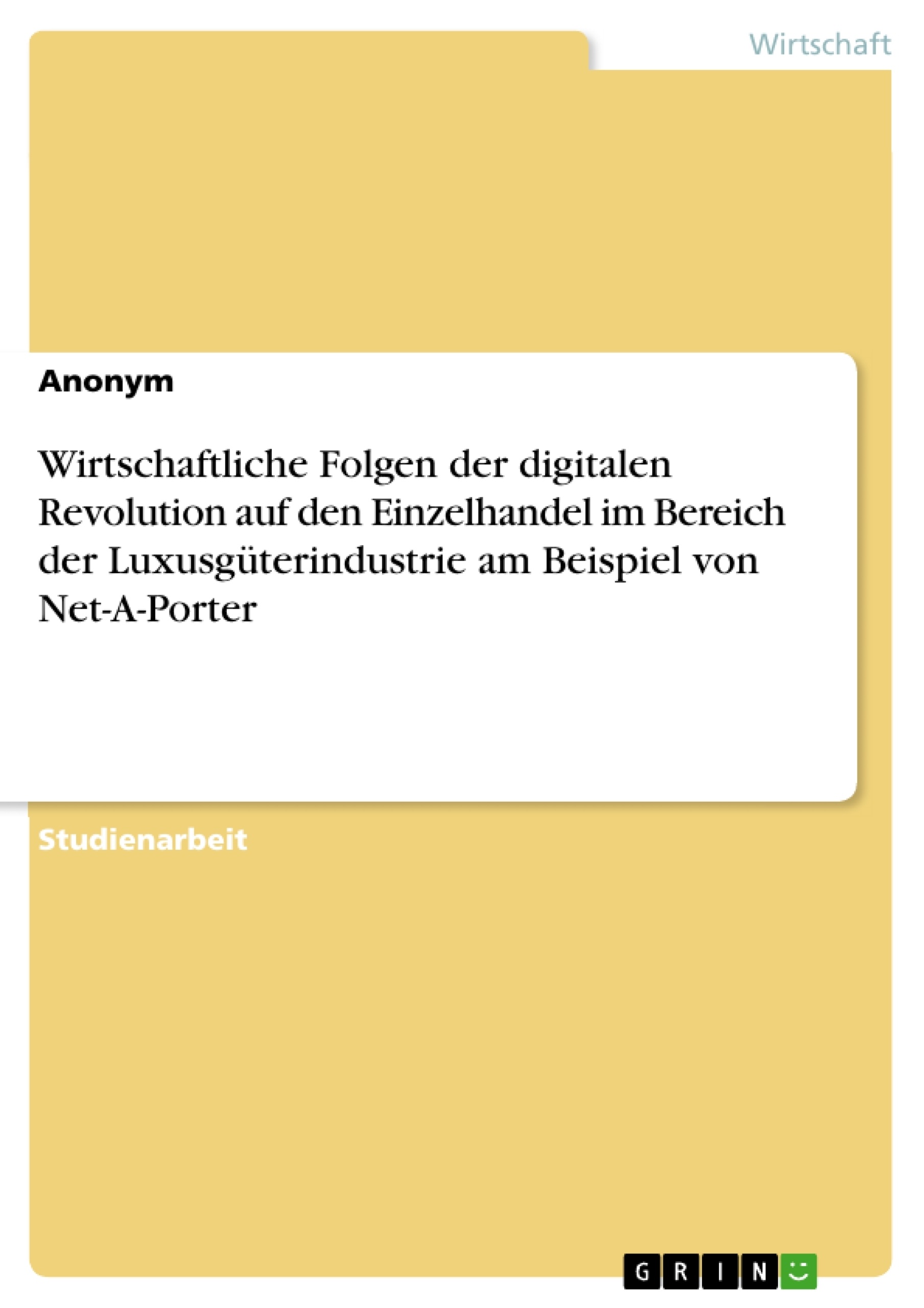Ziel dieser Arbeit ist es, die wirtschaftlichen Folgen des digitalen Wandels für den Einzelhandel im Bereich der Luxusgüter sowie die Bedeutung des Online-Handels am Beispiel von Net-A-Porter näher zu beleuchten. Basis hierzu stellt eine schriftliche, empirische Umfrage bei Konsumenten speziell im Bereich der Luxusmode dar, die anschließend quantitativ ausgewertet und diskutiert wird.
In Kapitel zwei wird auf die Auswirkungen der digitalen Revolution im Einzelhandel in Deutschland eingegangen. Dabei wird der Begriff der digitalen Revolution erläutert, speziell auf E-Commerce im B2C-Bereich eingegangen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen für den Einzelhandel und dessen Strukturen beschrieben. Anschließend befasst sich Kapitel drei mit der Thematik der Luxusgüter im E-Commerce: Es erfolgt eine Definition des Begriffs Luxusgutes und eine Erläuterung der Entwicklung des Onlinehandels in diesem Bereich sowie der daraus resultierende Risiken und Herausforderungen. Ferner wird in diesem Abschnitt das Beispiel des Unternehmens Net-A-Porter beleuchtet.
Im nächsten Schritt folgt in Kapitel vier eine knappe Beschreibung der Aufgabenstellung, der verwendeten Methodik und des Fragebogens. Zudem wird hier auch auf die Limitierungen der Umfrage eingegangen. Im fünften Kapitel werden die aus der empirischen Untersuchung gewonnen Erkenntnisse bewertet und daraus Schlussfolgerungen für die aktuelle Entwicklung des Einzelhandels im Bereich der Luxusgüterindustrie abgeleitet. Im sechsten und letzten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Digitale Revolution im Einzelhandel in Deutschland
- Begriffsklärung Digitale Revolution
- E-Commerce im B2C Bereich
- Struktur des Einzelhandels
- Herausforderungen des digitalen Zeitalters
- Luxusgüter im E-Commerce
- Definition Luxusgut
- Entwicklungen des Onlinehandels im Bereich der Luxusgüter
- Beispiel Net-A-Porter
- Risiken und Herausforderungen der Branche
- Methodik der quantitativen Datenerhebung
- Aufgabenstellung
- Methodik
- Fragebogen
- Limitierungen
- Ergebnisse
- Struktur der Luxusmodekäufer
- Einfluss der Digitalisierung auf die Kunden
- Folgen für den Einzelhandel
- Schlussfolgerungen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die wirtschaftlichen Folgen des digitalen Wandels für den Einzelhandel im Bereich der Luxusgüter sowie die Bedeutung des Online-Handels am Beispiel von Net-A-Porter näher zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf einer schriftlichen, empirischen Umfrage bei Konsumenten im Bereich der Luxusmode, die quantitativ ausgewertet und diskutiert wird.
- Die Auswirkungen der digitalen Revolution auf den Einzelhandel in Deutschland
- Die Entwicklung des Onlinehandels im Bereich der Luxusgüter
- Das Unternehmen Net-A-Porter als Beispiel für den Erfolg des Onlinehandels im Luxusgüterbereich
- Die Herausforderungen und Risiken des digitalen Wandels für den Einzelhandel
- Die Folgen des digitalen Wandels für das Kaufverhalten von Konsumenten im Luxusgüterbereich
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der digitalen Revolution auf den Einzelhandel in Deutschland. Dabei wird der Begriff der digitalen Revolution erläutert, speziell auf E-Commerce im B2C-Bereich eingegangen und die damit zusammenhängenden Herausforderungen für den Einzelhandel und dessen Strukturen beschrieben.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit der Thematik der Luxusgüter im E-Commerce: Es erfolgt eine Definition des Begriffs Luxusgutes und eine Erläuterung der Entwicklung des Onlinehandels in diesem Bereich sowie der daraus resultierenden Risiken und Herausforderungen. Ferner wird in diesem Abschnitt das Beispiel des Unternehmens Net-A-Porter beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beschreibt die Aufgabenstellung, die verwendete Methodik und den Fragebogen der empirischen Untersuchung. Zudem werden die Limitierungen der Umfrage dargestellt.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel bewertet die aus der empirischen Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse und leitet daraus Schlussfolgerungen für die aktuelle Entwicklung des Einzelhandels im Bereich der Luxusgüterindustrie ab.
Schlüsselwörter
Digitale Revolution, Einzelhandel, E-Commerce, Luxusgüter, Net-A-Porter, Onlinehandel, Konsumentenverhalten, empirische Forschung, quantitativer Ansatz, Digitalisierung, Herausforderungen, Risiken, Chancen
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die digitale Revolution den Luxus-Einzelhandel?
Die Digitalisierung führt zu einem starken Anstieg des E-Commerce im B2C-Bereich und zwingt traditionelle Luxushändler zur Anpassung ihrer Strukturen.
Warum ist Net-A-Porter ein wichtiges Beispiel in dieser Arbeit?
Net-A-Porter dient als Fallstudie für den erfolgreichen Online-Vertrieb von Luxusmode und zeigt, wie Risiken der Branche minimiert werden können.
Welche Risiken gibt es beim Online-Handel mit Luxusgütern?
Herausforderungen liegen in der Wahrung der Exklusivität, dem Markenimage und den spezifischen Anforderungen der anspruchsvollen Luxuskunden.
Was sind die Ergebnisse der empirischen Umfrage?
Die Umfrage gibt Aufschluss über die Struktur der Luxusmodekäufer und wie die Digitalisierung deren Kaufverhalten konkret verändert hat.
Was ist ein Luxusgut im Sinne dieser Arbeit?
In Kapitel 3 wird der Begriff des Luxusgutes definiert und von gewöhnlichen Konsumgütern im Kontext des E-Commerce abgegrenzt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Wirtschaftliche Folgen der digitalen Revolution auf den Einzelhandel im Bereich der Luxusgüterindustrie am Beispiel von Net-A-Porter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337220