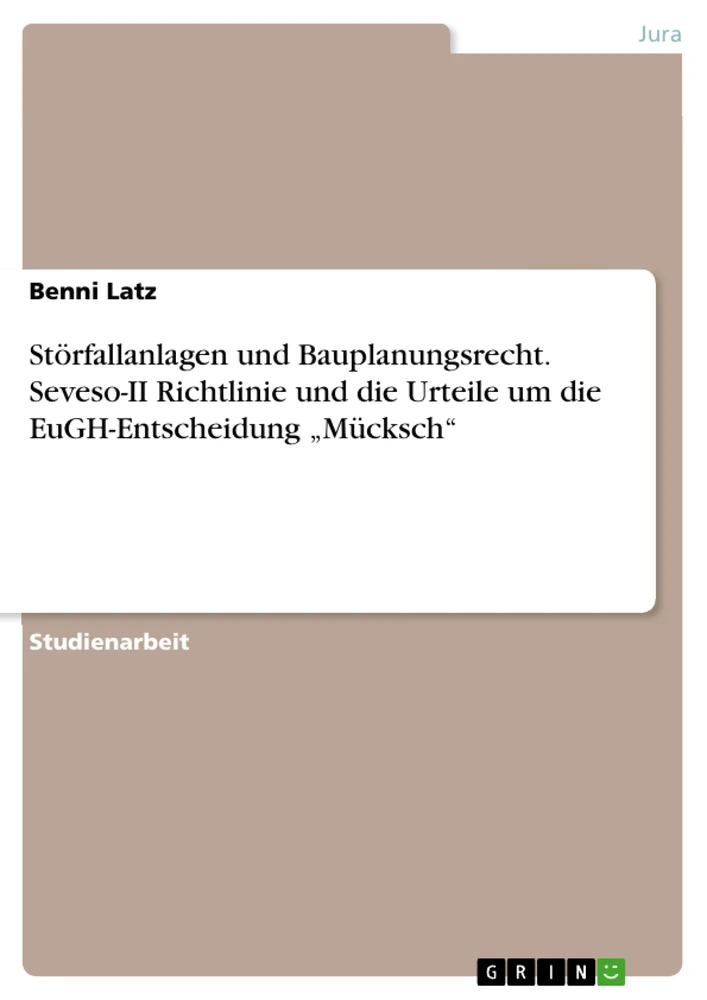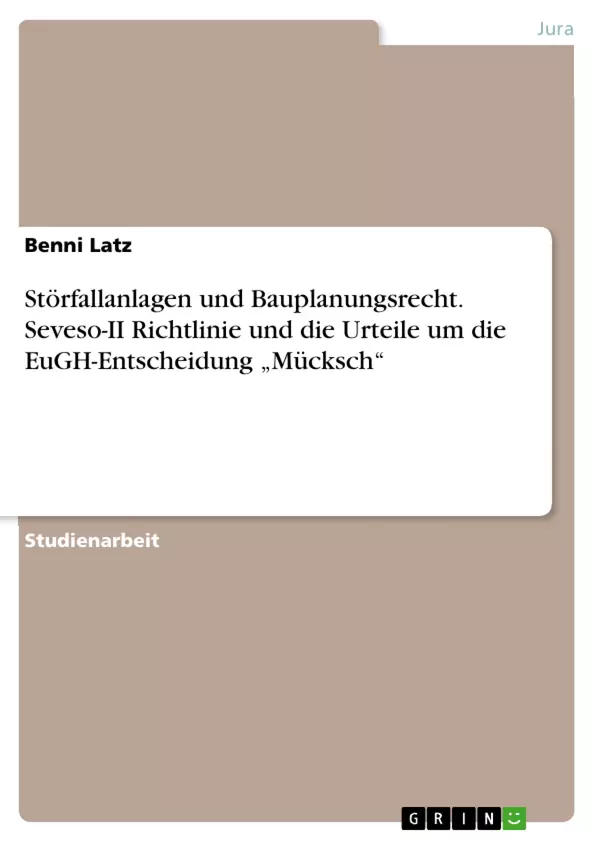Das Anliegen dieser Studienarbeit ist es, anhand der Urteile um die EuGH-Entscheidung „Mücksch“ darzustellen, wie den europäischen Vorgaben der Seveso-II Richtlinie im Bauplanungsrecht begegnet wird und werden kann. Dabei sollen nicht nur die konkreten Entscheidungen und ihre rechtlichen Hintergründe den thematischen Schwerpunkt darstellen, sondern auch sich daran anschließende offene Fragen des Problemkreises.
Als im Juli 1976 aus einer Chemiefabrik in der norditalienischen Gemeinde Seveso eine unbekannte Menge Dioxin austritt und mehrere hundert Hektar Land vergiftet, wird schnell klar: Es ist nicht allein eine Verkettung von tragischen Zufällen, die zu Umweltkatastrophen führt, sondern vor allem eine unzureichende Organisation im Vorfeld. Schlecht ausgebildetes Personal, fehleranfällige Produktionsabläufe und fehlendes Krisenmanagement wirken oftmals nicht nur als verschärfende Faktoren eines Unglücks, sondern bilden in einem Großteil der Fälle deren Grundlage.
Um diesen Problemen von rechtlicher Seite zu begegnen, wurde die europäische Richtlinie 82/501/EWG – Seveso-I – erlassen, die schließlich durch die Richtlinie 96/82/EG – Seveso-II – verschärft wurde. Diese Richtlinien setzen Mindeststandards für die Betriebsorganisation und greifen an zwei Punkten an: Zum einen soll durch präventive Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden, dass derartige Störfälle überhaupt entstehen. Zum anderen sollen, falls es doch dazu kommt, die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden. Ein Instrument ist mit Art. 12 I der Seveso-II Richtlinie die Wahrung eines angemessenen Sicherheitsabstands zu Betrieben, in denen potentiell gefährliche Stoffe in bestimmten Mengen vorhanden sind (sogenannte Störfall-Betriebe).
Dieser Sicherheitsabstand kann jedoch zu bodenrechtlichen Spannungen führen: Wenn um Störfallbetriebe generell ein gewisser Abstand einzuhalten wäre, führt das zwangsläufig zu einer Raumverknappung – hätte das nur zur Folge, dass Störfallbetriebe nicht an andere Gebäude heranrücken dürfen oder wirkt das auch umgekehrt? Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie mit alten Industriestandorten umzugehen ist, die inmitten einer direkt angrenzenden Bebauung liegen. Wenn der Abstand einmal unterschritten ist, gilt er dann dennoch für Neuansiedlungen?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Fragestellung
- B. Die Entscheidungen und ihre rechtlichen Hintergründe
- I. Sachverhalt und Klägerbegehren
- II. Überblick über den Verfahrensgang
- III. Störfallrechtliches Abstandsgebot in den Vorinstanzen
- 1. Beurteilung nach § 34 I BauGB
- 2. Beurteilung nach § 50 S. 1 BImSchG
- 3. Unmittelbare Anwendung der Seveso-II Richtlinie
- 4. Richtlinienkonformität nach dieser Gesetzeslage
- IV. Das Urteil ,,Mücksch“ und die nationale Umsetzung
- 1. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs
- a) Bindung der Bauaufsichtsbehörden
- b) Störfallrechtliches Abstandserfordernis
- c) Zusammenfassung
- 2. Das Anschlussurteil des Bundesverwaltungsgerichts
- a) Angemessener Abstand
- aa) Ermittlung des Angemessenen Abstands
- bb) Kontrolldichte
- b) Ausnahmsweise Unterschreitung des Abstands
- c) Anknüpfungspunkt
- aa) Nähere Umgebung
- bb) Grenzen des Rücksichtnahmegebots
- II(1) Ansicht des Gerichts - Rücksichtnahmegebot
- (2) Eingeschränkter Prüfungsmaßstab innerhalb des Rücksichtnahmegebots
- (3) Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
- (4) Erforderlichkeit einer Bauleitplanung
- (5) Entscheidung
- d) Zusammenfassung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils
- C. Offene Fragen des Problemkreises
- I. Methodische Fragen
- 1. Ermittlung des Sicherheitsabstands und Informationsaustausch
- 2. Schutzwürdige Gebiete
- 3. Berücksichtigung im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle
- II. Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben außerhalb des Innenbereichs
- 1. Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben im Außenbereich
- 2. Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben im Planbereich
- a) Bebauungsplan berücksichtigt Abstandsgebot
- b) Bebauungsplan berücksichtigt Abstandsgebot nicht
- D. Fazit
- Rechtliche Grundlagen des Störfallrechtlichen Abstandsgebots
- Zusammenspiel von Bauplanungsrecht und Störfallrecht
- Rechtliche Bewertung der Abstandsregelungen im Lichte der Seveso-II Richtlinie
- Konkrete Umsetzung des Abstandsgebots in der Bauleitplanung und Baugenehmigungserteilung
- Offene Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Störfallrechtlichen Abstandsgebot
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit das Bauplanungsrecht mit dem Störfallrecht, insbesondere mit den Vorgaben der Seveso-II Richtlinie, in Einklang gebracht werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der konkreten Ausgestaltung des Abstandsgebots für Störfallanlagen im Rahmen der Bauleitplanung und der Baugenehmigungserteilung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit dar und erläutert den relevanten rechtlichen Rahmen. Kapitel B beleuchtet die Entscheidungen der Vorinstanzen und des Europäischen Gerichtshofs im Fall Mücksch, die maßgeblich die rechtliche Auseinandersetzung um das Abstandsgebot für Störfallanlagen beeinflusst haben. Kapitel C beleuchtet die offenen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der konkreten Umsetzung des Abstandsgebots stellen, insbesondere im Hinblick auf die methodische Ermittlung des Sicherheitsabstands, die Identifikation von schutzwürdigen Gebieten und die Berücksichtigung der Vorgaben im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle.
Schlüsselwörter
Störfallanlagen, Bauplanungsrecht, Abstandsgebot, Seveso-II Richtlinie, Bauleitplanung, Baugenehmigungserteilung, Umweltrecht, Sicherheitsabstand, Rücksichtnahmegebot, Schutzwürdige Gebiete, Rechtliche Kontrolle.
- Arbeit zitieren
- Benni Latz (Autor:in), 2013, Störfallanlagen und Bauplanungsrecht. Seveso-II Richtlinie und die Urteile um die EuGH-Entscheidung „Mücksch“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337255