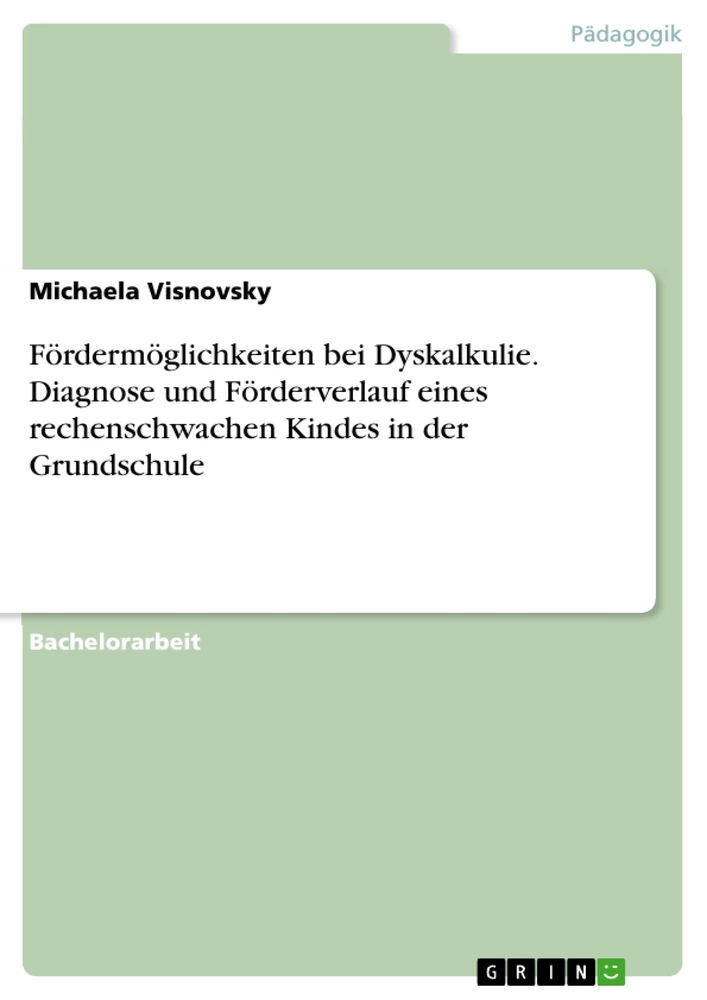Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen Dyskalkulie und den möglichen Veränderungen mathematischer Kompetenzen eines Kindes nach gezielter Förderung. Rechenschwäche beschreibt vielfältige Beeinträchtigungen im mathematischen Denken und Lernen. Diese treten häufig schon im Grundschulalter auf. Um diese möglichst zu minimieren, werden Fördermaßnahmen gesetzt. Mithilfe des standardisierten Tests „Eggenberger Rechentest 1+“ wurde der Lernstand eines Kindes erhoben. Auf dessen Basis wurde ein individueller Förderplan zurechtgelegt und im Zeitraum von zwei Monaten umgesetzt. Schließlich wurde das Kind erneut getestet und die Ergebnisse miteinander verglichen. Das Kind wies eine deutlich verbesserte mathematische Leistung auf, was besonders im Bereich der Mengenoperation am besten zu erkennen ist. Somit wurde im Einzelfall bewiesen, dass spezielle und individuell maßgeschneiderte Förderung einen positiven Effekt auf die mathematischen Kompetenzen des Kindes hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 PROBLEMAUFRISS UND ZIELSTELLUNGEN
- 2 DYSKALKULIE
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Begriffsklärung
- 2.3 Ursachen für Rechenschwäche
- 2.3.1 Biologische Faktoren
- 2.3.2 Psychische Faktoren
- 2.3.3 Soziale Faktoren
- 2.4 Resümee
- 3 DIAGNOSE VON DYSKALKULIE IN DER SCHULE
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Lehrstoff der Grundstufe I in Verbindung mit den Bildungsstandards für Mathematik in der 4. Schulstufe
- 3.3 Symptomatik von Rechenschwäche
- 3.4 Diagnostik
- 3.5 Standardisiertes Rechenverfahren: ERT 1+ (Eggenberger Rechentest)
- 3.5.1 Kognitive mathematische Grundfähigkeiten
- 3.5.2 Mathematische Ordnungsstrukturen
- 3.5.3 Algebraische Strukturen
- 3.5.4 Angewandte Mathematik
- 3.5.5 Anleitung und Durchführung des ERT 1+
- 3.6 Resümee
- 4 FÖRDERMÖGLICHKEITEN
- 4.1 Einleitung
- 4.2 Grundsätze der Förderung
- 4.3 Geeignete Fördermaterialien
- 4.4 Vorteilhafte Methoden
- 4.5 Erstellung eines Förderkonzeptes
- 4.6 Resümee
- 5 EIGENE UNTERSUCHUNGEN
- 5.1 Einleitung
- 5.2 Forschungsmethode: Die Fallstudie
- 5.3 Beobachtung
- 5.4 Ausgangslage des Kindes
- 5.5 Auswertung der ersten Testung und Interpretation der Testergebnisse
- 5.6 Formulieren von Förderschwerpunkten und Zielsetzungen
- 5.7 Fakten und Ablauf der Fördersituation
- 5.8 Erneute Testung des Kindes und Vergleich
- 5.9 Bezug zu mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards
- 5.10 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen gezielter Förderung auf die mathematischen Kompetenzen eines rechenschwachen Kindes. Ziel ist es, anhand einer Fallstudie den Lernfortschritt nach einem individuellen Förderplan zu dokumentieren und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet dabei verschiedene Aspekte der Dyskalkulie.
- Diagnose von Dyskalkulie
- Ursachen und Symptome von Rechenschwäche
- Entwicklung eines individuellen Förderplans
- Auswertung der Fördermaßnahmen
- Bezug zu den Bildungsstandards
Zusammenfassung der Kapitel
1 PROBLEMAUFRISS UND ZIELSTELLUNGEN: Dieses Kapitel legt den Fokus auf die Fragestellung der Arbeit, welche die Auswirkungen gezielter Förderung auf die mathematischen Fähigkeiten eines Kindes mit Rechenschwäche untersucht. Es skizziert die Methodik der Fallstudie und die Ziele der Untersuchung, nämlich den Nachweis eines positiven Effekts individueller Förderung auf die mathematischen Kompetenzen.
2 DYSKALKULIE: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Dyskalkulie. Es beinhaltet eine detaillierte Begriffsklärung, die verschiedene Facetten der Rechenschwäche beleuchtet und differenziert. Zusätzlich werden verschiedene Ursachen – biologische, psychische und soziale Faktoren – diskutiert, um ein ganzheitliches Verständnis der Problematik zu vermitteln. Das Kapitel dient als fundierte Basis für die spätere Diagnose und Förderung.
3 DIAGNOSE VON DYSKALKULIE IN DER SCHULE: Hier wird die Diagnostik von Dyskalkulie im schulischen Kontext detailliert beschrieben. Es wird der Lehrstoff der Grundstufe I im Bezug zu den Bildungsstandards für Mathematik erläutert und die Symptomatik von Rechenschwäche umfassend dargestellt. Der Eggenberger Rechentest (ERT 1+) wird als standardisiertes Verfahren zur Diagnose vorgestellt, wobei die einzelnen Testbereiche (kognitive mathematische Grundfähigkeiten, mathematische Ordnungsstrukturen, algebraische Strukturen, angewandte Mathematik) genau beschrieben werden. Das Kapitel liefert eine systematische Anleitung zur Diagnostik von Rechenschwäche.
4 FÖRDERMÖGLICHKEITEN: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Möglichkeiten der Förderung von Kindern mit Dyskalkulie. Es werden grundlegende Prinzipien der Förderung vorgestellt, geeignete Materialien und vorteilhafte Methoden diskutiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Erstellung eines individuellen Förderkonzeptes, das auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten ist. Das Kapitel bietet einen Überblick über effektive Strategien zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen.
5 EIGENE UNTERSUCHUNGEN: In diesem Kapitel wird die durchgeführte Fallstudie detailliert beschrieben. Es werden die Forschungsmethode, die Beobachtung des Kindes, die Ausgangslage und die Auswertung der ersten Testung mit dem ERT 1+ präsentiert. Der Prozess der Erstellung des individuellen Förderplans, die Durchführung der Förderung und die Ergebnisse der erneuten Testung werden umfassend dargestellt und mit den Bildungsstandards in Verbindung gesetzt. Der Vergleich der Testergebnisse verdeutlicht den Erfolg der individuellen Fördermaßnahmen.
Schlüsselwörter
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Fördermaßnahmen, individueller Förderplan, Eggenberger Rechentest (ERT 1+), mathematische Kompetenzen, Bildungsstandards, Grundstufe I, Fallstudie, Lernfortschritt.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Auswirkungen gezielter Förderung auf die mathematischen Kompetenzen eines rechenschwachen Kindes
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen gezielter Förderung auf die mathematischen Kompetenzen eines Kindes mit Rechenschwäche (Dyskalkulie). Im Mittelpunkt steht eine Fallstudie, die den Lernfortschritt nach einem individuellen Förderplan dokumentiert und analysiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Dyskalkulie, darunter die Diagnose, die Ursachen und Symptome von Rechenschwäche, die Entwicklung eines individuellen Förderplans, die Auswertung der Fördermaßnahmen und den Bezug zu den Bildungsstandards.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzungen. Kapitel 2 befasst sich umfassend mit dem Thema Dyskalkulie. Kapitel 3 erläutert die Diagnose von Dyskalkulie in der Schule, inklusive des Eggenberger Rechentests (ERT 1+). Kapitel 4 beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten. Kapitel 5 präsentiert die eigene Fallstudie mit detaillierten Ergebnissen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Fallstudie. Es wurde ein standardisierter Rechentest (ERT 1+) zur Diagnose und zur Evaluation der Fördermaßnahmen eingesetzt. Die Beobachtung des Kindes und die Auswertung der Testergebnisse bildeten die Grundlage der Analyse.
Welche diagnostischen Instrumente wurden verwendet?
Der Eggenberger Rechentest (ERT 1+) wurde als standardisiertes Verfahren zur Diagnose der Rechenschwäche eingesetzt. Der Test umfasst verschiedene Bereiche wie kognitive mathematische Grundfähigkeiten, mathematische Ordnungsstrukturen, algebraische Strukturen und angewandte Mathematik.
Welche Fördermöglichkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene grundlegende Prinzipien der Förderung, geeignete Fördermaterialien und vorteilhafte Methoden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Erstellung eines individuellen Förderkonzeptes, das auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten ist.
Wie werden die Ergebnisse der Fördermaßnahmen ausgewertet?
Die Auswertung der Fördermaßnahmen erfolgt durch einen Vergleich der Testergebnisse (ERT 1+) vor und nach der Förderung. Der Lernfortschritt wird detailliert dokumentiert und analysiert. Die Ergebnisse werden zudem in Bezug zu den mathematischen Kompetenzen der Bildungsstandards gesetzt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt anhand der Fallstudie den möglichen positiven Effekt individueller Förderung auf die mathematischen Kompetenzen eines rechenschwachen Kindes auf. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von gezielten und individuellen Fördermaßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Dyskalkulie, Rechenschwäche, Fördermaßnahmen, individueller Förderplan, Eggenberger Rechentest (ERT 1+), mathematische Kompetenzen, Bildungsstandards, Grundstufe I, Fallstudie, Lernfortschritt.
- Arbeit zitieren
- BEd. Michaela Visnovsky (Autor:in), 2014, Fördermöglichkeiten bei Dyskalkulie. Diagnose und Förderverlauf eines rechenschwachen Kindes in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337314