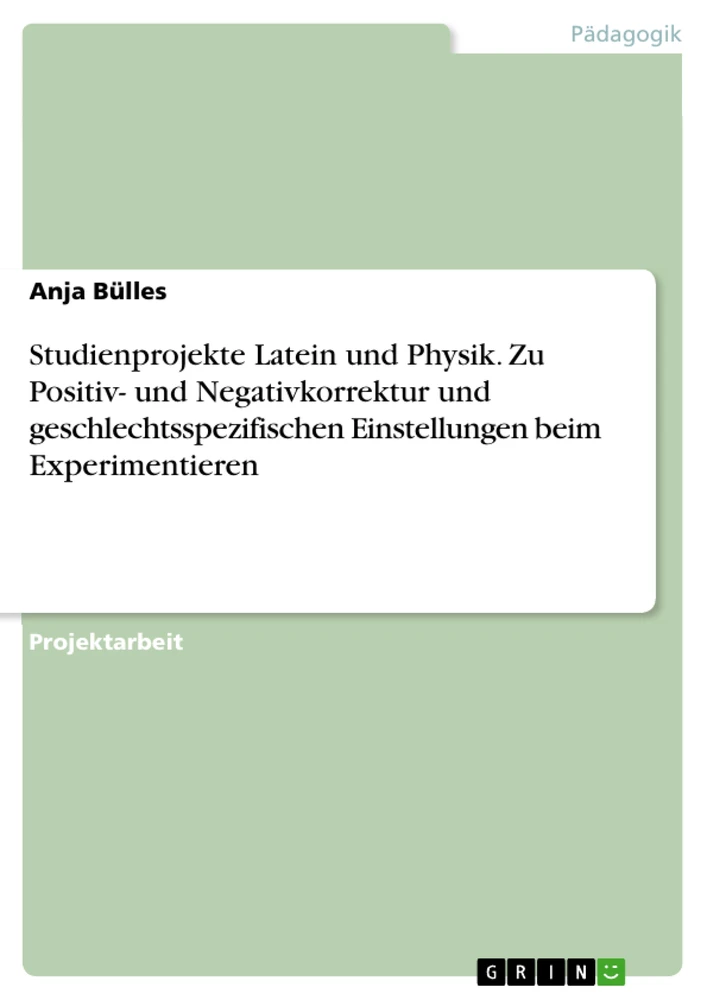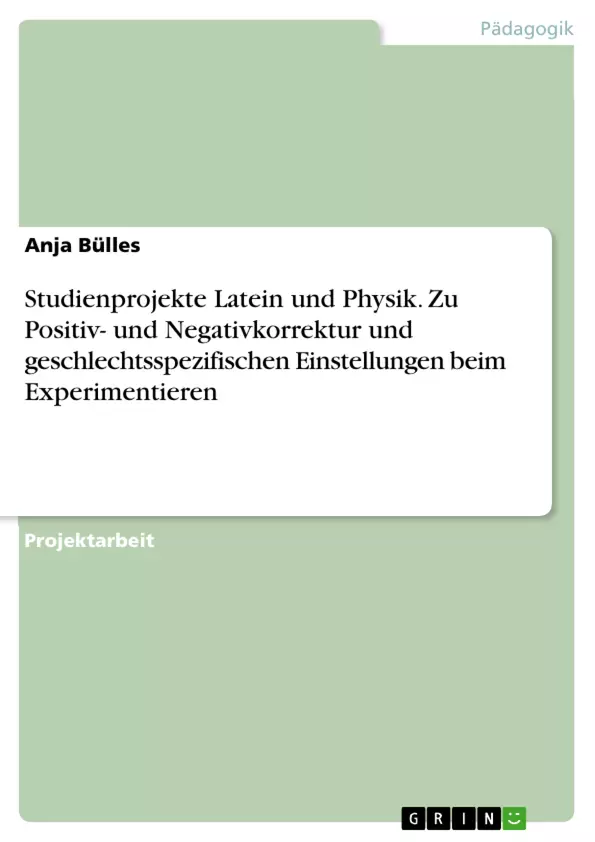Dieser Band umfasst zwei Studienprojekte, die während des Praxissemesters angefertigt wurden. Im erste Projekt wird untersucht, welchen Einfluss die Vorgehensweise bei der Korrektur von Übersetzungen auf die Bewertung einer Übersetzung hat. Das zweite Projekt geht von der Feststellung aus, dass das Fach Physik bei Mädchen das mit Abstand unbeliebteste Fach ist, was dazu führt, dass sie in Physik-Leistungskursen mit circa 10% deutlich unterrepräsentiert sind und sich noch seltener gar für ein Physikstudium entscheiden.
Das erste Projekt untersucht , welchen Einfluss die Vorgehensweise bei der Korrektur von Übersetzungen auf die Bewertung einer Übersetzung hat. Dabei soll das Verfahren der Positivkorrektur, so wie es 1976 von Wilhelm Biermann beschrieben wurde, mit dem der in NRW obligatorischen Negativkorrektur gemäß den Vorgaben der Kultusministerkonferenz verglichen werden, um folgenden Fragen nachzugehen: Führen die Korrekturverfahren zu unterschiedlichen Ergebnissen und wenn ja, lassen sich diese durch die Art der begangenen Fehler begründen? Werden die Fehler-Typen also gleichwertig behandelt? Welche Auswirkungen hat der Schwierigkeitsgrad des Übersetzungstextes, d.h. gibt es Unterschiede zwischen Lehrbuch- und Originaltexten? Lässt sich Biermanns Ergebnis, dass die Bewertung mittels einer Positivkorrektur leicht besser ausfalle, bestätigen?
Für viele Mädchen ist das Fach Physik das mit Abstand unbeliebteste Fach, was dazu führt, dass sie in Physik-Leistungskursen mit ca. 10% deutlich unterrepräsentiert sind und sich noch seltener gar für ein Physikstudium entscheiden. Dennoch ist Physik bis zur Mittelstufe ein Pflichtfach, sodass die Frage nach den Ursachen für die „mädchenspezifische“ Abneigung gegenüber der Physik bereits seit Beginn der 80er Jahre genauer untersucht wird. Eine wesentliche Ursache wird darin gesehen, dass Mädchen sich vor allem in der Pubertät von der als „männlich“ angesehenen Physik abwenden. Ob sich dies auch in der Einstellung von Jungen und Mädchen gegenüber Schülerexperimenten widerspiegelt, soll im Rahmen des zweiten Forschugsprojekts geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Studienprojekt Latein: Das Bewerten von Übersetzungen mittels Positiv- und Negativkorrektur im Vergleich
- I.1 Einleitung
- I.2 Hauptteil
- I.2.1 Die Korrekturverfahren
- I.2.2 Vorgehensweise
- I.2.3 Vergleich der Notenskalen
- I.2.4 Auswertung der Klausuren
- I.2.5 Ergebnis
- I.3 Zusammenfassung
- I.4 Literaturverzeichnis
- II. Studienprojekt Physik: Unterschiedliche Einstellungen zum Experimentieren bei Jungen und Mädchen verschiedener Altersstufen
- II.1 Einleitung
- II.2 Einstellungen zum Experimentieren bei Jungen und Mädchen
- II.2.1 Vorgehen bei der Datenerhebung
- II.2.2 Auswertung
- II.2.3 Ergebnisdiskussion
- II.3 Zusammenfassung
- II.4 Literaturverzeichnis
- II.5 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Studienprojekt zielt darauf ab, den Einfluss unterschiedlicher Korrekturverfahren auf die Bewertung von Übersetzungen zu untersuchen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Verfahren der Positiv- und Negativkorrektur und analysiert die Ergebnisse der beiden Methoden im Vergleich.
- Analyse der Unterschiede in der Bewertung von Übersetzungen mittels Positiv- und Negativkorrektur
- Beurteilung, ob die Art der Fehler in den Übersetzungen bei beiden Verfahren gleichwertig behandelt wird
- Untersuchung des Einflusses des Schwierigkeitsgrades des Übersetzungstextes auf die Bewertung
- Vergleich der Ergebnisse mit der Studie von Biermann (1976) zur Positivkorrektur
- Bewertung der beiden Korrekturverfahren anhand ihrer Anwendung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I.1 Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage des Studienprojekts dar, die sich auf den Einfluss der Korrekturmethode auf die Bewertung von Übersetzungen konzentriert. Es wird der Vergleich zwischen Positiv- und Negativkorrektur vorgenommen, wobei die beiden Verfahren anhand ihrer Grundprinzipien erläutert und die Forschungsfragen präzisiert werden.
Kapitel I.2 Hauptteil
Der Hauptteil des Kapitels befasst sich mit den beiden Korrekturverfahren im Detail. Es werden die Verfahren der Positiv- und Negativkorrektur anhand von Beispielen und Tabellen erläutert und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Zudem wird die Vorgehensweise bei der Auswertung der Klausuren beschrieben.
Kapitel I.2.1 Die Korrekturverfahren
In diesem Abschnitt werden die Prinzipien der Positiv- und Negativkorrektur detailliert dargestellt. Es werden die Methoden der Fehlerbewertung, die Punktesysteme und die Notenskalen für beide Verfahren erläutert.
Kapitel I.2.2 Vorgehensweise
Dieser Abschnitt beschreibt die praktische Vorgehensweise bei der Durchführung des Studienprojekts. Es werden die ausgewählten Klausuren, die Stichprobengröße und die Art der Datenerhebung vorgestellt.
Kapitel I.2.3 Vergleich der Notenskalen
Es wird ein Vergleich der Notenskalen für Positiv- und Negativkorrektur vorgenommen. Der Abschnitt betrachtet die beiden Extremfälle „fehlerfreie Übersetzung“ und „maximale Fehlübersetzung“ und analysiert die Punktezuordnung in beiden Fällen.
Kapitel I.2.4 Auswertung der Klausuren
Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierte Analyse der Klausuren. Es wird die Häufigkeit verschiedener Fehlertypen untersucht und die Ergebnisse werden mit den zuvor dargestellten Notenskalen verglichen.
Kapitel I.2.5 Ergebnis
Die Ergebnisse der Untersuchung werden in diesem Abschnitt zusammengefasst. Es werden die Unterschiede in der Bewertung von Übersetzungen mittels Positiv- und Negativkorrektur dargestellt und die Bedeutung der Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen diskutiert.
Kapitel I.3 Zusammenfassung
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Studienprojekts zusammen und gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Es werden die Beantwortung der Forschungsfragen und die Schlussfolgerungen aus der Untersuchung dargestellt.
Kapitel II.1 Einleitung
Dieser Abschnitt stellt die Forschungsfrage des zweiten Studienprojekts vor, welches sich mit den Einstellungen von Jungen und Mädchen zum Experimentieren in verschiedenen Altersstufen befasst.
Kapitel II.2 Einstellungen zum Experimentieren bei Jungen und Mädchen
Dieser Abschnitt befasst sich mit den unterschiedlichen Einstellungen von Jungen und Mädchen zum Experimentieren. Es werden die Ergebnisse der Forschungsstudie vorgestellt und die Unterschiede in den Einstellungen analysiert.
Kapitel II.2.1 Vorgehen bei der Datenerhebung
Dieser Abschnitt beschreibt die Methode der Datenerhebung, die zur Untersuchung der Einstellungen von Jungen und Mädchen zum Experimentieren angewandt wurde.
Kapitel II.2.2 Auswertung
Dieser Abschnitt beschreibt die Auswertung der erhobenen Daten und die statistische Analyse der Ergebnisse.
Kapitel II.2.3 Ergebnisdiskussion
Dieser Abschnitt diskutiert die Ergebnisse der Auswertung und interpretiert die Unterschiede in den Einstellungen von Jungen und Mädchen zum Experimentieren.
Kapitel II.3 Zusammenfassung
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse des zweiten Studienprojekts zusammen und gibt einen Überblick über die Ergebnisse. Es werden die Beantwortung der Forschungsfragen und die Schlussfolgerungen aus der Untersuchung dargestellt.
Schlüsselwörter
Das Studienprojekt beschäftigt sich mit zentralen Themen der Sprachdidaktik, der Evaluation von Übersetzungen und der Untersuchung von Geschlechterunterschieden. Zu den Schlüsselbegriffen gehören Positivkorrektur, Negativkorrektur, Fehlertypen, Notenskalen, Einstellungen zum Experimentieren, Genderunterschiede und wissenschaftliche Forschungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Positiv- und Negativkorrektur in Latein?
Die Negativkorrektur zählt Fehler ab, während die Positivkorrektur (nach Biermann) gelungene Übersetzungsleistungen stärker in die Bewertung einfließen lässt.
Warum ist Physik bei Mädchen oft das unbeliebteste Fach?
Untersuchungen zeigen, dass sich Mädchen besonders in der Pubertät von der als „männlich“ wahrgenommenen Physik abwenden.
Wie wirkt sich das Korrekturverfahren auf die Lateinnote aus?
Die Arbeit untersucht, ob die Positivkorrektur tatsächlich zu besseren Bewertungen führt und wie verschiedene Fehlertypen gewichtet werden.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede beim Experimentieren in Physik?
Das Studienprojekt Physik untersucht, ob Jungen und Mädchen unterschiedliche Einstellungen zu Schülerexperimenten in verschiedenen Altersstufen haben.
Welchen Einfluss hat der Schwierigkeitsgrad eines Textes auf die Korrektur?
Es wird analysiert, ob die Korrekturverfahren bei Lehrbuchtexten anders wirken als bei anspruchsvollen Originaltexten.
- Quote paper
- Anja Bülles (Author), 2015, Studienprojekte Latein und Physik. Zu Positiv- und Negativkorrektur und geschlechtsspezifischen Einstellungen beim Experimentieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337411