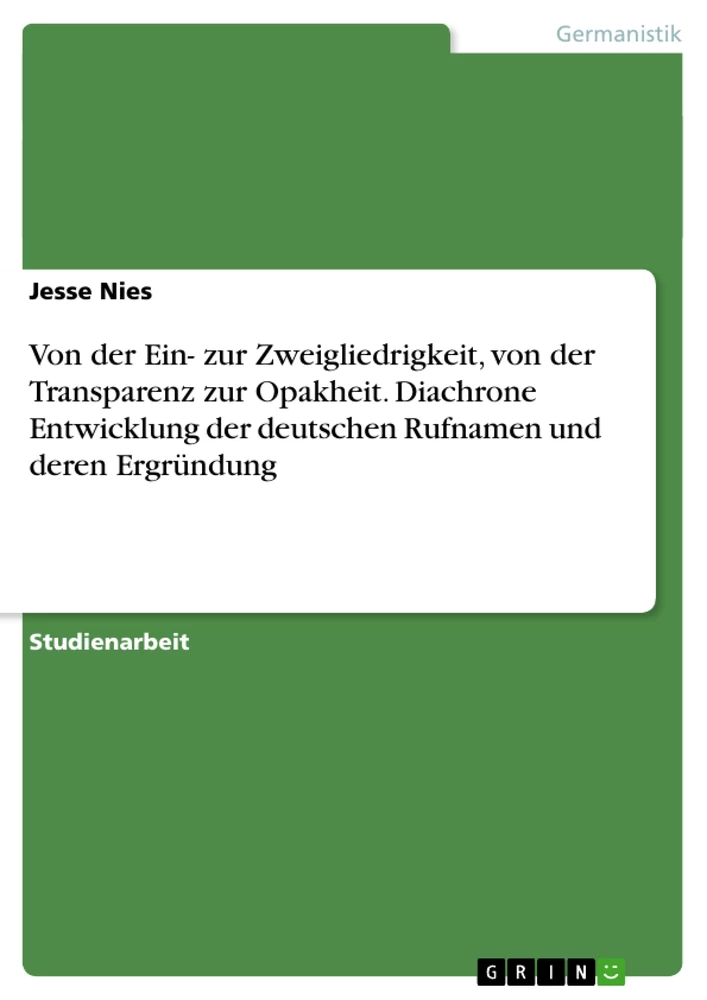Die Kategorien der Zwei- und Eingliedrigkeit sowie besonders der Opakheit und Transparenz finden in der Namenforschung bisher nur nebensächliche Beachtung. Daher ist es das Ziel dieser Hausarbeit die Entwicklung der deutschen Rufnamen unter dem Gesichtspunkt dieser Kategorien zu beleuchten und sich mit der Frage zu beschäftigen, warum die deutschen Rufnamen und damit ihre Zwei- und Eingliedrigkeit sowie ihre Opakheit und Transparenz die uns bekannten Wandlungsprozesse vollzogen haben. Um den Rahmen der Hausarbeit dabei nicht zu sprengen, und um ihre Stringenz nicht in Mitleidenschaft zu ziehen, beschränkt sich die Hausarbeit auf die deutschen Ruf- bzw. Vornamen.
Im ersten Kapitel werden die zentralen Begriffe der beiden genannten Kategorien (Zwei- und Eingliedrigkeit, Opakheit und Transparenz) für die folgende Untersuchung kurz definiert und erläutert. Abschnitt zwei enthält eine Nachzeichnung der diachronen Entwicklung der deutschen Rufnamen vom Germanischen bis in die heutige Zeit. Hierbei wurde bei der Gliederung des Kapitels nicht auf die sprachhistorischen Epochen sondern auf die historischen Begriffe Früh-, Hoch- und Spätmittelalter zurückgegriffen. Die Epochalisierung und Gliederung der Namenentwicklung gestaltet sich äußerst schwierig, da es keine eigenen Epochengeschichte der Namenkunde gibt, und die bekannten historischen Epochalisierungen nur bedingt mit den Entwicklungsabschnitten der Rufnamengeschichte übereinstimmen. Es war daher naheliegend der zutreffendsten und übersichtlichsten historischen Einteilung den Vorzug zu geben.
Die Nachzeichnung der diachronen Entwicklung vollzieht sich anhand der genannten Untersuchungskategorien. Schließlich skizziert das dritte Kapitel Begründungsansätze, mit denen sich die aufgezeigte Entwicklung der deutschen Rufnamen erklären lässt. Der Übergang vom germ.* Rufnamensystem zum mittelalterlichen Onomastikon wird hierbei als ausschlaggebender und zu erklärender Faktor angesehen.
Wie eingangs erwähnt beschränkt sich die vorliegende Hausarbeit auf die deutschen Rufnamen. Die Entwicklung der Bei- und Familiennamen und ihre rückwirkenden Einflüsse auf die Rufnamen konnten leider nicht berücksichtigt werden. Die in Kapitel drei aufgezeigten Erklärungsmodelle erheben keinen Anspruch auf Absolutheit. Sie sollen dem/ der LeserIn jedoch zu einem besseren Verständnis für die kausalen Zusammenhänge des Sprachwandels verhelfen und mögliche Begründungen für das dargelegte Phänomen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Zwei- und Eingliedrigkeit
- Opakheit und Transparenz
- Diachrone Entwicklung der deutschen Rufnamen
- Das germanische Rufnamensystem
- Früh- und Hochmittelalter
- Rufnamenkonzentration
- Lautliche Umgestaltung der Eigennamen
- Spätmittelalter
- Von der Reformation zur Neuzeit
- Reformbestrebungen und Namenneuschöpfungen
- Neue Fremdnamen
- Das 20. Jahrhundert
- Untersuchung der Gründe für die dargestellten Entwicklungen
- Funktionalistischer Ansatz
- Systematischer Ansatz
- Ansatz der sich differenzierenden Homonymie
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung deutscher Rufnamen unter Berücksichtigung der Kategorien Zwei- und Eingliedrigkeit sowie Opakheit und Transparenz. Ziel ist es, die Wandlungsprozesse dieser Namen zu beleuchten und deren Ursachen zu ergründen. Die Arbeit konzentriert sich dabei ausschließlich auf deutsche Rufnamen, wobei die Entwicklung von Bei- und Familiennamen nicht berücksichtigt wird.
- Diachrone Entwicklung deutscher Rufnamen vom Germanischen bis zur Gegenwart
- Analyse der Kategorien Zwei- und Eingliedrigkeit von Namen
- Untersuchung der Opakheit und Transparenz von Namen
- Erforschung der Ursachen für die Entwicklung der deutschen Rufnamen
- Bewertung verschiedener Erklärungsansätze für den Sprachwandel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt das Forschungsziel: die Untersuchung der Entwicklung deutscher Rufnamen unter den Aspekten der Zwei- und Eingliedrigkeit sowie der Opakheit und Transparenz. Die Arbeit konzentriert sich auf Rufnamen und erklärt die gewählte Struktur und die Grenzen der Untersuchung.
Begriffsklärungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Zwei- und Eingliedrigkeit“ und „Opakheit und Transparenz“. Eingliedrige Namen (monothematisch) entstehen aus einem Appellativ, zweigliedrige (dithematisch) aus zwei. Transparenz beschreibt die erkennbare Beziehung eines Namens zu seiner appellativischen Ursprungsform, während Opakheit diese Beziehung verdeckt.
Diachrone Entwicklung der deutschen Rufnamen: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung der deutschen Rufnamen nach, beginnend mit dem germanischen System bis zur Gegenwart. Es wird die Entwicklung von ein- und zweigliedrigen Namen, sowie transparenten und opaken Namen im Laufe der Geschichte analysiert. Die Einteilung folgt dabei einer historischen Gliederung (Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, etc.), anstatt einer strikt sprachhistorischen Einteilung, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Das germanische System basierte auf Einnamigkeit und Transparenz. Die Entwicklung im Mittelalter zeigt eine zunehmende Komplexität und Lautverschiebungen.
Untersuchung der Gründe für die dargestellten Entwicklungen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für die beschriebenen Entwicklungen. Es werden funktionalistische, systematische und Ansätze der sich differenzierenden Homonymie diskutiert. Diese Ansätze versuchen, die Ursachen für den Wandel in der Struktur und Bedeutung von deutschen Rufnamen zu erklären. Der Übergang vom germanischen Rufnamensystem zum mittelalterlichen Onomastikon wird als ein entscheidender Faktor angesehen.
Schlüsselwörter
Deutsche Rufnamen, Diachronie, Zwei- und Eingliedrigkeit, Opakheit, Transparenz, Germanisches Rufnamensystem, Mittelalter, Sprachwandel, Onomastik, Namenforschung, Etymologische Rekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Entwicklung deutscher Rufnamen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die diachrone Entwicklung deutscher Rufnamen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Kategorien Zwei- und Eingliedrigkeit sowie Opakheit und Transparenz dieser Namen und der Erforschung der Ursachen für ihren Wandel.
Welche Zeiträume werden in der Untersuchung der Rufnamenentwicklung berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung deutscher Rufnamen vom germanischen System bis in die Gegenwart. Die historische Einteilung umfasst das Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, die Reformation, die Neuzeit und das 20. Jahrhundert. Die Einteilung priorisiert Übersichtlichkeit gegenüber einer strikt sprachhistorischen Gliederung.
Was bedeuten die Begriffe "Zwei- und Eingliedrigkeit" und "Opakheit und Transparenz" im Kontext der Arbeit?
„Eingliedrige“ Namen (monothematisch) bestehen aus einem Appellativ, „zweigliedrige“ (dithematisch) aus zwei. „Transparenz“ beschreibt die erkennbare Beziehung eines Namens zu seiner appellativischen Ursprungsform, während „Opakheit“ diese Beziehung verdeckt.
Welche Aspekte der Namen werden im Detail analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung ein- und zweigliedriger sowie transparenter und opaker Namen im Laufe der Geschichte. Es wird untersucht, wie sich diese Kategorien im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche Erklärungsansätze für die Entwicklung der Rufnamen werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für den Wandel der deutschen Rufnamen, darunter funktionalistische, systematische Ansätze und Ansätze der sich differenzierenden Homonymie. Diese Ansätze versuchen, die Ursachen für den Wandel in Struktur und Bedeutung der Namen zu erklären.
Welche Rolle spielt das germanische Rufnamensystem in der Arbeit?
Das germanische Rufnamensystem, das auf Einnamigkeit und Transparenz basierte, dient als Ausgangspunkt der Untersuchung. Der Übergang von diesem System zum mittelalterlichen Onomastikon wird als entscheidender Faktor für die nachfolgende Entwicklung angesehen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Begriffserklärungen (Zwei- und Eingliedrigkeit, Opakheit und Transparenz), ein Kapitel zur diachronen Entwicklung der deutschen Rufnamen, ein Kapitel zur Untersuchung der Gründe für die Entwicklung und ein Nachwort.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die zentralen Themen der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Rufnamen, Diachronie, Zwei- und Eingliedrigkeit, Opakheit, Transparenz, Germanisches Rufnamensystem, Mittelalter, Sprachwandel, Onomastik, Namenforschung, Etymologische Rekonstruktion.
Welche Grenzen hat die Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Rufnamen; die Entwicklung von Bei- und Familiennamen wird nicht berücksichtigt.
Was ist das zentrale Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Wandlungsprozesse deutscher Rufnamen zu beleuchten und die Ursachen dieser Entwicklungen zu ergründen.
- Citar trabajo
- Jesse Nies (Autor), 2003, Von der Ein- zur Zweigliedrigkeit, von der Transparenz zur Opakheit. Diachrone Entwicklung der deutschen Rufnamen und deren Ergründung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33748