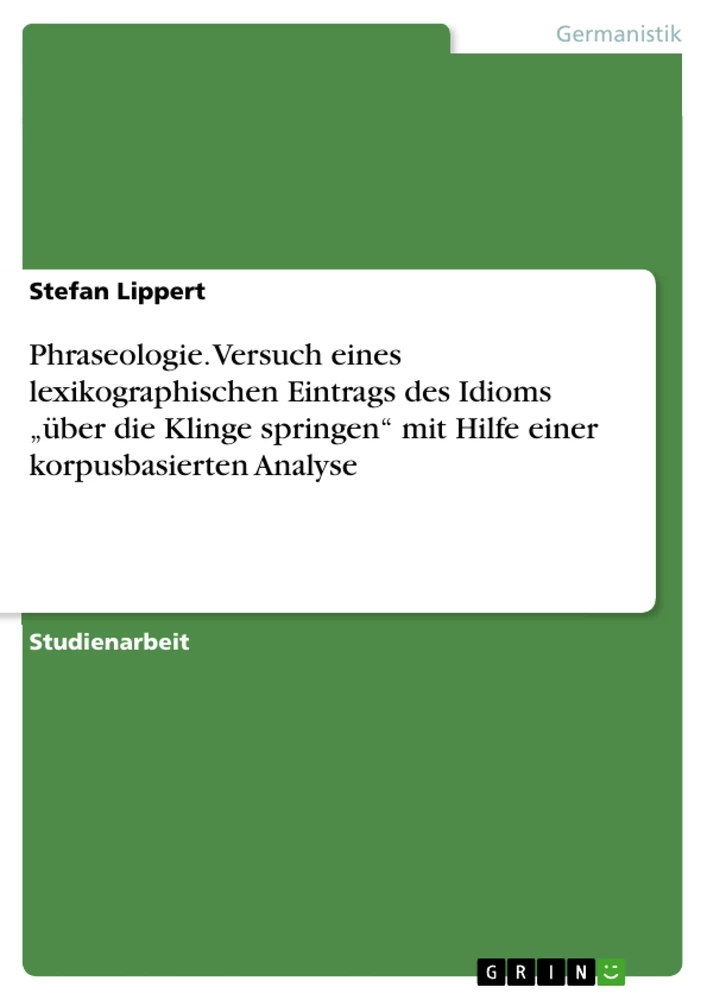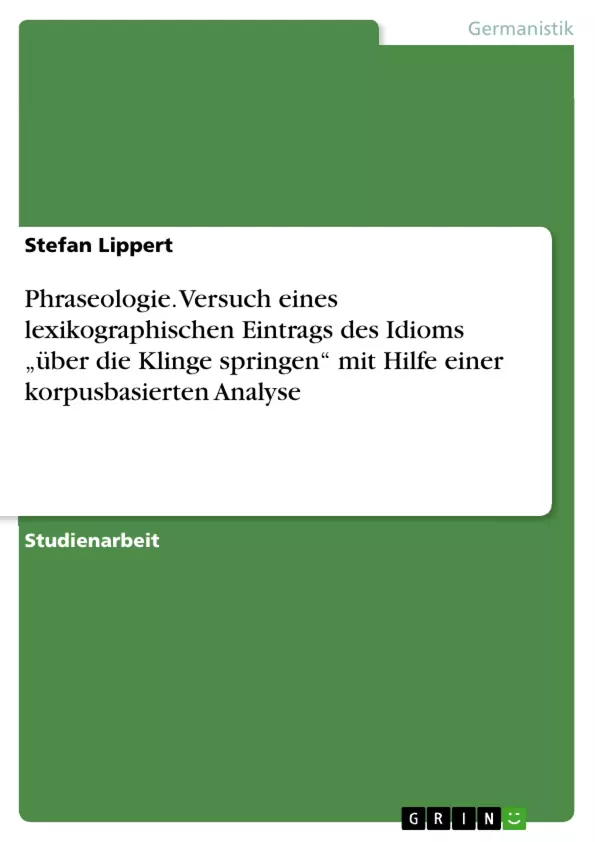Die vorliegende Arbeit ist das Produkt der Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Phänomen der Phraseologismen. Die Arbeit stellt den Versuch dar, die Möglichkeiten korpuslinguistischer Untersuchungen von Phraseologismen für die Lexikographie kritisch zu beurteilen.
Wert und Nutzen der Korpuslinguistik sind in der Sprachwissenschaft höchst umstritten. Dabei sind die Gegenpositionen durch ideologische Differenzen voneinander getrennt. Während Befürworter korpuslinguistischer Methoden sich bei der Beschreibung von Sprache auf den Primat der tatsächlich verwendeten Sprache, der sich vermeintlich in den Korpora widerspiegelt, berufen, unterscheidet die traditionelle Linguistik zwischen Kompetenz und Performanz und priorisiert die Introspektion als Methode, um Regeln für die sprachliche Kompetenz, d.h. die Sprachfähigkeit abzuleiten. Der tatsächliche Sprachgebrauch, die Performanz, stellt innerhalb dieses Paradigmas eine Degeneration dar, die nicht dazu geeignet ist, aus ihr Regeln über Sprache ableiten zu können.
Am Beispiel der idiomatischen Wendung „über die Klinge springen“ soll demonstriert werden, wie mit Hilfe einer korpusbasierten Untersuchung ein lexikographischer Eintrag, der dem im tatsächlichen Sprachgebrauch zu beobachtenden Bedeutungsspektrum des Idioms gerecht wird, vorgenommen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale von Phraseologismen
- Polylexikalität
- Festigkeit
- Gebräuchlichkeit
- Psycholinguistische Festigkeit
- Strukturelle Festigkeit
- Idiomatizität
- Korpusbasierte Analyse des Idioms „über die Klinge springen“
- Vorgehensweise
- Auswahl des Korpus
- Suchphrasen
- Ergebnisse
- Morphosyntaktische Festigkeit
- Semantik
- Vorgehensweise
- Versuch eines Wörterbucheintrags
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Idiom „über die Klinge springen“ anhand einer korpusbasierten Untersuchung und evaluiert die Möglichkeiten, korpuslinguistische Ergebnisse für lexikographische Einträge nutzbar zu machen.
- Definition und Merkmale von Phraseologismen
- Anwendung korpuslinguistischer Methoden zur Analyse von Idiomen
- Bedeutungsspektrum und Semantik des Idioms „über die Klinge springen“
- Entwicklung eines lexikographischen Eintrags basierend auf korpuslinguistischen Daten
- Diskussion der Rolle von Korpora in der Lexikographie und der Bedeutung von Sprachgebrauch für die Definition von Bedeutungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Phraseologie ein und beleuchtet die Bedeutung korpuslinguistischer Methoden für die Beschreibung der Gegenwartssprache. Sie stellt die Problematik der Definition von Bedeutungen im Vergleich zur Grammatik dar und motiviert die Verwendung von Korpora zur Analyse des Idioms „über die Klinge springen“.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition von Phraseologismen und beschreibt die zentralen Merkmale: Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität.
Im dritten Kapitel wird die korpusbasierte Analyse des Idioms „über die Klinge springen“ erläutert. Die Vorgehensweise bei der Auswahl des Korpus und der Suchphrasen wird beschrieben. Die Ergebnisse der Analyse werden in Bezug auf die morphosyntaktische Festigkeit und die Semantik des Idioms dargestellt.
Das vierte Kapitel präsentiert einen Versuch, einen lexikographischen Eintrag für das Idiom „über die Klinge springen“ zu erstellen, der die Ergebnisse der korpusbasierten Analyse berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Phraseologie, Idiome, Korpuslinguistik, Lexikographie, „über die Klinge springen“, Bedeutungsspektrum, Semantik, Morphosyntax, Sprachgebrauch, Sprachfähigkeit, Kompetenz, Performanz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Idiom „über die Klinge springen“?
Es bedeutet im übertragenen Sinne, geopfert zu werden, zu scheitern oder (historisch) hingerichtet zu werden. Heute wird es oft im politischen oder wirtschaftlichen Kontext verwendet.
Was ist Korpuslinguistik?
Die Korpuslinguistik untersucht Sprache anhand von großen digitalen Textsammlungen (Korpora), um den tatsächlichen Sprachgebrauch (Performanz) statistisch zu analysieren.
Was sind die Merkmale von Phraseologismen?
Zentrale Merkmale sind Polylexikalität (besteht aus mehreren Wörtern), Festigkeit (feste Struktur) und Idiomatizität (übertragene Bedeutung).
Warum ist die Korpusanalyse für Wörterbücher (Lexikographie) wichtig?
Sie hilft dabei, das reale Bedeutungsspektrum eines Begriffs zu erfassen, statt sich nur auf die Intuition der Sprachwissenschaftler zu verlassen.
Was ist der Unterschied zwischen Kompetenz und Performanz?
Kompetenz ist die theoretische Sprachfähigkeit eines Sprechers, während Performanz den tatsächlichen, oft unvollkommenen Sprachgebrauch in der Realität beschreibt.
- Quote paper
- Stefan Lippert (Author), 2014, Phraseologie. Versuch eines lexikographischen Eintrags des Idioms „über die Klinge springen“ mit Hilfe einer korpusbasierten Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337564