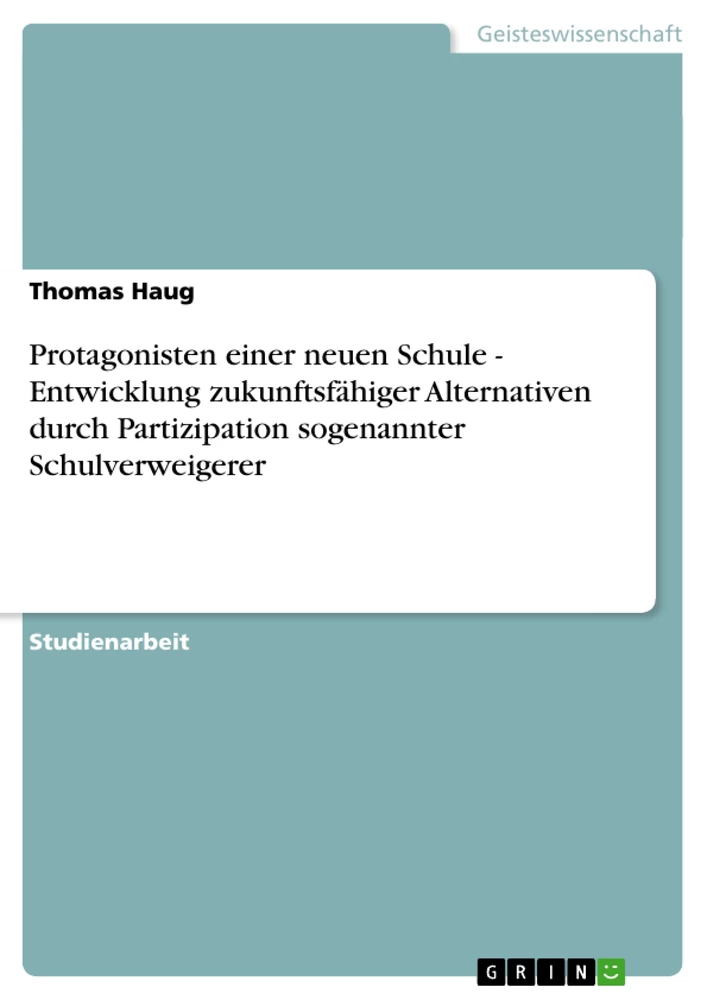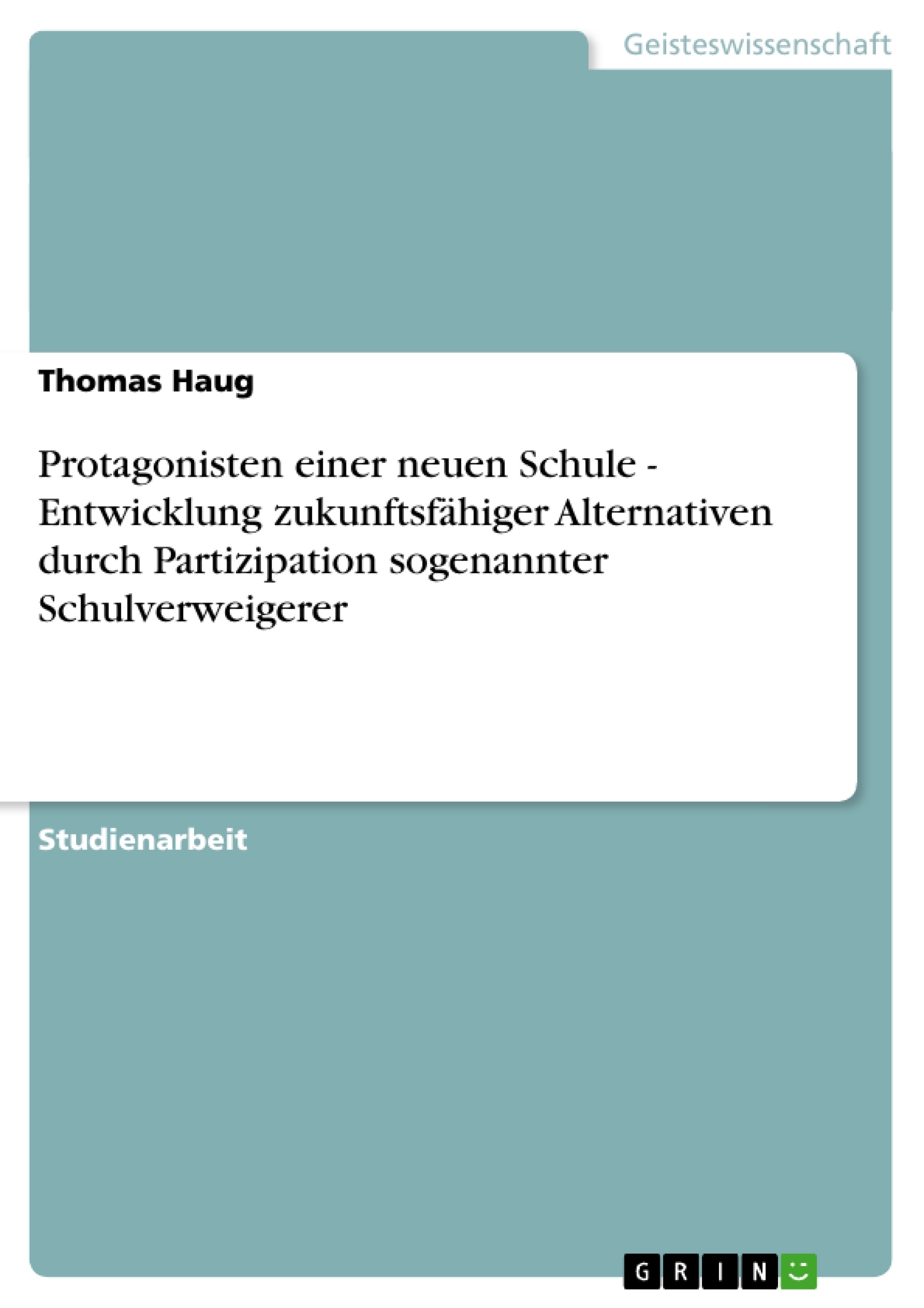Bei der Auseinandersetzung mit der komplexen Thematik der problematischen Übergänge von Schule zum Berufsleben stellte sich mir schon bald die Frage, was denn mit den jungen Menschen ist, die erst gar nicht so weit kommen.
Was passiert, wenn Schüler der Schule den Rücken kehren? Wie kommt es überhaupt so weit?
Leider ist vielen, trotz der Ergebnisse der Pisa-Studie und den traurigen Ereignissen in Erfurt, immer noch nicht klar, dass sich das System Schule verändern muss. Doch wie können wirklich trag- und zukunftsfähige Alternativen entwickelt werden? Welche Chancen ergeben sich aus der Analyse der Motive sogenannter Schulverweigerung sowie durch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Lösung der sie betreffenden Probleme?
Diesen Fragen folgend stellt sich der Inhalt meiner vorliegenden Arbeit dar. Zunächst versuche ich den Zusammenhängen zwischen der Krise der (Erwerbs-) Arbeitsgesellschaft und der Krise der Schule nachzugehen. Darauf aufbauend beleuchte ich frühe Ausgrenzungsrisiken des Schulsystems und die Folgen. Im zweiten Teil meiner Ausführungen werde ich die Freiburger StrassenSchule e.V. kurz vorstellen, um schließlich die ihr zugrunde liegende Haltung sowie wichtige Prinzipien für die Arbeit herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Realität der Arbeitsgesellschaft und Legitimationskrise der Schule
- III. Frühe und mehrfache Ausgrenzung insbesondere durch Schule
- 1. Unterschiedliche Facetten sogenannter Schulverweigerung
- 2. Gründe und Hintergründe
- IV. Neue Wege durch Partizipation – Die Freiburger StrassenSchule e.V.
- 1. Interkulturalität und Transprofessionalität
- 2. Beziehungsarbeit
- 3. Dialogisches Lernen
- 4. Reflektierte Aktion und aktive Reflexion
- 5. Prozessorientierung, Kontinuität und Nachhaltigkeit
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Schulverweigerung im Kontext der Krise der Arbeitsgesellschaft und des Schulsystems. Sie analysiert die Gründe und Folgen von Schulverweigerung und stellt ein alternatives pädagogisches Modell vor, die Freiburger StrassenSchule e.V.
- Zusammenhang zwischen der Krise der Arbeitsgesellschaft und der Legitimationskrise der Schule
- Ursachen und Facetten von Schulverweigerung
- Folgen von Schulverweigerung für betroffene Jugendliche
- Das Konzept der Freiburger StrassenSchule als zukunftsfähige Alternative
- Partizipation und dialogisches Lernen als Schlüssel zur erfolgreichen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen und Alternativen zur Schulverweigerung in den Mittelpunkt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Notwendigkeit einer systemischen Veränderung des Schulsystems hervor, besonders angesichts der Ergebnisse der Pisa-Studie und gesellschaftlicher Ereignisse wie dem Amoklauf von Erfurt. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Krise der Arbeitsgesellschaft und der Schulmisere sowie die daraus resultierenden Ausgrenzungsrisiken und Folgen für betroffene Jugendliche. Schließlich wird die Freiburger StrassenSchule als ein Beispiel für eine alternative Pädagogik vorgestellt.
II. Realität der Arbeitsgesellschaft und Legitimationskrise der Schule: Dieses Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen der immer noch weit verbreiteten Illusion der Vollbeschäftigung und der Realität steigender Jugendarbeitslosigkeit. Es analysiert die damit verbundene Legitimationskrise der Schule, da sie für viele junge Menschen ihre Funktion als Wegbereiter für einen erfolgreichen Berufseintritt verloren hat. Der Verlust an Zukunftsperspektiven und die Sinnlosigkeit des Schulbesuchs aus der Sicht vieler Schüler werden kritisch hinterfragt.
III. Frühe und mehrfache Ausgrenzung insbesondere durch Schule: Dieses Kapitel fokussiert auf die frühen Ausgrenzungsrisiken innerhalb des Schulsystems. Es wird betont, dass Schule nicht nur als Ausleseinstanz, sondern als ein wichtiger Lebensraum von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden muss. Die verschiedenen Facetten von Schulverweigerung werden erläutert, von Desinteresse bis zum vollständigen Schulausschluss. Die Kapitel analysieren die Ursachen, die von der Perspektivlosigkeit bis hin zu systemischen Problemen wie dem leistungsorientierten Aufbau des deutschen Schulsystems reichen, welches soziale Ungleichheit reproduziert. Die fehlende Partizipation und die oft abstrakten, lebensfernen Lerninhalte werden als weitere kritische Punkte benannt.
Schlüsselwörter
Schulverweigerung, Arbeitsgesellschaft, Legitimationskrise, Schule, Ausgrenzung, Partizipation, Dialogisches Lernen, Freiburger StrassenSchule, Soziale Ungleichheit, Alternative Pädagogik, Jugendarbeitslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Schulverweigerung im Kontext der Krise der Arbeitsgesellschaft
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Problematik der Schulverweigerung im Kontext der Krise der Arbeitsgesellschaft und des Schulsystems. Sie analysiert die Gründe und Folgen von Schulverweigerung und stellt ein alternatives pädagogisches Modell, die Freiburger StrassenSchule e.V., vor.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Krise der Arbeitsgesellschaft und der Legitimationskrise der Schule, die Ursachen und Facetten von Schulverweigerung, die Folgen für betroffene Jugendliche, das Konzept der Freiburger StrassenSchule als zukunftsfähige Alternative sowie Partizipation und dialogisches Lernen als Schlüssel zur erfolgreichen Integration.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Realität der Arbeitsgesellschaft und Legitimationskrise der Schule, Frühe und mehrfache Ausgrenzung insbesondere durch Schule, Neue Wege durch Partizipation – Die Freiburger StrassenSchule e.V., und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Schulverweigerung und des alternativen pädagogischen Ansatzes.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Gründen und Alternativen zur Schulverweigerung in den Mittelpunkt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Notwendigkeit einer systemischen Veränderung des Schulsystems hervor, insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse der Pisa-Studie und gesellschaftliche Ereignisse wie den Amoklauf von Erfurt. Der Zusammenhang zwischen der Krise der Arbeitsgesellschaft und der Schulmisere sowie die daraus resultierenden Ausgrenzungsrisiken und Folgen für betroffene Jugendliche werden angesprochen. Schließlich wird die Freiburger StrassenSchule als Beispiel für alternative Pädagogik vorgestellt.
Was ist der Fokus von Kapitel II: „Realität der Arbeitsgesellschaft und Legitimationskrise der Schule“?
Dieses Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen der Illusion der Vollbeschäftigung und der Realität steigender Jugendarbeitslosigkeit. Es analysiert die damit verbundene Legitimationskrise der Schule, da sie für viele junge Menschen ihre Funktion als Wegbereiter für einen erfolgreichen Berufseintritt verloren hat. Der Verlust an Zukunftsperspektiven und die Sinnlosigkeit des Schulbesuchs aus der Sicht vieler Schüler werden kritisch hinterfragt.
Worauf konzentriert sich Kapitel III: „Frühe und mehrfache Ausgrenzung insbesondere durch Schule“?
Kapitel III fokussiert auf die frühen Ausgrenzungsrisiken im Schulsystem. Es betont die Bedeutung der Schule als Lebensraum von Kindern und Jugendlichen. Die verschiedenen Facetten der Schulverweigerung werden erläutert, von Desinteresse bis zum vollständigen Schulausschluss. Die Ursachen werden analysiert, von Perspektivlosigkeit bis hin zu systemischen Problemen wie dem leistungsorientierten Aufbau des deutschen Schulsystems, welches soziale Ungleichheit reproduziert. Fehlende Partizipation und lebensferne Lerninhalte werden als kritische Punkte benannt.
Was wird in Kapitel IV: „Neue Wege durch Partizipation – Die Freiburger StrassenSchule e.V.“ beschrieben?
Dieses Kapitel stellt die Freiburger StrassenSchule e.V. als alternatives pädagogisches Modell vor und beschreibt deren Ansatz, der sich auf Interkulturalität, Transprofessionalität, Beziehungsarbeit, dialogisches Lernen, reflektierte Aktion und aktive Reflexion sowie Prozessorientierung, Kontinuität und Nachhaltigkeit stützt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulverweigerung, Arbeitsgesellschaft, Legitimationskrise, Schule, Ausgrenzung, Partizipation, Dialogisches Lernen, Freiburger StrassenSchule, Soziale Ungleichheit, Alternative Pädagogik, Jugendarbeitslosigkeit.
- Arbeit zitieren
- Thomas Haug (Autor:in), 2002, Protagonisten einer neuen Schule - Entwicklung zukunftsfähiger Alternativen durch Partizipation sogenannter Schulverweigerer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33771