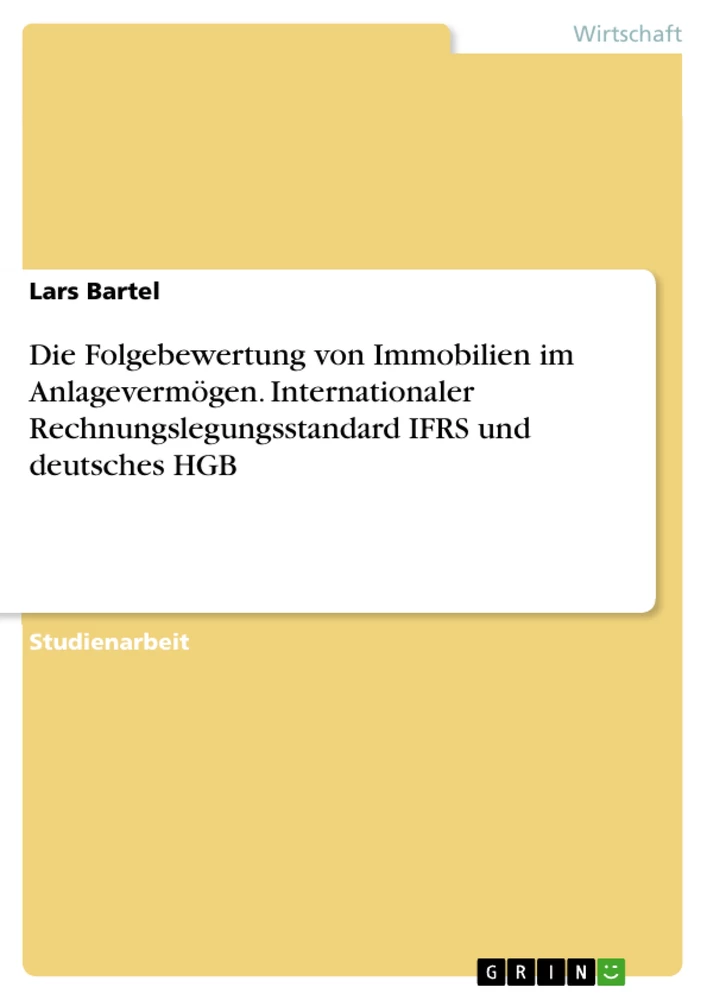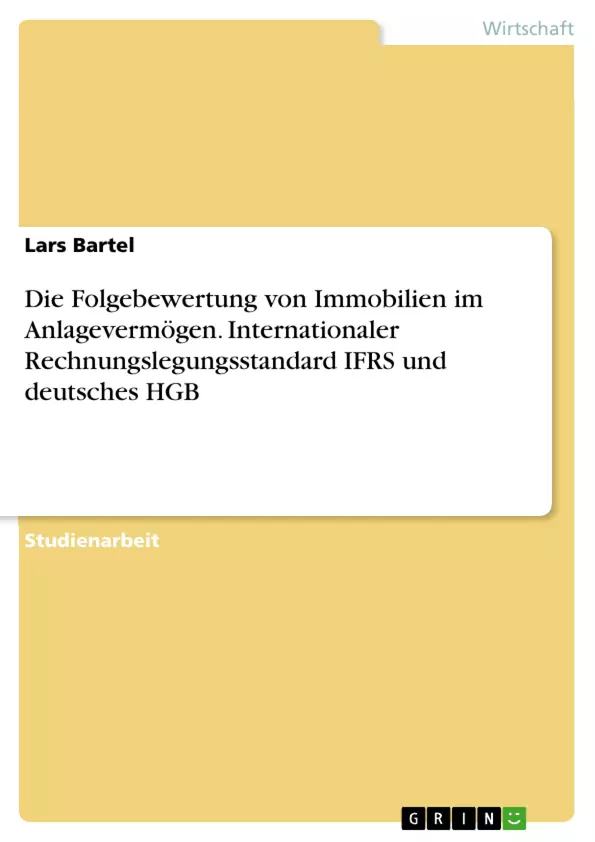Um die Unterschiede zwischen dem deutschen HGB und der Rechnungslegung nach IFRS im Hinblick auf die Bilanzierung im Anlagevermögen ins Licht zu bringen, werden zu Beginn der Arbeit das Anlagevermögen und die Immobilie definiert sowie vom Umlaufvermögen abgegrenzt. Anschließend wird auf die Erstbewertung und die Folgebewertung nach HGB eingegangen und dabei die planmäßige, die außerplanmäßige und die Wertaufholung erklärt. Bevor die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick endet, wird noch die Folgebewertung nach IFRS beschrieben. Der Fair Value und das Cost Model stehen dabei im Mittelpunkt.
Grenzenlose Mobilität, der technische Fortschritt im Bereich des IT, der Telekommunikation und nicht zuletzt der Wegfall des Ost-West-Gegensatzes Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts haben die Integration der Märkte – Stichwort „Globalisierung“ – dramatisch vorangetrieben. Zeitgleich haben sich die weltwirtschaftlichen Kräfte völlig neu verteilt.
Die Rechnungslegung nach international anerkannten Standards gewinnt also mit zunehmender Geschwindigkeit an Bedeutung. Ab 2005 haben die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS die HGB-Bilanzierung für kapitalmarktorientierte Unternehmen abgelöst. Aber auch der Mittelstand erhält die Möglichkeit dieses, in vielen Blickpunkten völlig anders ausgerichtete, Rechnungslegungskonzept einzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Bilanzierung im Anlagevermögen
- 2.1 Definition Anlagevermögen, Immobilien, Abgrenzung zum Umlaufvermögen
- 2.2 Erstbewertung
- 3 Folgebewertung
- 3.1 Folgebewertung nach HGB
- 3.1.1 Planmäßige AfA
- 3.1.2 Außerordentliche AfA
- 3.1.3 Wertaufholung
- 3.2 Folgebewertung nach IFRS
- 3.2.1 Fair Value
- 3.2.2 Cost Model
- 4 Schluss
- 4.1 Fazit
- 4.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Unterschiede in der Bilanzierung von Immobilien im Anlagevermögen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, die jeweiligen Bewertungsmethoden und deren Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögenslage eines Unternehmens zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Anlagevermögen und Immobilien
- Erstbewertung von Immobilien nach HGB
- Folgebewertung von Immobilien nach HGB (planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertaufholung)
- Folgebewertung von Immobilien nach IFRS (Fair Value und Cost Model)
- Vergleich der Bewertungsmethoden nach HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Immobilienbewertung im Anlagevermögen ein und beleuchtet die steigende Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards im Kontext der Globalisierung. Es skizziert die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit, wobei die Unterschiede zwischen HGB und IFRS im Fokus stehen. Der Weg der Untersuchung wird dargelegt, mit der Definition von Anlagevermögen und Immobilien, der Erstbewertung und der Folgebewertung nach HGB und IFRS.
2 Bilanzierung im Anlagevermögen: Dieses Kapitel definiert zunächst Anlagevermögen und Immobilien nach § 247 (2) HGB und grenzt diese vom Umlaufvermögen ab. Es erläutert die Erstbewertung nach § 253 (1) HGB, die sich auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezieht, und beschreibt die Berechnung der Anschaffungskosten anhand konkreter Beispiele wie Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Der Fokus liegt auf der handelsrechtlichen Grundlage der Bewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Bilanzierung von Immobilien im Anlagevermögen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Immobilien im Anlagevermögen, insbesondere mit den Unterschieden zwischen den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Arbeit umfasst eine Einführung, die Bilanzierung im Anlagevermögen, die Folgebewertung nach HGB und IFRS sowie einen Schluss mit Fazit und Ausblick. Sie beinhaltet eine detaillierte Darstellung der Bewertungsmethoden und deren Auswirkungen auf die Vermögenslage eines Unternehmens.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Anlagevermögen und Immobilien; Erstbewertung von Immobilien nach HGB; Folgebewertung von Immobilien nach HGB (planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertaufholung); Folgebewertung von Immobilien nach IFRS (Fair Value und Cost Model); Vergleich der Bewertungsmethoden nach HGB und IFRS.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung mit Problemstellung und Gang der Untersuchung; Bilanzierung im Anlagevermögen mit Definition und Abgrenzung sowie Erstbewertung; Folgebewertung nach HGB (mit planmäßiger und außerordentlicher AfA sowie Wertaufholung) und nach IFRS (mit Fair Value und Cost Model); Schluss mit Fazit und Ausblick.
Was wird in Kapitel 1 (Einführung) behandelt?
Kapitel 1 führt in die Thematik der Immobilienbewertung ein und hebt die wachsende Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards hervor. Es beschreibt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit mit dem Fokus auf die Unterschiede zwischen HGB und IFRS. Der Untersuchungsweg wird skizziert, inklusive Definition von Anlagevermögen und Immobilien sowie der Erst- und Folgebewertung nach HGB und IFRS.
Was wird in Kapitel 2 (Bilanzierung im Anlagevermögen) behandelt?
Kapitel 2 definiert Anlagevermögen und Immobilien nach § 247 (2) HGB und grenzt sie vom Umlaufvermögen ab. Es erläutert die Erstbewertung nach § 253 (1) HGB (Anschaffungs- oder Herstellungskosten) und beschreibt die Berechnung der Anschaffungskosten anhand von Beispielen (Grunderwerbssteuer, Notarkosten). Der Fokus liegt auf der handelsrechtlichen Grundlage der Bewertung.
Welche Bewertungsmethoden werden im Rahmen der Folgebewertung nach HGB behandelt?
Die Folgebewertung nach HGB umfasst die planmäßige AfA, die außerordentliche AfA und die Wertaufholung.
Welche Bewertungsmethoden werden im Rahmen der Folgebewertung nach IFRS behandelt?
Die Folgebewertung nach IFRS umfasst das Fair Value Model und das Cost Model.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Ziel der Seminararbeit ist es, die Unterschiede in der Bilanzierung von Immobilien im Anlagevermögen nach HGB und IFRS zu untersuchen und die jeweiligen Bewertungsmethoden sowie deren Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögenslage eines Unternehmens zu beleuchten.
Welche Rechtsgrundlagen sind relevant?
Die relevanten Rechtsgrundlagen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere § 247 (2) und § 253 (1) HGB, sowie die International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Quote paper
- Lars Bartel (Author), 2016, Die Folgebewertung von Immobilien im Anlagevermögen. Internationaler Rechnungslegungsstandard IFRS und deutsches HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337728