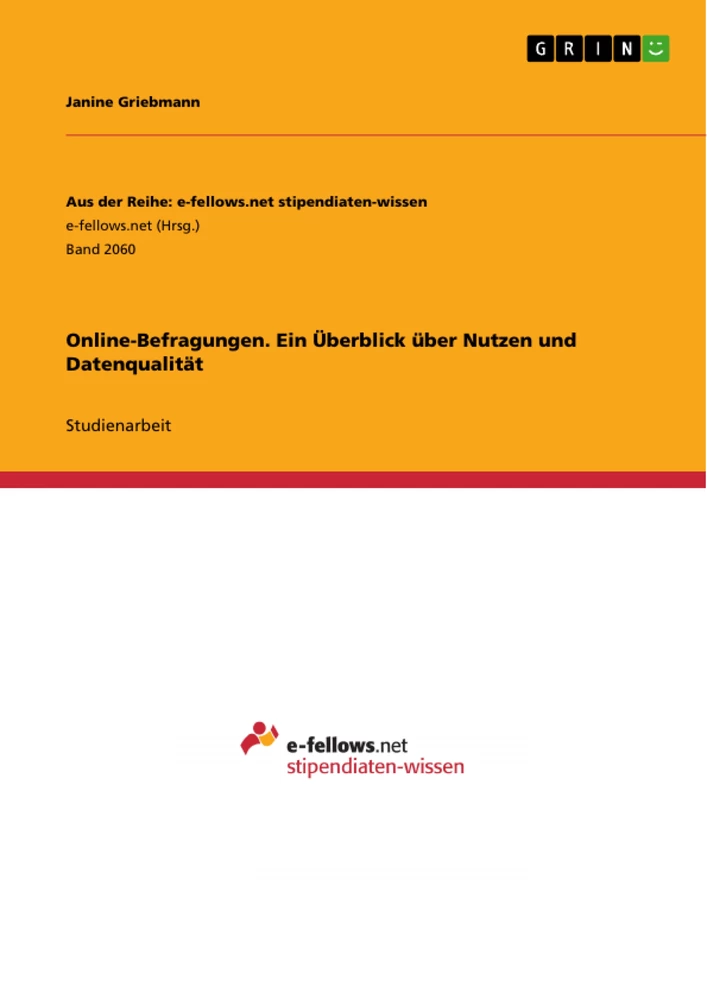Die vorliegende Arbeit möchte einen Überblick über das Thema der Online-Befragung geben. Nach einer kurzen Begriffsbestimmung wird näher auf die Besonderheiten der Online-Befragung eingegangen. Dabei werden neben der technischen Umsetzung vor allem die Probleme bei der Rekrutierung der Teilnehmer sowie die Datenqualität beschrieben. Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der Online-Befragung herausgearbeitet. Anschließend folgt ein Vergleich der Ergebnisse einer Offline- und einer Online-Befragung. Die Arbeit endet mit einem Fazit sowie einem Ausblick.
Online-Befragungen sind besonders in den vergangenen Jahren als Forschungsmethode immer beliebter geworden. Schätzungen zu Folge sind rund ein Drittel aller weltweit durchgeführten Befragungen Online-Befragungen. In Zukunft wird die Zahl weiterhin ansteigen, da die Methode im Gegensatz zu bisherigen Verfahren zahlreiche neue Möglichkeiten bietet: „Mit Online-Befragungen können nahezu unbegrenzt viele Befragte auf der ganzen Welt schnell und zeitgleich kontaktiert werden. Multimediale Hilfsmitte können problemlos in die Befragungen integriert werden, Interviewereinflüsse und Dateneingabe entfallen“.
Im deutschsprachigen Raum werden Online-Befragungen seit etwa 1994 wissenschaftlich erforscht. Anfangs waren viele der auffindbaren Befragungen im Internet mit methodischen und handwerklichen Fehlern übersehen. Daraufhin entstanden Informations- und Ratgeberseiten, die sich meist mit technischen Fragen beschäftigten. 1997 tagte zum ersten Mal die German Research Konferenz. Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Fachtagungen im Bereich der Online-Forschung. Jedes Jahr wird dort über die neuesten Befunde diskutiert. 1998 wurde die Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung gegründet. Sie setzt sich besonders für die Entwicklung und Förderung der Online-Forschung ein. Neben der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Standards gestaltet sie aktiv die Standesregeln der deutschen Marktforschung mit und informiert über neue Methoden und Ansätzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Begriffsbestimmung und Einordnung
- 3 Besonderheiten der Online-Befragung
- 3.1 Technische Umsetzung
- 3.2 Rekrutierung der Teilnehmer
- 3.3 Datenqualität
- 4 Vor- und Nachteile der Online-Befragung
- 5 Anwendungsbeispiel
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über Online-Befragungen. Ziel ist es, die Besonderheiten dieser Methode, einschließlich technischer Umsetzung, Rekrutierung und Datenqualität, zu erläutern und Vor- sowie Nachteile herauszuarbeiten. Ein Anwendungsbeispiel soll die praktische Relevanz verdeutlichen.
- Begriffsbestimmung und Einordnung von Online-Befragungen
- Besonderheiten der technischen Umsetzung von Online-Fragebögen
- Herausforderungen bei der Rekrutierung von Teilnehmern
- Bewertung der Datenqualität bei Online-Befragungen
- Abwägung von Vor- und Nachteilen im Vergleich zu traditionellen Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung präsentiert Online-Befragungen als zunehmend beliebte Forschungsmethode und skizziert deren wachsende Bedeutung im Kontext der Kommunikationsforschung. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Online-Befragung im deutschsprachigen Raum, von anfänglichen methodischen Herausforderungen bis hin zur Etablierung wissenschaftlicher Standards und der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung (DGOF). Der Text unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der Methode, die über reine technische Aspekte hinausgeht.
2 Begriffsbestimmung und Einordnung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Online-Befragung, unterscheidet sie von anderen Befragungsformen und ordnet sie im Kontext qualitativer und quantitativer Methoden ein. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur herangezogen und verglichen. Die Einordnung der Online-Befragung als quantitative Methode wird begründet und mit der Standardisierung des Verfahrens in Verbindung gebracht.
3 Besonderheiten der Online-Befragung: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen der Online-Befragung. Die technische Umsetzung wird beleuchtet, inklusive der Anpassung an verschiedene Geräte und Betriebssysteme. Die Kapitel thematisieren den Aspekt der fehlenden Interviewerpräsenz und die damit verbundenen Anforderungen an die Fragebogengestaltung für eine eindeutige und selbstverständliche Verständlichkeit. Schließlich wird die Bedeutung von Datenschutz und Transparenz für das Vertrauen der Teilnehmer hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Online-Befragung, CAWI, Datenqualität, Rekrutierung, Methoden der Kommunikationsforschung, quantitative Forschung, Fragebogengestaltung, technische Umsetzung, Vor- und Nachteile.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Online-Befragungen: Eine umfassende Übersicht"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über Online-Befragungen. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten dieser Methode, einschließlich technischer Umsetzung, Rekrutierung der Teilnehmer und Datenqualität, sowie einer Abwägung der Vor- und Nachteile im Vergleich zu traditionellen Befragungsmethoden. Ein Anwendungsbeispiel veranschaulicht die praktische Relevanz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Begriffsbestimmung und Einordnung, Besonderheiten der Online-Befragung (inkl. technischer Umsetzung, Rekrutierung der Teilnehmer und Datenqualität), Vor- und Nachteile der Online-Befragung, Anwendungsbeispiel und Fazit und Ausblick.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Ziel ist es, die Besonderheiten von Online-Befragungen zu erläutern und deren Vor- und Nachteile herauszuarbeiten. Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und Einordnung von Online-Befragungen, die technischen Aspekte der Umsetzung von Online-Fragebögen, die Herausforderungen bei der Rekrutierung von Teilnehmern, die Bewertung der Datenqualität und den Vergleich mit traditionellen Methoden.
Welche Besonderheiten der Online-Befragung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die technische Umsetzung von Online-Fragebögen (Anpassung an verschiedene Geräte und Betriebssysteme), die Herausforderungen der Rekrutierung von Teilnehmern, die Bewertung der Datenqualität, den Aspekt der fehlenden Interviewerpräsenz und die damit verbundenen Anforderungen an die Fragebogengestaltung, sowie die Bedeutung von Datenschutz und Transparenz.
Welche Vor- und Nachteile von Online-Befragungen werden diskutiert?
Die Arbeit geht auf die Vor- und Nachteile von Online-Befragungen im Vergleich zu traditionellen Methoden ein, ohne explizit alle Vor- und Nachteile aufzulisten. Diese Abwägung ist ein wichtiger Teil der Arbeit, wird aber nicht in einzelnen Punkten aufgelistet.
Gibt es ein Anwendungsbeispiel?
Ja, die Arbeit enthält ein Anwendungsbeispiel, um die praktische Relevanz von Online-Befragungen zu verdeutlichen. Die genaue Beschreibung des Anwendungsbeispiels findet sich im entsprechenden Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Online-Befragung, CAWI, Datenqualität, Rekrutierung, Methoden der Kommunikationsforschung, quantitative Forschung, Fragebogengestaltung, technische Umsetzung, Vor- und Nachteile.
Wie wird der Begriff der Online-Befragung definiert?
Das Kapitel "Begriffsbestimmung und Einordnung" definiert den Begriff der Online-Befragung, unterscheidet sie von anderen Befragungsformen und ordnet sie im Kontext qualitativer und quantitativer Methoden ein. Dabei werden verschiedene Definitionen aus der Literatur herangezogen und verglichen.
Wie wird die Datenqualität bei Online-Befragungen bewertet?
Die Bewertung der Datenqualität bei Online-Befragungen ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit. Sie wird im Kapitel zu den Besonderheiten der Online-Befragung behandelt und umfasst Aspekte wie die Vermeidung von Fehlern in der Datenerhebung und -aufbereitung.
- Arbeit zitieren
- Janine Griebmann (Autor:in), 2015, Online-Befragungen. Ein Überblick über Nutzen und Datenqualität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337738