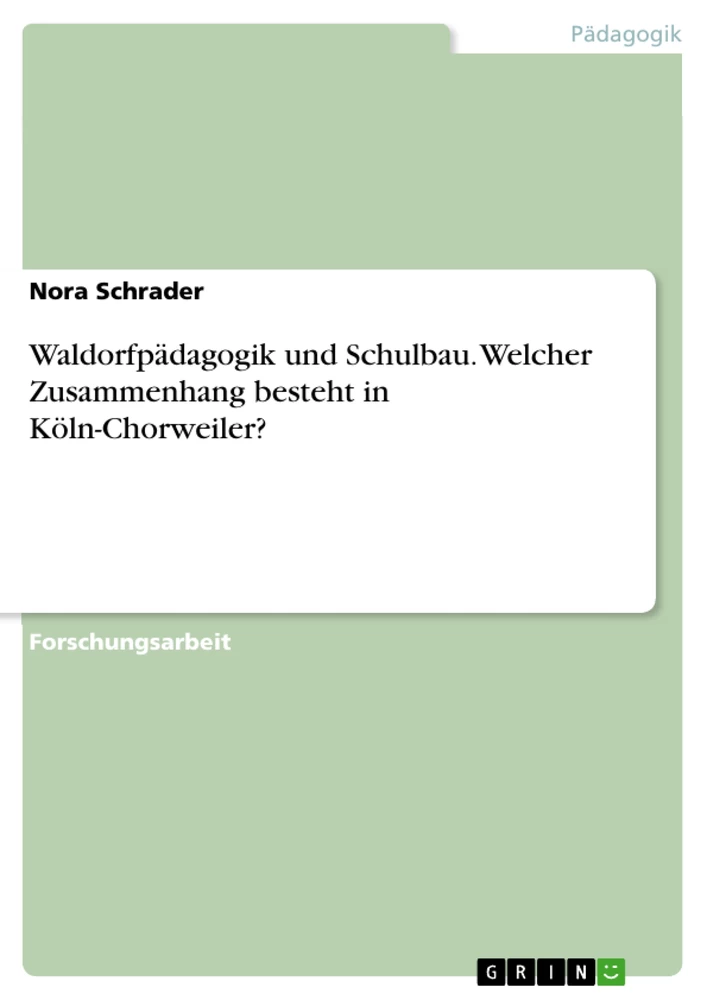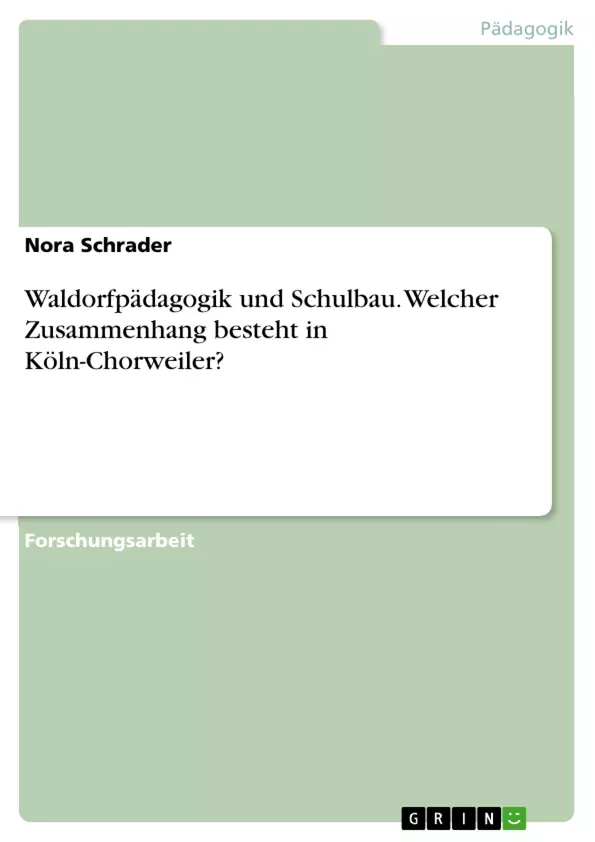Die vorliegende Arbeit thematisiert den Zusammenhang zwischen der baulichen Gestaltung der Freien Waldorfschule Köln und dem dort praktizierten Schulkonzept, das auf pädagogischen Impulsen Steiners basiert.
Beim Zurückdenken an meine Schulzeit habe ich das Bild eines „Betonklotzes“ vor Augen. Dieses Gebäude entstand in den sechziger Jahren und erzielte sowohl durch sein trostlos wirkendes Äußeres als auch durch eine wenig ansprechende Innengestaltung eine abstoßende Wirkung. Das ist keine Seltenheit; in den Sechzigern entstanden vermehrt solche Bauten (vgl. Brenner 2006: 13ff.) und bereits im 19. Jahrhundert glichen Schulen Kasernen, die eine von Drill und Unterordnung geprägte Atmosphäre hatten (vgl. Hintz 2011: 52f.). In der Tat spiegeln Schulen den jeweiligen „historischen und regionalen Habitus oder auch nur Moden“ ihrer Entstehungszeit wider (vgl. BLLV 2013: 23); daneben sind im gleichen Zeitalter bauliche Unterschiede von staatlichen und Reformschulen festzustellen, die pädagogisch zu begründen sind: Mit Aufkommen der Reformpädagogik gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte Kritik an den bestehenden Schulgebäuden ein und Anstöße zu einem Umdenken im pädagogischen Bereich wurden gegeben (vgl. Gass-Bolm 2005: 105). Von nun an sollte „vom Kinde aus“ agiert und selbständiges sowie handlungsorientiertes Lernen erfolgen (Krammer 2009: 25ff.). Um die Leitgedanken dieser Bewegung angemessen umzusetzen, sollten die räumlichen Gegebenheiten der Schulen auf die Bedürfnisse der Lernenden angepasst werden. Eine ansprechendere Gestaltung von Schulgebäuden etablierte sich zunächst generell nicht umfassend (vgl. Gass-Bolm 2005: 105), ist aber seit jeher fester Bestandteil in Waldorf- und heute zunehmend auch in einigen staatlichen Schulen. In den letzten Jahren entstanden mehrere Schulbauten, die auf ihre jeweiligen Benutzer individuell ausgerichtet wurden. Darunter ist die Freie Waldorfschule Köln, die für ihre bauliche Gestaltung eine Auszeichnung bekam (vgl. Architektenkammer NRW o.J.). Diese betrachte ich in der vorliegenden Arbeit detaillierter und möchte folgenden Fragestellungen nachgehen:
Inwiefern unterstreicht die bauliche Gestaltung der Freien Waldorfschule Köln das pädagogische Schulkonzept? Welche Kriterien spielen hierbei eine besondere Rolle?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Impulse Steiners als Basis der Waldorfpädagogik.
- Kurzbiographie Steiners und Definition des Begriffs Anthroposophie.
- Entstehung, Grundlagen und Ziele der Waldorfpädagogik.
- Unterrichtsorientierung an den Entwicklungsphasen der Lernenden.
- Die architektonische Gestaltung von Waldorfschulen.
- Die organische Architektur.
- Beziehungen zwischen Architektur und Mensch
- Der Zusammenhang zwischen Schulbau und -konzept in Köln- Chorweiler.
- Findungs- und Bauplanungsphase.
- Interpretation des Grundrisses.
- Raumunterbringung und zentrale Punkte im Hauptgebäude.
- Raum- und Schulgebäudeform.
- Fotografien als Quellen - zur Methodik
- Bildanalyse der Pausenhalle
- Externe und technische interne Klassifikationsfaktoren.
- Die vorikonographische Ebene
- Die ikonographische Analyse.
- Formale Elemente der Fotografie.
- Symbolbedeutungen nach Steiner
- Die ikonologische Interpretation
- Ästhetische Gestaltung der Pausenhalle - Runde Formen.
- Ästhetische Gestaltung der Pausenhalle - Pflanzen und Baumaterialien.
- Gestaltung der Pausenhalle - Säule.
- Mögliche Bildentstehung und Intuition der Fotografin.
- Kritische Reflexion.
- Zusammenfassung und Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der architektonischen Gestaltung der Freien Waldorfschule Köln und dem dort praktizierten pädagogischen Konzept, das auf den Impulsen Rudolf Steiners basiert. Sie untersucht, inwiefern die bauliche Gestaltung das pädagogische Konzept unterstreicht und welche Kriterien dabei eine besondere Rolle spielen.
- Die Bedeutung der Anthroposophie für die Waldorfpädagogik.
- Die Entwicklungsphasen der Lernenden und ihre Bedeutung für die Unterrichtsgestaltung.
- Die organische Architektur als charakteristisches Merkmal von Waldorfschulen.
- Die Beziehung zwischen Architektur und Mensch im Kontext der Waldorfpädagogik.
- Die Analyse der baulichen Gestaltung der Freien Waldorfschule Köln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Schulbau und -konzept in der Freien Waldorfschule Köln. Sie beleuchtet die historische Entwicklung von Schulbauten und die Bedeutung der Reformpädagogik für die Gestaltung von Lernumgebungen.
Kapitel 2 widmet sich den Impulsen Rudolf Steiners als Grundlage der Waldorfpädagogik. Es umfasst eine Kurzbiographie Steiners und eine Definition des Begriffs Anthroposophie. Anschließend werden die Entstehung, Grundlagen und Ziele der Waldorfpädagogik erläutert, wobei insbesondere die Unterrichtsorientierung an den Entwicklungsphasen der Lernenden im Fokus steht.
Kapitel 3 befasst sich mit der architektonischen Gestaltung von Waldorfschulen. Es werden die Grundlagen der organischen Architektur sowie die Beziehung zwischen Architektur und Mensch im Kontext der Waldorfpädagogik thematisiert.
Kapitel 4 widmet sich dem Zusammenhang zwischen Schulbau und -konzept in Köln-Chorweiler. Es werden die Findungs- und Bauplanungsphase der Freien Waldorfschule Köln vorgestellt und der Grundriss der Schule interpretiert. Die Analyse der Pausenhalle erfolgt mithilfe einer Fotografie, wobei externe und technische interne Klassifikationsfaktoren, die vorikonographische Ebene, die ikonographische Analyse und die ikonologische Interpretation berücksichtigt werden. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Reflexion der Interpretation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Waldorfpädagogik, Anthroposophie, organische Architektur, Schulbau, Lernumgebung, pädagogisches Konzept, Raumgestaltung, Bildanalyse, Symbolbedeutung, und Freie Waldorfschule Köln.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Waldorfpädagogik den Schulbau?
Der Schulbau folgt dem pädagogischen Grundsatz „vom Kinde aus“ und passt die räumlichen Gegebenheiten an die Entwicklungsphasen der Lernenden an.
Was versteht man unter „organischer Architektur“?
Organische Architektur in Waldorfschulen zeichnet sich durch lebendige, oft runde Formen und natürliche Materialien aus, die eine harmonische Beziehung zwischen Mensch und Gebäude fördern sollen.
Welche Besonderheiten weist die Freie Waldorfschule Köln auf?
Die Schule in Köln-Chorweiler wurde für ihre bauliche Gestaltung ausgezeichnet, da ihr Grundriss und ihre Architektur das pädagogische Konzept Steiners besonders konsequent unterstreichen.
Welche Rolle spielen Symbole nach Steiner in der Architektur?
Bestimmte Bauelemente wie Säulen oder die Form der Pausenhalle haben symbolische Bedeutungen, die auf anthroposophischen Impulsen basieren und die Sinne der Schüler anregen sollen.
Was ist Anthroposophie?
Die Anthroposophie ist eine von Rudolf Steiner begründete Weltanschauung, die den Menschen in seiner Gesamtheit aus Körper, Seele und Geist betrachtet und die Basis der Waldorfpädagogik bildet.
Wie unterscheidet sich der Waldorf-Schulbau von staatlichen Schulen der 60er Jahre?
Während staatliche Schulen jener Zeit oft als funktionale „Betonklötze“ gebaut wurden, legen Waldorfschulen Wert auf eine ästhetische, individuell ausgerichtete Lernumgebung.
- Citar trabajo
- M.Ed. Nora Schrader (Autor), 2014, Waldorfpädagogik und Schulbau. Welcher Zusammenhang besteht in Köln-Chorweiler?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337788