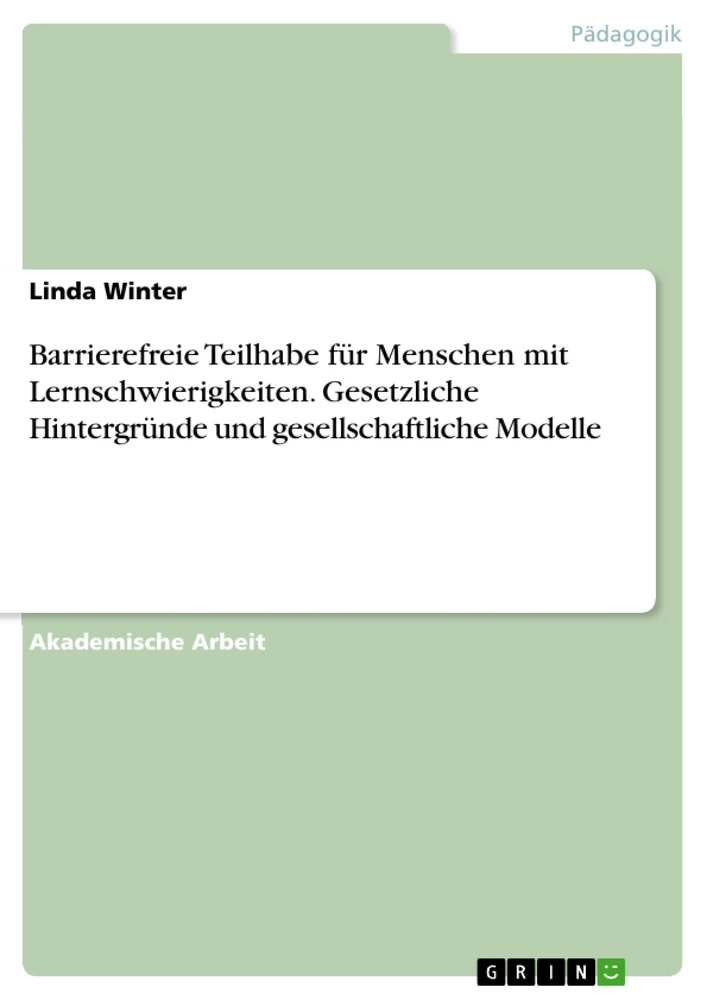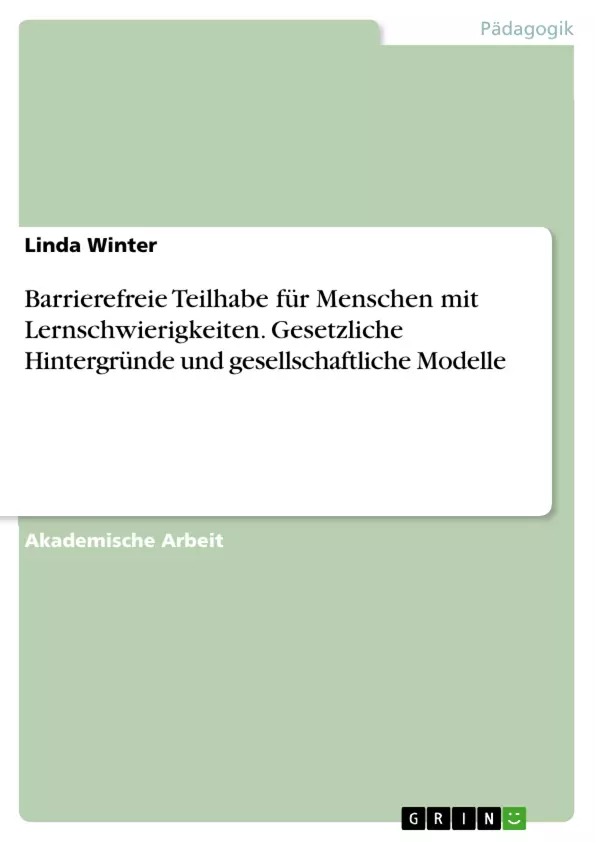Der Begriff der Teilhabe ist in seiner Bedeutung sehr facettenreich. Er impliziert u.a. Mitbestimmung, Mitwirken sowie Teilnahme und dies nicht nur auf politischer Ebene, wie lange Zeit angenommen, sondern auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Laut der World Health Organisation (WHO) kann Teilhabe in den Lebensbereichen „Lernen und Wissensanwendung“, „allgemeine Aufgaben und Anforderungen“, „Kommunikation“, „Mobilität“, „Selbstversorgung“, „häusliches Leben“, „interpersonelle Interaktionen und Beziehungen“, „bedeutende Lebensbereiche“ sowie „gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben“ stattfinden. Teilhabe kann somit als ein freiwilliges und aktives Involviertsein in diese Lebensbereiche verstanden werden.
In einer demokratischen Gesellschaft dient Teilhabe als eine „Sicherung der Demokratie und auch als ein Kriterium der Transparenz und der Gerechtigkeit von Machtsystemen [...].“ (Pluto 2007, 18) Eine Gerechtigkeit bezüglich der Machtsysteme wäre prinzipiell jedoch erst dann gewährleistet, wenn für jede Person die Möglichkeit einer Entscheidungsbeteiligung bestünde. Ein diesbezüglicher Blick auf den Personenkreis „Menschen in marginalen Positionen“ verdeutlicht, dass diesem die Möglichkeit einer Mitbestimmung häufig verwehrt bleibt und sich somit der Begriff der Teilhabe grundsätzlich nicht von dem des „Ausschlusses“ trennen lässt: Häufig stehen daher bei der Teilhabethematik die Aspekte der „Machtherrschaft“ und der „ungleichen Ausgangsvoraussetzungen“ im Vordergrund, weshalb der Teilhabe-Begriff u.a. als „Motor sozialer Integration“ verstanden werden kann.
Abschließend lässt sich festhalten, dass es letztendlich keine einheitliche Definition des Teilhabe-Begriffs geben kann, da dieser in sehr vielen Bereichen (Wirtschaft, Politik, etc.) gebraucht wird und sich dadurch jeweils unterschiedlich gestaltet. Eine Befähigung und Ermächtigung zur Teilhabe, kann also als Auftrag aller in der Gesellschaft Lebenden aufgefasst werden.
Wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Begriff „Teilhabe“ verwendet, geschieht dies vor dem Hintergrund der hier dargelegten Begriffsklärung.
Im Folgenden soll der Teilhabebegriff nochmals in Bezug auf die Thematik „Behinderung“ betrachtet und erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsklärung „Teilhabe“
- Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten - Dabei sein ist nicht alles
- Gesellschaftliche Modelle von Behinderung und ihre Auswirkung auf Teilhabe
- Gesetze zur Teilhabe
- Zum Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik
- Das Behindertengleichstellungsgesetz
- Barrierefreie Teilhabe
- Von der Barrierefreiheit zum „Design für alle“
- Barrierefreie Information und Kommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Teilhabe und dessen Relevanz für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie untersucht die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die Teilhabe ermöglichen oder behindern, sowie die Bedeutung von Inklusion und Barrierefreiheit.
- Begriffliche Klärung von „Teilhabe“ im Kontext von Inklusion und gesellschaftlicher Integration
- Herausforderungen und Chancen der Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Analyse von gesellschaftlichen Modellen von Behinderung und deren Einfluss auf Teilhabe
- Relevanz von Gesetzen und Richtlinien zur Förderung von Teilhabe
- Barrierefreiheit als wichtiger Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffsklärung „Teilhabe“
Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Begriff „Teilhabe“ und seine Bedeutung in verschiedenen Lebensbereichen. Es werden verschiedene Perspektiven auf Teilhabe vorgestellt, darunter die Rolle von Mitbestimmung, Mitwirkung und Teilnahme sowie die Bedeutung von Inklusion und gesellschaftlicher Integration.
Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten - Dabei sein ist nicht alles
Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifischen Herausforderungen und Chancen der Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden die historische Entwicklung des Begriffs „Teilhabe“ im Kontext von Menschen mit Lernschwierigkeiten beleuchtet, sowie die Bedeutung von Selbstbestimmung und Mitbestimmung für eine gelingende Inklusion.
Gesellschaftliche Modelle von Behinderung und ihre Auswirkung auf Teilhabe
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Modellen von Behinderung, die in der Gesellschaft vorherrschen, und deren Einfluss auf die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden die Auswirkungen von Stigmatisierung, Diskriminierung und Exklusion auf die Lebensbedingungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten analysiert.
Gesetze zur Teilhabe
Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden wichtige Gesetze und Richtlinien vorgestellt, die die Inklusion und Teilhabe fördern sollen, sowie die Bedeutung von Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik.
Barrierefreie Teilhabe
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Barrierefreiheit und dessen Bedeutung für eine gelingende Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es werden verschiedene Aspekte der Barrierefreiheit, wie z.B. die Gestaltung von Gebäuden, Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie die Förderung von Inklusion in Bildung und Arbeit, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Teilhabe, Inklusion, Lernschwierigkeiten, gesellschaftliche Modelle von Behinderung, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Gesetze und Richtlinien zur Teilhabe, sowie die Bedeutung von Inklusion in Bildung, Arbeit und Freizeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Teilhabe" für Menschen mit Lernschwierigkeiten?
Teilhabe bedeutet ein freiwilliges und aktives Involviertsein in alle Lebensbereiche wie Lernen, Kommunikation, Mobilität und das soziale Leben, weit über bloße physische Anwesenheit hinaus.
Warum ist Barrierefreiheit auch für die Kommunikation wichtig?
Barrierefreie Information und Kommunikation ermöglicht Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu Wissen und Entscheidungsprozessen, was eine Grundvoraussetzung für echte Mitbestimmung ist.
Welchen Einfluss haben gesellschaftliche Modelle von Behinderung?
Die Modelle bestimmen, ob Behinderung als medizinisches Defizit oder als Ergebnis gesellschaftlicher Barrieren gesehen wird, was wiederum die Inklusionsbemühungen und die Wahrnehmung von Rechten beeinflusst.
Welche Rolle spielt das Behindertengleichstellungsgesetz?
Es bildet den rechtlichen Rahmen für den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, weg von der Fürsorge hin zur Selbstbestimmung und Gleichstellung.
Was versteht man unter "Design für alle"?
Es ist ein Konzept zur Gestaltung von Produkten und Umgebungen, die von allen Menschen ohne spezielle Anpassung genutzt werden können, um Ausgrenzung von vornherein zu vermeiden.
- Citar trabajo
- Linda Winter (Autor), 2010, Barrierefreie Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Gesetzliche Hintergründe und gesellschaftliche Modelle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337870