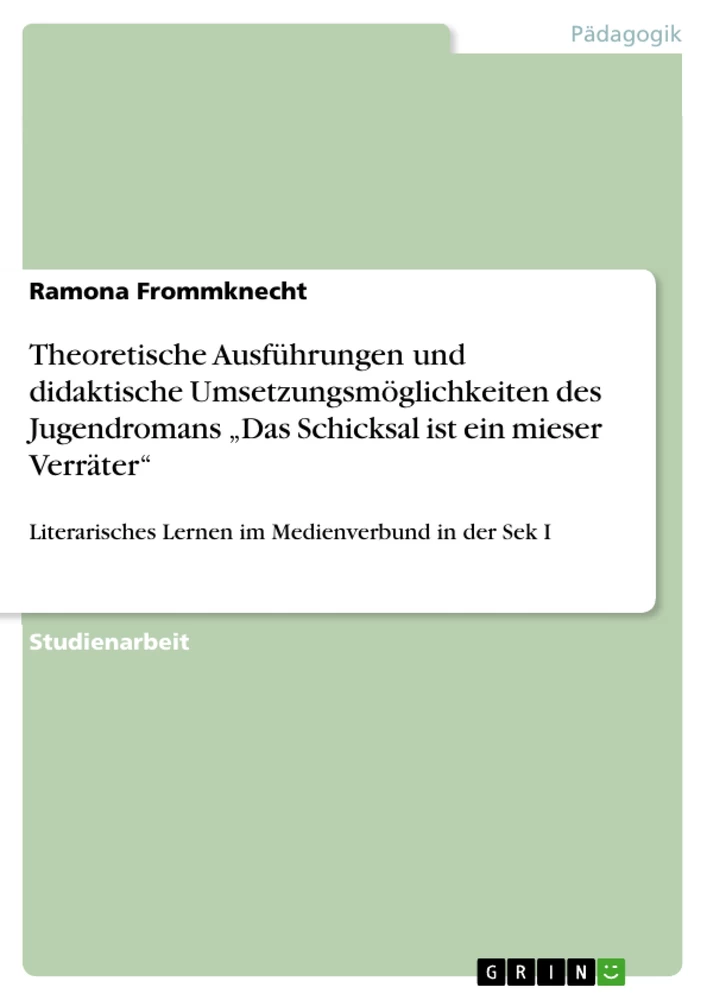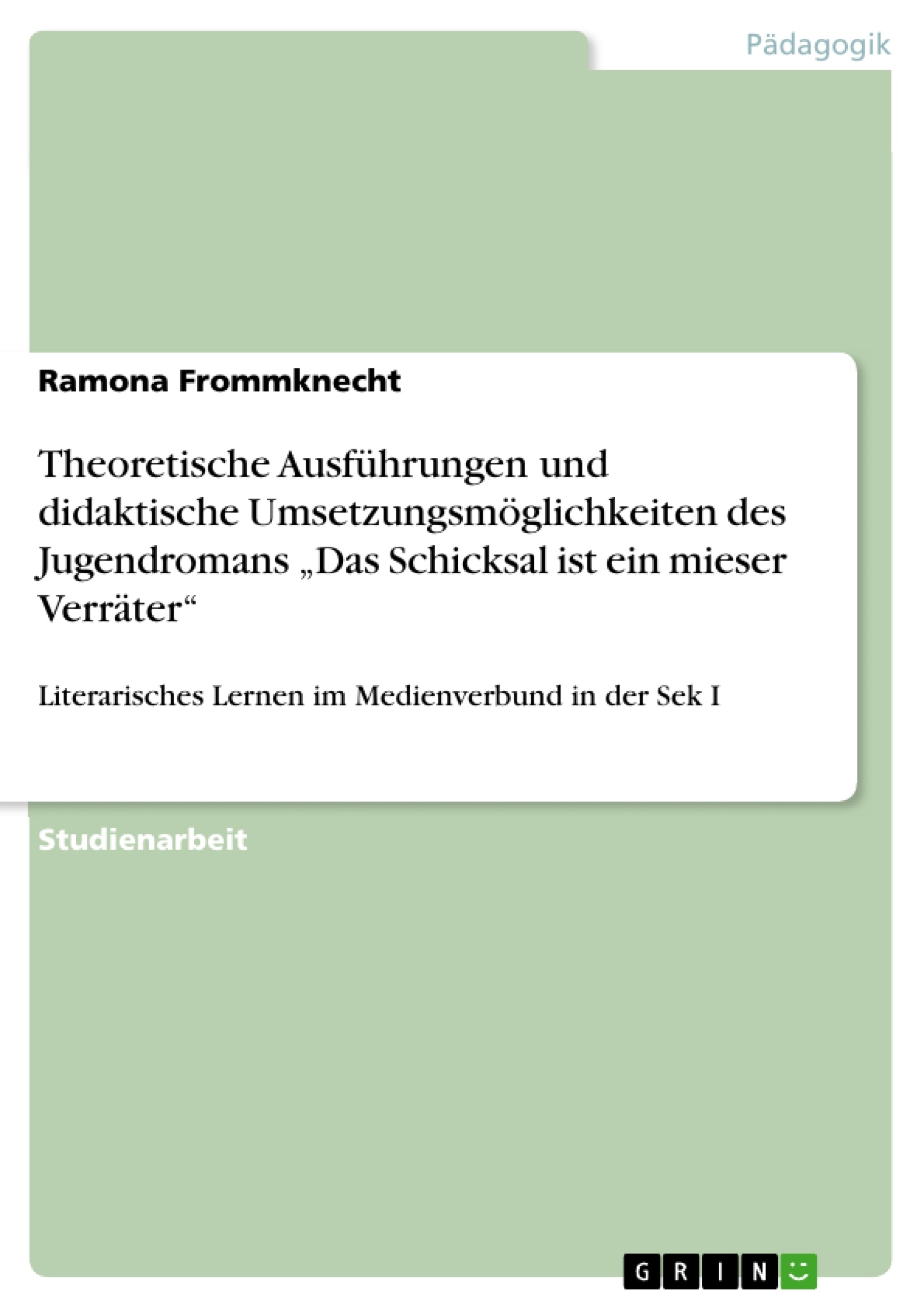Die Förderung der literarischen Kompetenz ist eine zentrale Komponente im Deutschunterricht, welche auch im Bildungsplan 2004 für die Realschule verankert ist. Dabei sollen die SchülerInnen Lese- und Medienkompetenz nicht nur über das Medium Buch, sondern auch mit Hilfe von audiovisuellen Medien erlangen. Außerdem sollen sie sich bewusst mit der Sprache und der Wirkungsweise der Medien beschäftigen und „literarische Vorlagen mit Verfilmungen vergleichen“.
SchülerInnen rezipieren heutzutage in ihrem Alltag Literatur oft in Medienverbünden, zum Beispiel durch Vorlesen, Hörbücher, Filme oder auch CD-ROMs. Durch das wiederholte Erleben der Geschichte in unterschiedlicher medialer Form können erweiterte ästhetische Erfahrungen ermöglicht werden.
In der vorliegenden Hausarbeit sollen zunächst theoretische Grundlagen für die Beschäftigung mit dem Thema Medienverbund gelegt werden. Hierbei wird eine begriffliche Annäherung an das literarische Lernen sowie an den Begriff des Medienverbunds vorgenommen. Anschließend wird die Kinder- und Jugendliteratur im Medienverbund sowie deren historische Entwicklung kurz dargestellt. Daran anknüpfend werden einige Phänomene des Medienverbunds erläutert. Das Potential eines Medienverbunds soll dann exemplarisch am Medienverbund „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ herausgearbeitet werden. Es werden methodisch-didaktische Überlegungen angestellt und zwei didaktische Bausteine für den Einsatz im Unterricht vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Literarisches Lernen
- Begriffliche Annäherung: Was ist ein Medienverbund?
- Kinder- und Jugendliteratur im Medienverbund
- Historische Entwicklung des Medienverbunds in Deutschland
- Phänomene des Medienverbunds
- Medienverbund: „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“
- Didaktische Überlegungen
- Didaktische Bausteine
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des literarischen Lernens im Medienverbund, insbesondere im Kontext der Sekundarstufe I. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des Konzepts sowie die didaktischen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von Medienverbünden im Unterricht ergeben.
- Definition und Bedeutung des literarischen Lernens im Deutschunterricht
- Begriffliche Klärung des Medienverbunds und seiner Erscheinungsformen
- Analyse der historischen Entwicklung und aktuellen Phänomene des Medienverbunds in der Kinder- und Jugendliteratur
- Didaktische Ansätze für die Integration von Medienverbünden in den Unterricht
- Exemplarische Analyse des Medienverbunds „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ und dessen Potenzial für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung des literarischen Lernens im Medienverbund im Kontext des Deutschunterrichts.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des literarischen Lernens und beleuchtet die verschiedenen Aspekte, die mit diesem Konzept verbunden sind. Es geht zudem auf den Begriff des Medienverbunds ein und beschreibt seine verschiedenen Erscheinungsformen.
- Kinder- und Jugendliteratur im Medienverbund: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle des Medienverbunds in der Kinder- und Jugendliteratur und beleuchtet die historische Entwicklung und aktuelle Trends.
- Medienverbund: „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“: Dieses Kapitel analysiert den Medienverbund „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ im Detail und beleuchtet dessen Potenzial für den Deutschunterricht.
- Didaktische Überlegungen: Dieser Abschnitt geht auf die didaktischen Implikationen des Medienverbunds ein und präsentiert verschiedene methodische Ansätze für den Einsatz im Unterricht.
- Didaktische Bausteine: In diesem Kapitel werden konkrete didaktische Bausteine für den Einsatz des Medienverbunds „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ im Unterricht vorgestellt.
Schlüsselwörter
Literarisches Lernen, Medienverbund, Kinder- und Jugendliteratur, Film, Hörbuch, Didaktik, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Medienverbund im Deutschunterricht?
Ein Medienverbund bezeichnet das Erleben einer Geschichte über verschiedene Kanäle, wie Buch, Hörbuch und Film (z. B. „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“).
Welche Vorteile bietet der Medienverbund für Schüler?
Durch die wiederholte Rezeption in unterschiedlichen medialen Formen können erweiterte ästhetische Erfahrungen und eine höhere Medienkompetenz ermöglicht werden.
Wie wird literarisches Lernen in diesem Kontext definiert?
Literarisches Lernen umfasst die Fähigkeit, literarische Vorlagen mit deren Verfilmungen zu vergleichen und die spezifische Wirkungsweise der Medien zu verstehen.
Welche didaktischen Bausteine werden für den Roman vorgeschlagen?
Die Arbeit stellt zwei Bausteine vor, die den Einsatz von Buch und audiovisuellen Medien in der Sekundarstufe I methodisch verknüpfen.
Warum ist „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ besonders geeignet?
Der Jugendroman bietet durch seine hohe emotionale Relevanz und die Existenz erfolgreicher Adaptionen ein großes Potenzial für inklusiven und motivierenden Unterricht.
- Quote paper
- Ramona Frommknecht (Author), 2016, Theoretische Ausführungen und didaktische Umsetzungsmöglichkeiten des Jugendromans „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337972