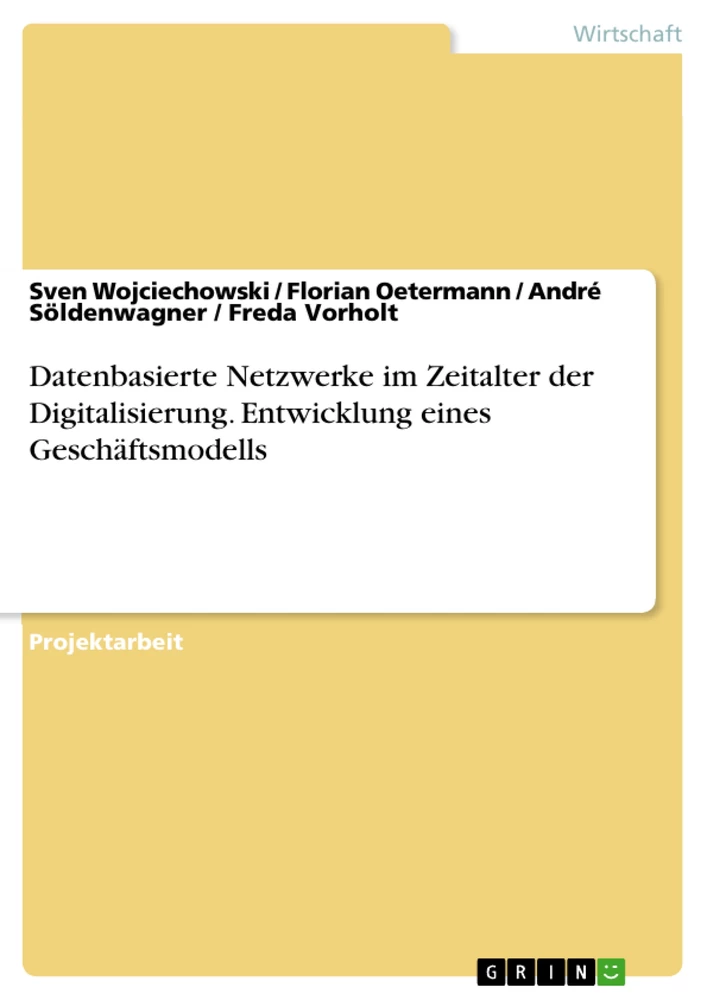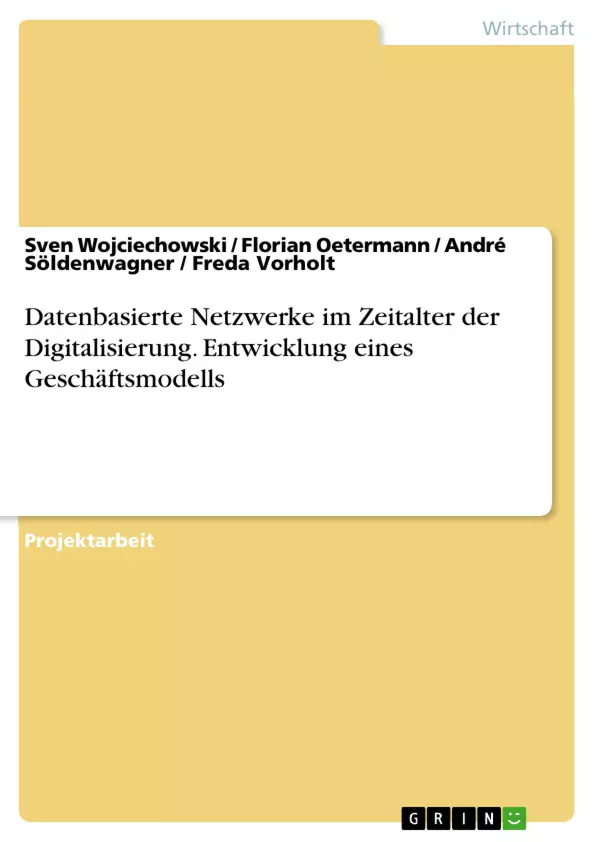Die heutige Situation ist geprägt durch den Einfluss von sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel dem demographischen Wandel, der Industrie 4.0 oder der Digitalisierung. Das Resultat dieser Entwicklungen für das produzierende Gewerbe ist unter anderem eine Zunahme individueller Kundenwünsche, steigender Kostendruck sowie eine ausgeprägte Marktdynamik. In Kombination mit wachsenden Funktions- und Qualitätsanforderungen der Kunden an die Produkte sowie an die Lieferzeit, Lieferfähigkeit, Liefertreue und Lieferflexibilität ergeben sich für die Unternehmen neue Herausforderungen an die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit, die Leistungsfähigkeit und den Leistungsumfang ihrer Maschinen und Anlagen.
Eine Antwort der Unternehmen auf die steigenden Anforderungen im Zeitalter der Digitalisierung ist die engere Zusammenarbeit in Form von Netzwerken. Dies gilt zum einen für den operativen Betrieb, wo durch die Schaffung von Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine ganzheitlich optimale Produktion für alle Partner realisiert werden kann, zum anderen in Bezug auf die schnellere Identifikation und Anwendung von Best-Practices und Benchmarks, mit dem Ziel voneinander zu lernen.
Bezüglich der erforderlichen Zielsetzung zur Anpassung der Produktion an die Entwicklungen des Marktes ist die Instandhaltung in ihrer konventionellen Rolle seit jeher für die Betreuung der Maschinen und Anlagen im Betrieb verantwortlich. Damit verfügt die Instandhaltung über einen unmittelbaren Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Die Potenziale von Netzwerken in der Instandhaltung sind in diesem Kontext bisher weder vollständig bekannt noch ist die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in dieser Hinsicht bisher ausreichend in Wirtschaft und Wissenschaft erprobt, untersucht und erschlossen worden.
Aus diesem Grund zeigt die vorliegende Arbeit anhand der Entwicklung eines konkreten Geschäftsmodells die speziellen Potenziale eines daten- und informationsbasierten Netzwerks in der Instandhaltung auf. Auf der Basis der Zusammenführung von Daten, Informationen und Wissen bei einem neutralen Serviceportal bieten sich gleichermaßen mannigfaltige operative und strategische Vorteile für Anlagenbetreiber und Anlagenhersteller.
Inhaltsverzeichnis
- Potenziale von Netzwerken für die Instandhaltung
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Netzwerke
- Problemstellung und Zielsetzung
- Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Instandhaltung
- Charakteristika von Netzwerken
- Vor- und Nachteile von Netzwerken
- Zwischenfazit Grundlagen
- Marktanalyse
- Wettbewerbsanalyse
- Marktpotenzial
- Zwischenfazit Marktanalyse
- Entwicklung eines Geschäftsmodells
- Business Model Canvas
- Vorstellung des Geschäftsmodells
- Validierung des Geschäftsmodells
- SWOT-Analyse
- Machbarkeitsanalyse
- Rechtliche Machbarkeit
- Technische Machbarkeit
- Zwischenfazit Validierung
- Abschlussbetrachtung
- Zusammenfassung
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Business Modell Canvas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines datenbasierten Netzwerks im Bereich der Instandhaltung. Das Ziel ist es, ein Geschäftsmodell zu konzipieren, welches die Potenziale solcher Netzwerke für Anlagenbetreiber und Anlagenhersteller erschließt.
- Herausforderungen der Instandhaltung im Kontext der Digitalisierung
- Potenziale von Netzwerken in der Instandhaltung
- Entwicklung eines datenbasierten Geschäftsmodells für ein Netzwerk in der Instandhaltung
- Validierung des Geschäftsmodells durch SWOT-Analyse und Machbarkeitsstudie
- Zusammenfassung und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Situation in der Instandhaltung im Kontext der Digitalisierung beleuchtet und die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit definiert. Anschließend werden in Kapitel 2 die Grundlagen von Instandhaltung und Netzwerken behandelt. Kapitel 3 widmet sich einer Marktanalyse, die den Wettbewerb und das Marktpotenzial für datenbasierte Netzwerke in der Instandhaltung untersucht. In Kapitel 4 wird das Geschäftsmodell für ein solches Netzwerk entwickelt und mithilfe des Business Model Canvas visualisiert. Schließlich erfolgt in Kapitel 5 die Validierung des Geschäftsmodells durch eine SWOT-Analyse und eine Machbarkeitsstudie. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf datenbasierte Netzwerke in der Instandhaltung, Digitalisierung, Geschäftsmodellentwicklung, Business Model Canvas, SWOT-Analyse, Machbarkeitsstudie, Anlagenbetreiber, Anlagenhersteller, Industrie 4.0.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bieten Netzwerke in der Instandhaltung?
Sie ermöglichen Transparenz entlang der Wertschöpfungskette, den Austausch von Best-Practices und eine effizientere Betreuung von Maschinen und Anlagen.
Was ist das Ziel des entwickelten Geschäftsmodells?
Das Ziel ist die Schaffung eines daten- und informationsbasierten Netzwerks über ein neutrales Serviceportal für Anlagenbetreiber und Hersteller.
Wie wird das Geschäftsmodell validiert?
Die Validierung erfolgt durch eine SWOT-Analyse sowie eine Prüfung der technischen und rechtlichen Machbarkeit.
Was ist der Business Model Canvas?
Ein strategisches Werkzeug zur Visualisierung und Entwicklung von Geschäftsmodellen, das in dieser Arbeit zur Darstellung des Netzwerks genutzt wird.
Welche Rolle spielt Industrie 4.0 für die Instandhaltung?
Industrie 4.0 treibt die Digitalisierung voran, was neue Anforderungen an die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen stellt, die durch Netzwerke besser bewältigt werden können.
- Citar trabajo
- Sven Wojciechowski (Autor), Florian Oetermann (Autor), André Söldenwagner (Autor), Freda Vorholt (Autor), 2016, Datenbasierte Netzwerke im Zeitalter der Digitalisierung. Entwicklung eines Geschäftsmodells, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338156