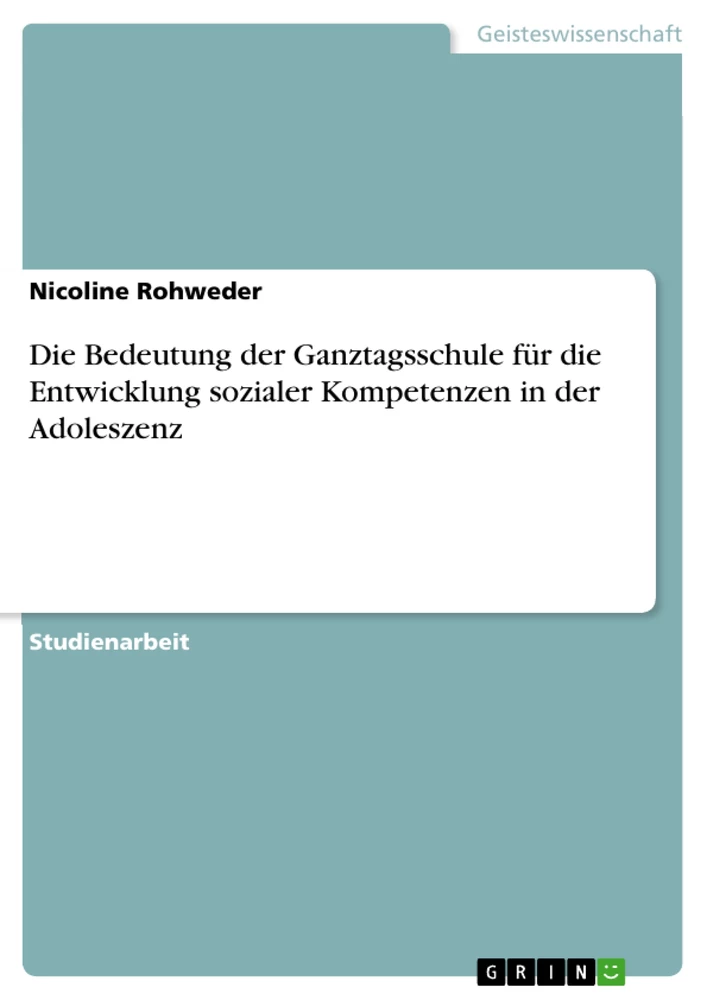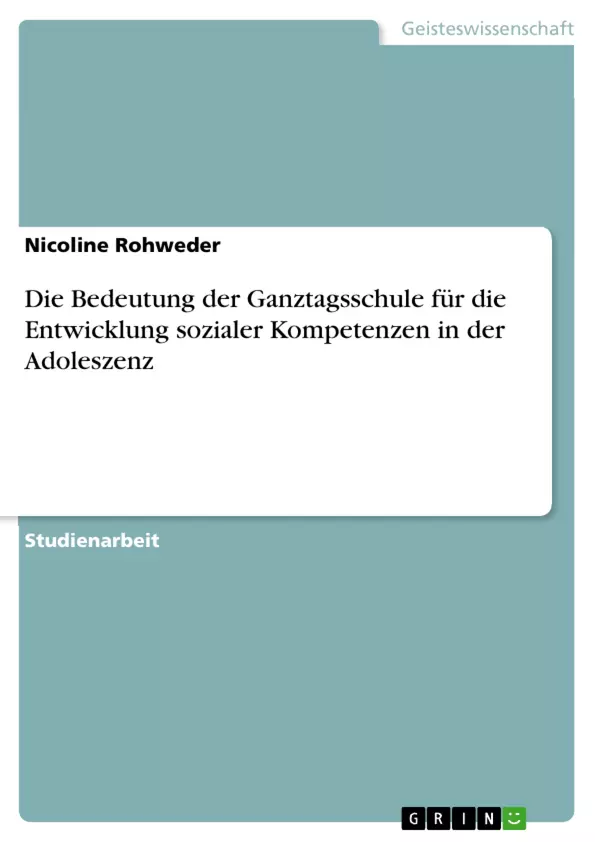Aufgrund der Auswirkungen des demografischen Wandels, die bereits gegenwärtig spürbar sind und erheblichen Einfluss auf Familienstrukturen und Lebensformen nehmen, verändern sich die sozialen Kontakte Jugendlicher erheblich. Die Anzahl der Geschwisterkinder sinkt in Folge dieser Entwicklungen ebenso wie die Anzahl der Jugendlichen, die in der Nachbarschaft leben. Diese Entwicklungen nehmen Einfluss auf den Alltag von Jugendlichen und betont den Lebensort Schule als Sozialisationsinstanz und Treffpunkt für Gleichaltrige. Zudem lässt sich gegenwärtig feststellen, dass nie zuvor SchülerInnen so lange zur Schule gegangen sind wie im Jahre 2016.
In Deutschland verbringen SchülerInnen zwischen 13 0000 und 15 000 Stunden Unterricht allein im allgemeinbildenden Schulwesen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das Leben vieler Familien sich zunehmend in den eigenen Wohnbereich verlagert und öffentliche Flächen immer seltener als Freizeiträume für Jugendliche verwendet werden. Veränderungen im Erziehungsstil, die ebenfalls auf gesellschaftliche und technokratische Veränderungen zurück zu führen sind, führen zu einer stärkeren Kontrolle Jugendlicher seitens der Eltern, die von PädagogInnen durchaus kritisch betrachtet wird.
Die folgende Ausarbeitung beschäftigt sich in Anbetracht dieser gesellschaftlichen Veränderungsprozesse mit der Fragestellung: Welche Bedeutung gewinnt die Ganztagsschule bezüglich der Entwicklung sozialer Kompetenzen von Jugendlichen? Ziel dieser Ausarbeitung ist es, im Sinne dieser Fragestellung die Bedeutung der Ganztagsschule für die Vermittlung sozialer Kompetenzen herauszuarbeiten und anschließend Möglichkeiten aufzuzeigen, die sozialen Kompetenzen von Jugendlichen in der Ganztagsschule zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Schule als Sozialisationsinstanz
- Die Bedeutung von Peers bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz
- Die Ganztagsschule als Ort des sozialen Lernens
- Jugendliche zwischen schulischer Ordnung und Peerkultur
- Möglichkeiten zur Förderung der Sozialkompetenz in Ganztagsschulen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Bedeutung der Ganztagsschule für die Entwicklung sozialer Kompetenzen von Jugendlichen. Ziel ist es, die Rolle der Ganztagsschule bei der Vermittlung sozialer Kompetenzen zu beleuchten und Möglichkeiten zur Förderung dieser Kompetenzen aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Schule als Sozialisationsinstanz im Kontext des demografischen Wandels
- Die Rolle von Peers bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz
- Die Ganztagsschule als Ort des sozialen Lernens und die Spannungen zwischen schulischer Ordnung und Peerkultur
- Möglichkeiten zur Förderung sozialer Kompetenzen in der Ganztagsschule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen gesellschaftlichen Wandel und dessen Einfluss auf die sozialen Kontakte von Jugendlichen. Sie stellt die Bedeutung der Schule als Sozialisationsinstanz und die wachsende Bedeutung der Ganztagsschule im Kontext veränderter Familienstrukturen und Lebensformen heraus. Die zentrale Fragestellung der Ausarbeitung wird formuliert: Welche Bedeutung hat die Ganztagsschule für die Entwicklung sozialer Kompetenzen von Jugendlichen?
Die Bedeutung von Schule als Sozialisationsinstanz
Dieses Kapitel behandelt die wachsende Bedeutung von Schule als Sozialisationsinstanz im Kontext der Bildungsexpansion und des Ausbaus von Ganztagsschulen. Der Einfluss von Schule auf die sozialen Kontakte von Kindern und Jugendlichen wird diskutiert, wobei die veränderten Familienstrukturen und das neue Erziehungsparadigma in der postmodernen Kindheit eine Rolle spielen.
Die Bedeutung von Peers bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz
Dieses Kapitel unterscheidet zwischen Peers und Freundschaftsbeziehungen und beleuchtet die Bedeutung von Peers als Unterstützer bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz. Die Bedeutung von Peers für die Aneignung sozialer Kompetenzen wird hervorgehoben.
Die Ganztagsschule als Ort des sozialen Lernens
Dieser Abschnitt untersucht die Ganztagsschule als Ort des sozialen Lernens. Dabei wird das Spannungsverhältnis zwischen schulischer Ordnung und Peerkultur für Jugendliche in der Ganztagsschule diskutiert. Die Bedeutung der Ganztagsschule für die Förderung sozialer Kompetenzen steht im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Ausarbeitung sind: Ganztagsschule, soziale Kompetenzen, Adoleszenz, Sozialisationsinstanz, Peers, Peerkultur, schulische Ordnung, Entwicklungsaufgaben, Bildungsexpansion, demografischer Wandel, Familienstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gewinnt die Ganztagsschule an Bedeutung für die Sozialisation?
Durch den demografischen Wandel, sinkende Geschwisterzahlen und den Rückzug des Familienlebens in den Wohnbereich wird die Schule zum zentralen Ort für soziale Kontakte.
Was ist die zentrale Fragestellung dieser Ausarbeitung?
Die Arbeit untersucht, welche Bedeutung die Ganztagsschule für die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Jugendlichen in der Adoleszenz hat.
Welche Rolle spielen Peers in der Adoleszenz?
Peers (Gleichaltrige) sind essenziell für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und dienen als wichtiges Lernfeld für soziale Kompetenzen.
Welches Spannungsverhältnis herrscht in der Ganztagsschule?
Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der formalen schulischen Ordnung und der informellen Peerkultur der Jugendlichen.
Wie lange verbringen deutsche Schüler durchschnittlich in der Schule?
Schüler verbringen allein im allgemeinbildenden Schulwesen zwischen 13.000 und 15.000 Stunden im Unterricht.
- Quote paper
- Nicoline Rohweder (Author), 2015, Die Bedeutung der Ganztagsschule für die Entwicklung sozialer Kompetenzen in der Adoleszenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338262