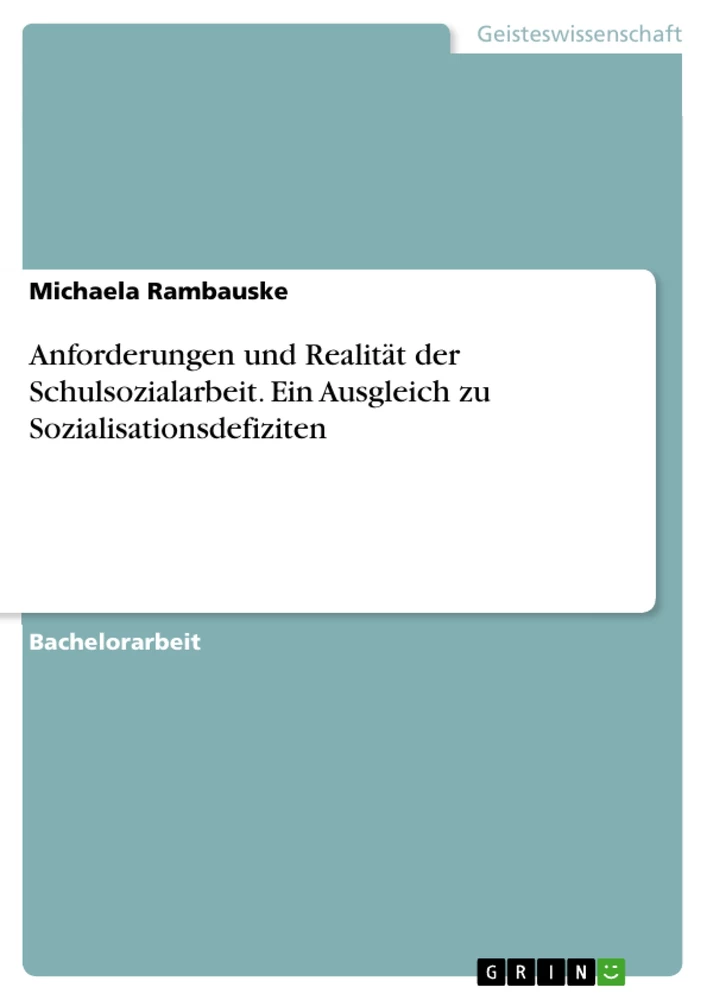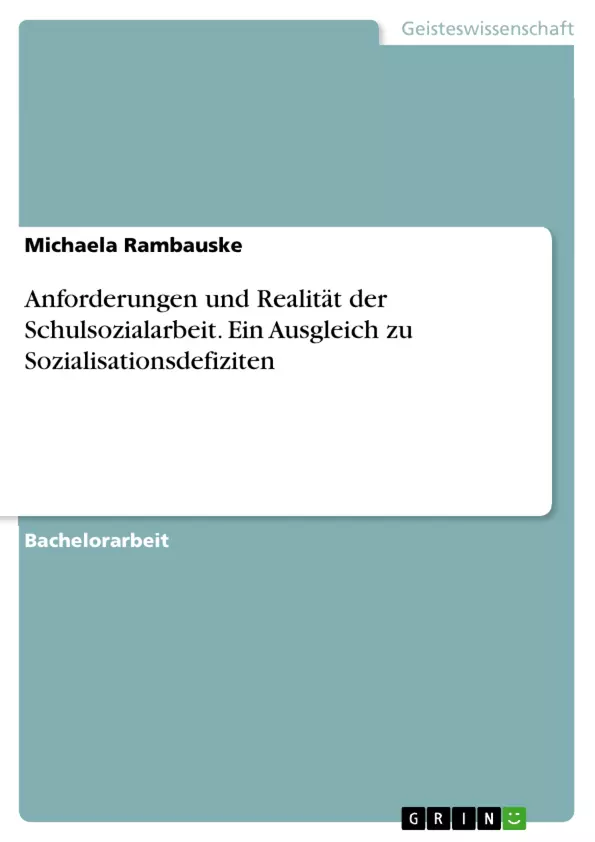Die Sozialisationsinstanz „Familie“ gerät seit geraumer Zeit ins Wanken. In früheren Jahren wuchsen Kinder, meist mit Geschwistern, zusammen mit beiden Elternteilen in einer so genannten „Normalfamilie“ auf. Die Grundbedürfnisse, wie Liebe, Geborgenheit, Verantwortung, Wertschätzung und Anerkennung erfuhren sie hauptsächlich im engsten Kreis der Familie. Die Sozialisationsinstanz „Familie“ war somit in erster Linie für die positive Entwicklung und Sozialisation des Kindes verantwortlich.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die traditionelle Form der Familie aufgrund vielschichtiger gesellschaftlicher Veränderungen stark verändert. Heute werden Familientypen wie „Patchwork“, allein erziehende Mütter oder Väter, gleichgeschlechtliche Paare mit eigenen Kindern einzelner Partner, vom Paar adoptierte Kinder oder auch Pflegeeltern zu den alltäglichen Familienformen gezählt. Zum Alltag der Kinder gehören immer öfters Scheidungen, laufend wechselnde Partner/innen, verschiedene Bezugspersonen, die zunehmenden Berufstätigkeit der Mutter oder das Fehlen von Geschwistern. Diese strukturellen Veränderungen greifen in die Entwicklung und Sozialisation des Kindes ein.
Die Pädagogen und Pädagoginnen in den Schulen können all diese Bereiche, die normalerweise von einer Familie abgedeckt werden unter dem zunehmenden Leistungs- und Lehrplandruck nicht zusätzlich bewältigen. Der Ruf nach einer Lösung wird immer deutlicher vernehmbar. In Zusammenarbeit mit den Lehrenden sollen die Schulsozialarbeiter/innen eine Ausgleichsfunktion schaffen. Ihre Arbeit richtet sich sowohl an die Kinder und Jugendliche, als auch an die Lehrkräfte und die Eltern. Die Schulsozialarbeit erleichtert vielen Familien, Schulen und Lehrkörpern den Alltag. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sehen die Kinder ganzheitlich und aus einem anderen Blickwinkel als die Lehrperson oder die Eltern. Sie können den Kindern und Jugendlichen bei vielfältigen Problemlagen aufgrund ihrer Ausbildung Handlungsalternativen und realistische Lebensperspektiven bieten.
Da das Handlungsspektrum der Schulsozialarbeit weder inhaltlich klar formuliert oder klar abgegrenzt ist, sind die Rahmenbedingungen für die Arbeit an den jeweiligen Schulen sehr verschieden und ebenso die individuellen Problemlagen der Schüler/innen stark differieren, kann vor allem die Grenze für die sozialarbeiterische Intervention zu den Eltern nicht klar gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulsozialarbeit als Teilbereich der Sozialen Arbeit
- Definitionen der Schulsozialarbeit
- Historische Entwicklung der Schulsozialarbeit
- Zunehmender Bedarf an Schulsozialarbeit
- Anforderungen an die Schulsozialarbeit
- Zwischenfazit
- Leistungsspektrum und Aufgaben der Schulsozialarbeit
- Arbeitsbereich Individuelle Orientierung und Hilfe
- Arbeitsbereich Förderung des sozialen Lernens
- Arbeitsbereich Bildungsbedingungen
- Berufsbild Schulsozialarbeit
- Spezifische fachliche Anforderungen
- Kommunikative Anforderungen
- Formale Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren
- Qualitätsfaktoren der Schulsozialarbeit
- Methoden der Schulsozialarbeit
- Methodische Einsatzbereiche
- Methodisches Dreieck
- Methodengruppen und zugehörige Methoden
- Auswahl der Methoden
- Zwischenfazit
- Familie und Schulsozialarbeit
- Entwicklungstheorie
- Familie
- Theoretische Grundlage und Definition
- Familie im Wandel der Zeit
- Sozialisation und Stabilisierung durch Familie
- Familie und problematisches Verhalten
- Negative Einflussfaktoren
- Aggression
- Übernahme elterlicher Funktionen durch die Schule
- Zwischenfazit
- Aufgabenfelder und Trennlinien Eltern und Soziale Arbeit
- Direkte Einbeziehung der Eltern
- Räumliche Trennlinien
- Zeitliche Trennlinien
- Möglichkeiten im Rahmen der Ganztagesbetreuung
- Direkte Einbeziehung der Eltern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Beitrag der Schulsozialarbeit zur Ergänzung der Sozialisationsinstanz Familie im Kontext des gesellschaftlichen Wandels, der zu fragmentierten Familienstrukturen führt. Die Arbeit analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit, der Schule und der Familie im Hinblick auf die Herausforderungen, die durch den Wandel der Familienstrukturen entstehen.
- Entwicklung und Aufgaben der Schulsozialarbeit
- Die Rolle der Familie in der Sozialisation
- Die Herausforderungen durch den Wandel von Familienstrukturen
- Mögliche Interventionen und Aufgabenfelder der Schulsozialarbeit
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Familie und Schulsozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Definition und historische Entwicklung der Schulsozialarbeit sowie den zunehmenden Bedarf an dieser Leistung. Kapitel 3 fokussiert auf das Leistungsspektrum und die Aufgaben der Schulsozialarbeit, einschließlich der spezifischen Anforderungen an das Berufsbild. Kapitel 4 analysiert Qualitätsfaktoren und Methoden der Schulsozialarbeit. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Familie als Sozialisationsinstanz und untersucht die Auswirkungen des Familienwandels auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Kapitel 6 diskutiert Aufgabenfelder und Trennlinien zwischen Eltern und sozialer Arbeit im Hinblick auf die direkte Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Schulsozialarbeit.
Schlüsselwörter
Schulsozialarbeit, Sozialisation, Familie, Familienwandel, Familienstrukturen, fragmentierte Familien, Anforderungen, Qualitätsfaktoren, Methoden, Interventionen, Zusammenarbeit, Schule, Elternarbeit, Ganztagesbetreuung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Schulsozialarbeit heute immer wichtiger?
Durch den gesellschaftlichen Wandel und fragmentierte Familienstrukturen (z.B. Patchwork, Alleinerziehende) entstehen Sozialisationsdefizite, die Schulen allein nicht mehr auffangen können.
Was sind die Kernaufgaben der Schulsozialarbeit?
Zu den Aufgaben gehören individuelle Hilfe für Schüler, die Förderung sozialen Lernens, die Verbesserung von Bildungsbedingungen sowie die Beratung von Eltern und Lehrkräften.
Wie ergänzt die Schulsozialarbeit die Sozialisationsinstanz Familie?
Sie bietet Kindern einen ganzheitlichen Blickwinkel, vermittelt Handlungsalternativen bei Problemen und schafft einen Ausgleich zu fehlenden familiären Routinen oder Geborgenheit.
Welche fachlichen Anforderungen werden an Schulsozialarbeiter gestellt?
Neben pädagogischem Fachwissen sind hohe kommunikative Kompetenzen, Methodenkenntnisse (z.B. methodisches Dreieck) und die Fähigkeit zur Krisenintervention erforderlich.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern aus?
Die Arbeit diskutiert die direkte Einbeziehung der Eltern sowie die notwendigen räumlichen und zeitlichen Trennlinien, um eine professionelle Unterstützung zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt die Ganztagesbetreuung für die Schulsozialarbeit?
Die Ganztagesschule bietet erweiterte Möglichkeiten für sozialarbeiterische Interventionen und die Übernahme von Funktionen, die früher primär im familiären Umfeld lagen.
- Citar trabajo
- Michaela Rambauske (Autor), 2012, Anforderungen und Realität der Schulsozialarbeit. Ein Ausgleich zu Sozialisationsdefiziten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338360