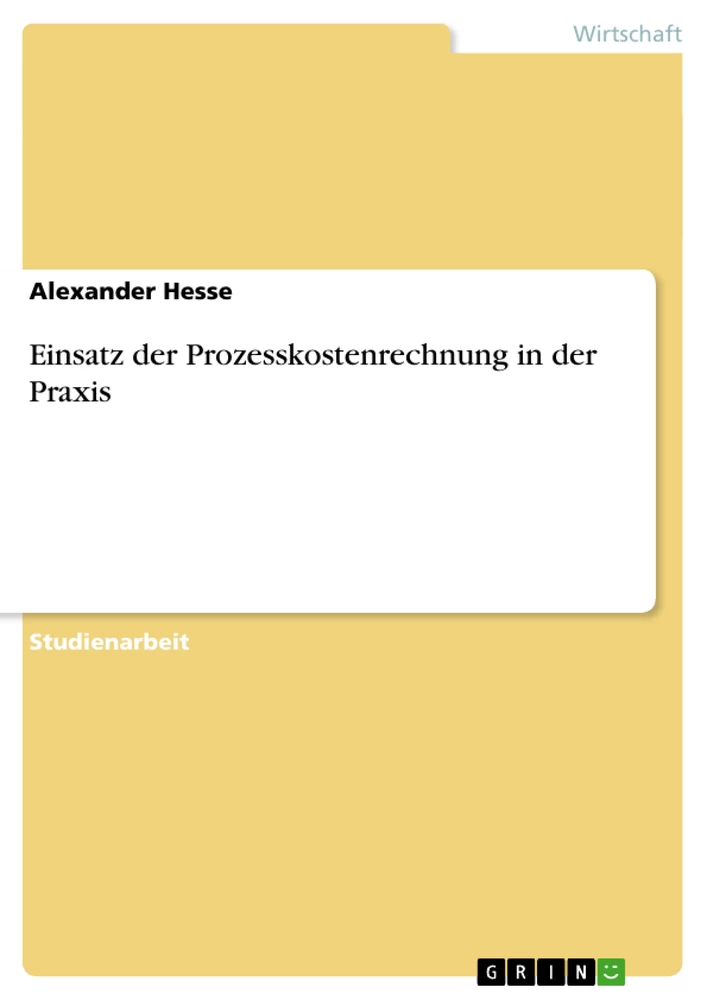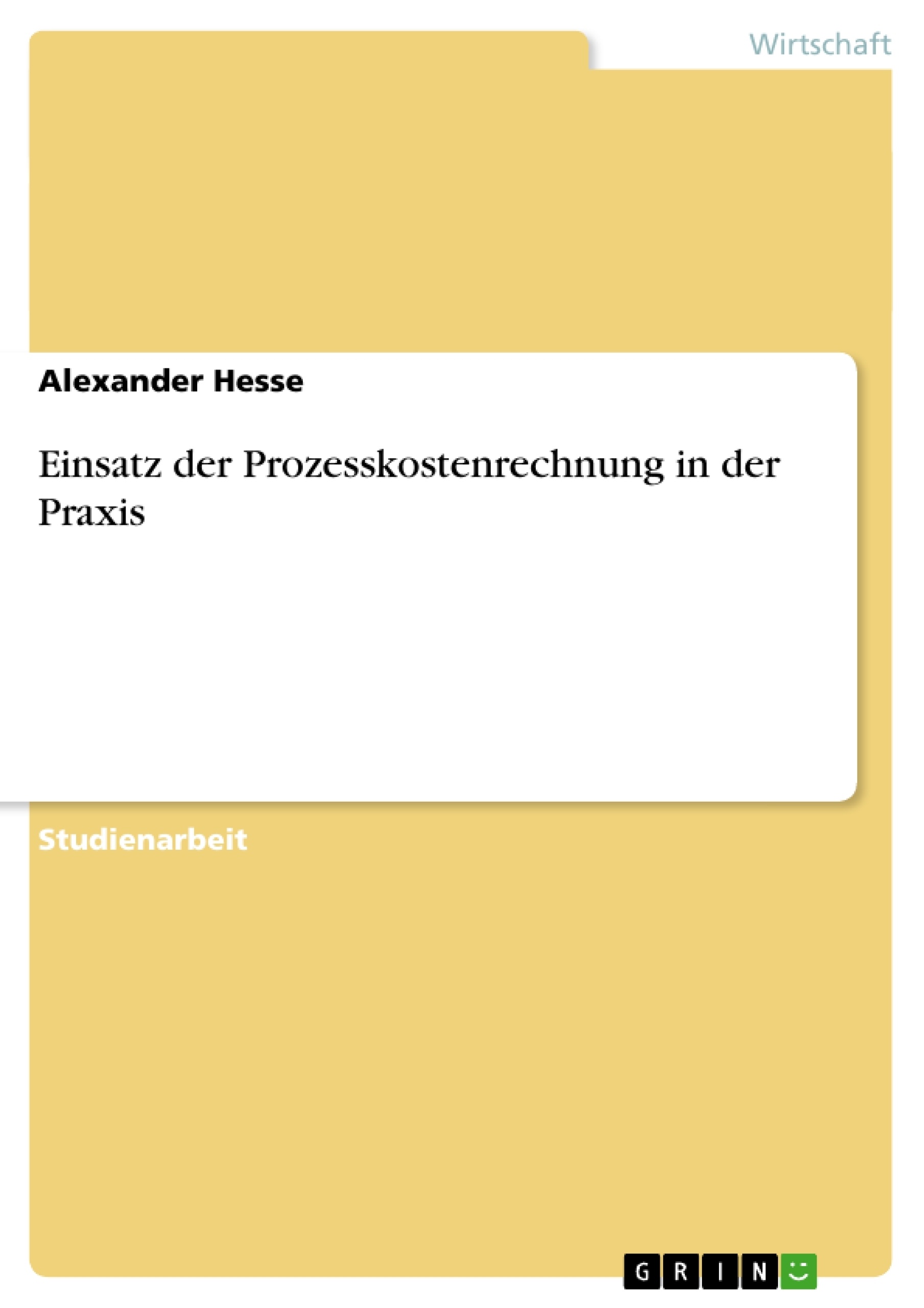Vor dem Hintergrund rasanter technologischer Entwicklung, gestiegener Flexibilität in der Fertigung, explodierenden Gemeinkosten in der „verborgenen Fabrik“ (Miller/Vollmann 1986, S. 84) sowie einer von starkem Unternehmenswettbewerb geprägten Situation ergaben sich bereits in den Achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts Verschiebungen in der Kostenstruktur der Betriebe. Durch die zunehmende "Verlagerung von produktiven zu administrativen Tätigkeiten" (Horváth/Mayer 1989, S.214) verschob sich auch der Kostenschwerpunkt weg von der Produktion hin zu sog. „Indirekten Bereichen“ wie z.B. F&E, Beschaffung und Logistik, Arbeitsvorbereitung, Fertigungsplanung und -steuerung sowie Verwaltung und Vertrieb etc. (vgl. Mayer 1990a, S.74). Bedingt durch steuernde, koordinierende sowie überwachende Tätigkeiten stieg der Anteil der Gemeinkosten an den Gesamtkosten sowohl absolut als auch relativ (vgl. Götze 2000, S. 223) und konnte von der durch die Automatisierung gewonnenen Flexibilität nicht kompensiert werden (vgl. Fröhling 1989, S. 67). Es galt, die Faktoren zu identifizieren, welche die Gemeinkosten so in die Höhe treiben (erste Versuche dessen in praxi gab es schon 1987 bei Schlafhorst, einem Maschinenbauunternehmen, vgl. Wäscher 1987, S. 297ff.). Die Unternehmen suchten somit nach neuen Rechenwerken, die dies vermochten, da mit den traditionellen Kostenrechnungsverfahren der tatsächliche Ressourcenverbrauch in den betreffenden Bereichen nicht mehr adäquat abgebildet werden konnte. Zum einen waren die bestehenden Systeme auf produktnahe Bereiche im Unternehmen ausgerichtet und zum anderen führte eine Verrechnung von Gemeinkosten in der Produktkalkulation mittels wertbezogener Zuschlagssätze zunehmend zu Ungenauigkeiten (vgl. Götze 2000, S. 223). Die Zuschlagskalkulation, deren Basis aufgrund des Rückgangs der Einzelkosten immer kleiner wurde, war nicht mehr in der Lage, den gestiegenen Planungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Überwachungsaufwand in den indirekten Bereichen verursachungsgerecht auf die verschiedenen Kostenträger zu verrechnen.
Unter diesem Druck entwickelten sich verschiedene Ansätze, die dieses Manko zu beseitigen versuchten, von denen im Zweiten Kapitel die Prozeßkostenrechnung einführend dargestellt und anschließend einer Beurteilung unterzogen wird. Der Hauptteil dieser Arbeit wird sich im Dritten Kapitel mit der Anwendung der Prozeßkostenrechnung in der Praxis beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Darstellung und Beurteilung der Prozeßkostenrechnung
- Darstellung
- Beurteilung
- Einsatz der Prozeßkostenrechnung in der Praxis
- Anwendungsfelder
- Ziele
- Ermittlung der Kosten pro Prozeß
- Ergebnisse und Beurteilung
- Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Einsatz der Prozeßkostenrechnung in der Praxis. Sie analysiert die Problemstellung der traditionellen Kostenrechnung im Hinblick auf die gestiegenen Gemeinkosten und die zunehmende Bedeutung indirekter Bereiche. Die Arbeit stellt die Prozeßkostenrechnung als ein alternatives Verfahren zur Kostenermittlung und -steuerung vor und untersucht ihre Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen.
- Analyse der Herausforderungen der traditionellen Kostenrechnung in Bezug auf die Erfassung und Verrechnung von Gemeinkosten
- Darstellung der Funktionsweise und der Ziele der Prozeßkostenrechnung
- Bewertung der Vor- und Nachteile des Einsatzes der Prozeßkostenrechnung in der Praxis
- Identifizierung von Anwendungsfeldern und Beispielen für die konkrete Anwendung der Prozeßkostenrechnung
- Untersuchung der Auswirkungen der Prozeßkostenrechnung auf die Entscheidungsfindung und das Controlling im Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung, die durch die rasante technologische Entwicklung und den damit verbundenen Anstieg der Gemeinkosten entsteht. Es werden die Grenzen der traditionellen Kostenrechnung aufgezeigt, insbesondere im Hinblick auf die Verrechnung von Gemeinkosten in indirekten Bereichen.
Das zweite Kapitel erläutert die Prozeßkostenrechnung als ein alternatives Kostenrechnungssystem. Es werden die Ziele, Funktionsweise und die Vorteile der Prozeßkostenrechnung im Vergleich zur traditionellen Kostenrechnung dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Anwendung der Prozeßkostenrechnung in der Praxis. Es werden Anwendungsfelder und Beispiele für die konkrete Anwendung in verschiedenen Unternehmensbereichen analysiert. Zudem werden die Ermittlung der Kosten pro Prozeß sowie die Beurteilung der Ergebnisse des Einsatzes der Prozeßkostenrechnung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Prozeßkostenrechnung, Gemeinkosten, indirekte Bereiche, traditionelle Kostenrechnung, Kostentransparenz, Effizienzsteigerung, Entscheidungsfindung, Controlling, Ressourcenverbrauch, Kapazitätsauslastung, Anwendungsfelder, Beispiele.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Prozesskostenrechnung entwickelt?
Sie entstand als Reaktion auf steigende Gemeinkosten in indirekten Bereichen (z.B. Logistik, Verwaltung), die durch traditionelle Zuschlagskalkulationen nicht mehr verursachungsgerecht verteilt werden konnten.
Was sind „Indirekte Bereiche“ in einem Unternehmen?
Dazu zählen Abteilungen wie Forschung und Entwicklung (F&E), Beschaffung, Arbeitsvorbereitung, Verwaltung und Vertrieb.
Wie verbessert die Prozesskostenrechnung die Kostentransparenz?
Sie identifiziert die tatsächlichen Kostentreiber (Cost Driver) und ordnet die Gemeinkosten den betrieblichen Prozessen statt pauschalen Prozentsätzen zu.
Welche Ziele verfolgt der Einsatz in der Praxis?
Hauptziele sind eine genauere Produktkalkulation, die Optimierung der Kapazitätsauslastung und die Steigerung der Effizienz in administrativen Prozessen.
Was ist die „verborgene Fabrik“?
Ein Begriff von Miller/Vollmann, der die explodierenden Kosten für Koordination, Überwachung und Steuerung beschreibt, die nicht direkt in der Produktion anfallen.
- Citation du texte
- Dipl.-Kfm. Alexander Hesse (Auteur), 2004, Einsatz der Prozesskostenrechnung in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33856