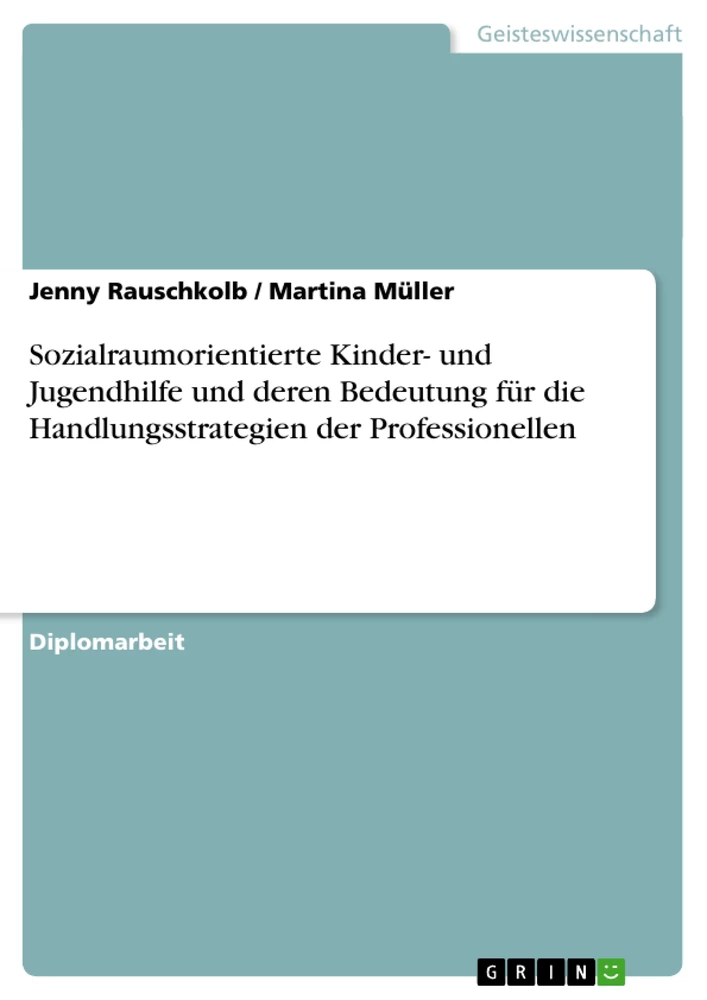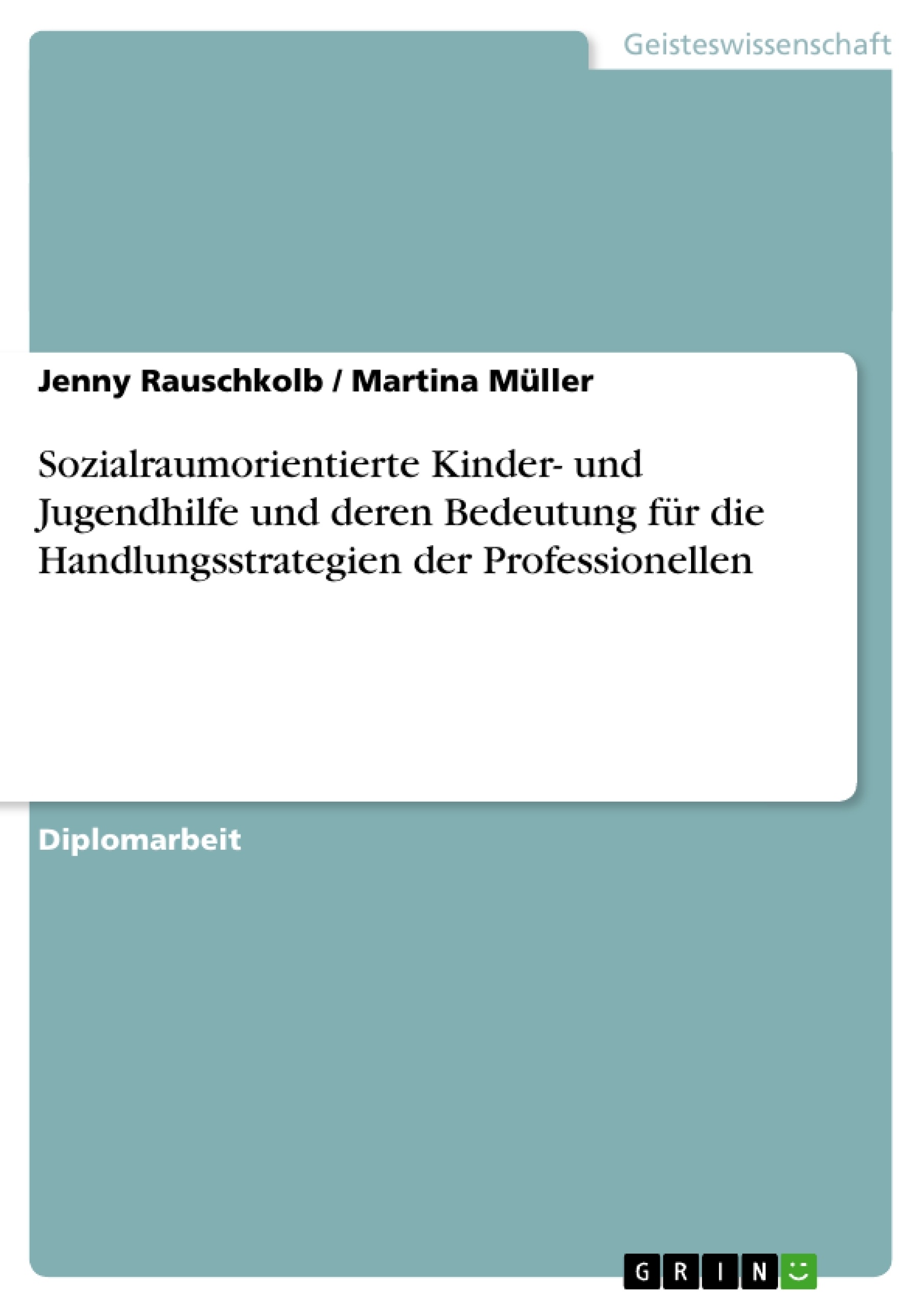Familien mit Kindern bilden die Grundlage für eine langfristige stabile Investition in die Zukunft unseres Landes. Ehe und Familie haben sich über die Jahrhunderte des gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels als Urzelle der Gesellschaft bewährt. In Familien suchen und erfahren Menschen Liebe, Geborgenheit, Lebenssinn, gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Ehe und Familie gehören in den Mittelpunkt einer Politik. Sie sind natürliche Lebensformen und Grundpfeiler einer freien und solidarischen Gesellschaft. Die Familie genießt verfassungsrechtlichen Schutz. Kinder sind eine Bereicherung für Familie und Gesellschaft. Kinder bedeuten Zukunft. Die Familie ist die beste Grundlage für die Solidarität der Generationen. Kinder lernen und erfahren durch die Familie Regeln des Zusammenlebens, kulturelle Werte und solidarisches Verhalten. Die Familie fördert die Persönlichkeitsentwicklung und vermittelt Lebenschancen wie keine andere Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft. Familien haben somit einen Anspruch auf umfassende staatliche und gesellschaftliche Hilfen.
Heute zeichnet sich eine Gesellschaft ab, in der das Denken und Verhalten der Bürger immer stärker von Individualismus, Egoismus und Entsolidarisierung geprägt wird und in der die Zukunftsperspektiven durch Globalisierung, Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und Verarmungsprozesse für beträchtliche Teile der Bevölkerung – insbesondere für Familien – bedroht sind. Diese Krisenerscheinungen prägen die Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass Kindheit und Jugend zunehmend selbst als gesellschaftliches Problem wahrgenommen werden: denn die Probleme der Kinder und Jugendlichen – und die Probleme, die sie uns bereiten – sind ein Spiegelbild der Probleme, die die Gesellschaft mit sich selbst hat.
In der gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen Lage müssen sich die Jugendlichen hohen Leistungsanforderungen stellen und sind gleichzeitig erhöhten Risiken ausgesetzt. Das betrifft schulisches wie berufliches Versagen ebenso wie Risiken der persönlichen Sicherheit in einer Welt offener Grenzen und überlasteter öffentlicher Sicherheitsapparate. Die heutige gesellschaftliche Situation ist geprägt vom Streben nach raschem, hohem Lebensstandard und sozialer Anerkennung, verbunden mit starkem Konkurrenzdruck im Arbeits- wie Privatleben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zur Struktur der Kinder- und Jugendhilfe
- 1.1 Anpassungsprozesse der Kinder- und Jugendhilfe an gesellschaftliche Veränderungen
- 1.2 An welchen Leitlinien orientiert sich die Kinder- und Jugendhilfe?
- 1.3 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
- 1.4 Andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
- 2. Modernisierungsprozesse im Kontext der Jugendhilfe
- 2.1 Familien in der Krise?
- 2.1.1 Gesellschaftliche Erwartungen an die Familie
- 2.1.2 Familien im gesellschaftlichen Wandel
- 2.2 Zur Entstrukturierung der Jugendphase
- 2.3 Reaktionen der Jugendhilfe auf gesellschaftliche Veränderungen
- 2.4 Aufgaben der Kinder- und Jugendpolitik
- 2.1 Familien in der Krise?
- 3. Zum Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit
- 3.1 Zur Notwendigkeit der Veränderung der bisherigen Kinder- und Jugendhilfestruktur
- 3.2 Neue Anforderungsprofile an die Soziale Arbeit
- 4. Interdisziplinäre Betrachtung des Sozialraums
- 4.1 Sozialräumliche Aspekte
- 4.2 Sozialräumliche Problemlagen und ihre Folgen
- 4.3 Prozesse und Aktivitäten im Sozialraum
- 5. Sozialraumorientierung – Ein neues Konzept?
- 5.1 Die Geburt eines „neuen“ Ansatzes
- 5.1.1 Zur Arbeit im Gemeinwesen
- 5.1.2 Von der Gemeinwesenarbeit zur stadtteilorientierten Arbeit
- 5.1.3 Zum Quartiersmanagement
- 5.2 Zur sozialraumbezogenen Sozialen Arbeit
- 5.2.1 Was bedeutet sozialraumorientierte Soziale Arbeit konkret?
- 5.2.2 Sozialraumorientierung vs. einzelfallorientierte Soziale Arbeit
- 5.2.3 Voraussetzungen für professionelles sozialräumliches Arbeiten
- 5.2.4 Wie sieht die Finanzierung von sozialräumlichem Arbeiten aus?
- 5.2.5 Perspektiven einer sozialraumorientierten Sozialen Arbeit
- 5.1 Die Geburt eines „neuen“ Ansatzes
- 6. Zum sozialräumlich orientierten Konzept in der Kinder- und Jugendhilfe
- 6.1 Zur Jugendhilfeplanung – ein hilfereiches Instrument
- 6.2 Standardisierte oder flexible Erziehungshilfen?
- 6.3 Die sozialräumliche Orientierung in der Kinder- und Jugendhilfe
- 6.4 Kinder und Jugendliche haben ihre eigene Lebenswelt
- 6.5 Die Neuen Steuerungsmodelle in der Kinder- und Jugendhilfe
- 7. Exemplarische Darstellung eines sozialraumorientierten Ansatzes in der Kinder- und Jugendhilfe
- 7.1 Ein Rückblick in die Geschichte der Stadt Neunkirchen
- 7.2 Das,,Neunkircher Modell“ und seine Entwicklung
- 7.2.1 Welche Ziele verfolgt das Modellprojekt?
- 7.2.2 Sozialraumindikatoren des Modellbezirks
- 7.3 Zur Struktur des Modells
- 7.4 Wie wurde das Modell finanziert?
- 7.5 Allgemeine Erfahrungen mit dem Modell seit seiner Einführung
- 7.6 Persönliche Erfahrungen der Mitarbeiter des Sozialraumteams
- 7.6.1 Warum eine Gruppendiskussion?
- 7.6.2 Zur qualitativen Inhaltsanalyse
- 7.7 Analyse der Gruppendiskussion
- 7.7.1 Festlegung des Materials
- 7.7.2 Analyse der Entstehungssituation
- 7.7.3 Formale Charakteristika des Materials
- 7.7.4 Richtung der Analyse
- 7.7.5 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung
- 7.7.6 Bestimmung der Analysetechnik
- 7.7.7 Festlegung des konkreten Ablaufmodells
- 7.7.8 Definition der Analyseeinheiten
- 7.7.9 Analyseschritte mittels des Kategoriensystems
- 7.7.10 Rücküberprüfung des Kategoriensystems und Interpretation der Ergebnisse
- 7.8 Perspektiven des Neunkircher Modells
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe und deren Bedeutung für die Handlungsstrategien der Professionellen. Sie analysiert, wie das Konzept der ganzheitlichen, sozialraumbezogenen und budgetierten Jugendhilfe, exemplarisch dargestellt am Beispiel des Neunkircher Modells, die Arbeit im Sozialraum verändert.
- Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe und ihre Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen
- Moderne Konzepte und Ansätze in der Sozialen Arbeit
- Der Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit und die Bedeutung der Sozialraumorientierung
- Das Neunkircher Modell: Ein Beispiel für sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe
- Analyse der Erfahrungen und Perspektiven des Neunkircher Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe und analysiert deren Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen. Sie beleuchtet die Leitlinien der Kinder- und Jugendhilfe, die angebotenen Leistungen sowie weitere Aufgaben.
Anschließend werden Modernisierungsprozesse im Kontext der Jugendhilfe thematisiert, wobei der Fokus auf die Herausforderungen durch den Wandel der Familienstrukturen und die Entstrukturierung der Jugendphase liegt. Die Arbeit untersucht Reaktionen der Jugendhilfe auf diese Entwicklungen und die Rolle der Kinder- und Jugendpolitik.
Im weiteren Verlauf wird der Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit analysiert, wobei die Notwendigkeit der Veränderung der bisherigen Kinder- und Jugendhilfestruktur und die neuen Anforderungsprofile an die Soziale Arbeit beleuchtet werden.
Das vierte Kapitel widmet sich der interdisziplinären Betrachtung des Sozialraums, einschließlich der sozialräumlichen Aspekte, Problemlagen und Aktivitäten.
Die Arbeit diskutiert dann das Konzept der Sozialraumorientierung, beleuchtet dessen Entstehung und Entwicklung und analysiert verschiedene Ansätze wie Gemeinwesenarbeit, stadtteilorientierte Arbeit und Quartiersmanagement. Sie erörtert, wie sich die sozialraumbezogene Soziale Arbeit von der einzelfallorientierten Arbeit unterscheidet und welche Voraussetzungen für professionelles sozialräumliches Arbeiten notwendig sind.
Im sechsten Kapitel werden die Auswirkungen der Sozialraumorientierung auf die Kinder- und Jugendhilfe näher beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Jugendhilfeplanung, die Frage nach standardisierten oder flexiblen Erziehungshilfen und analysiert die Herausforderungen und Chancen der sozialräumlichen Orientierung in der Kinder- und Jugendhilfe.
Das siebte Kapitel stellt das Neunkircher Modell als Beispiel für einen sozialraumorientierten Ansatz in der Kinder- und Jugendhilfe vor. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Modells, seine Ziele, die Sozialraumindikatoren, die Struktur des Modells und dessen Finanzierung. Sie präsentiert die Ergebnisse einer Gruppendiskussion mit Mitarbeitern des Sozialraumteams, um die Erfahrungen mit dem Modell zu analysieren und Perspektiven aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe, Ganzheitliche Jugendhilfe, Sozialraumbezogene Jugendhilfe, Budgetierte Jugendhilfe, Neunkircher Modell, Jugendhilfeplanung, Professionelle Handlungsstrategien, Gemeinwesenarbeit, Stadtteilorientierte Arbeit, Quartiersmanagement, Familienstrukturen, Jugendphase, Soziale Arbeit, Interdisziplinäre Betrachtung, Sozialraum, Erfahrungen, Perspektiven, Qualitative Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Sozialraumorientierung" in der Jugendhilfe?
Es ist ein Konzept, das Hilfen nicht nur am Einzelfall ausrichtet, sondern das gesamte Lebensumfeld (den Sozialraum) der Kinder und Familien einbezieht.
Was ist das "Neunkircher Modell"?
Ein Praxisbeispiel für ganzheitliche, sozialraumbezogene und budgetierte Jugendhilfe, das die Arbeit im Team und im Quartier in den Fokus rückt.
Wie unterscheidet sich die Arbeit von der klassischen Einzelfallhilfe?
Statt standardisierter Leistungen werden flexible Hilfen entwickelt, die Ressourcen im Stadtteil nutzen und die Selbsthilfe der Familien stärken.
Warum ist ein Paradigmenwechsel in der Sozialen Arbeit nötig?
Gesellschaftliche Veränderungen wie Individualisierung, Arbeitslosigkeit und der Wandel der Familienstrukturen erfordern neue, lebensweltnahe Strategien.
Welche Rolle spielt die Jugendhilfeplanung?
Sie ist ein Instrument zur Ermittlung von Bedarfen im Sozialraum und zur Steuerung der notwendigen Ressourcen und Angebote.
- Quote paper
- Jenny Rauschkolb (Author), Martina Müller (Author), 2004, Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe und deren Bedeutung für die Handlungsstrategien der Professionellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33869