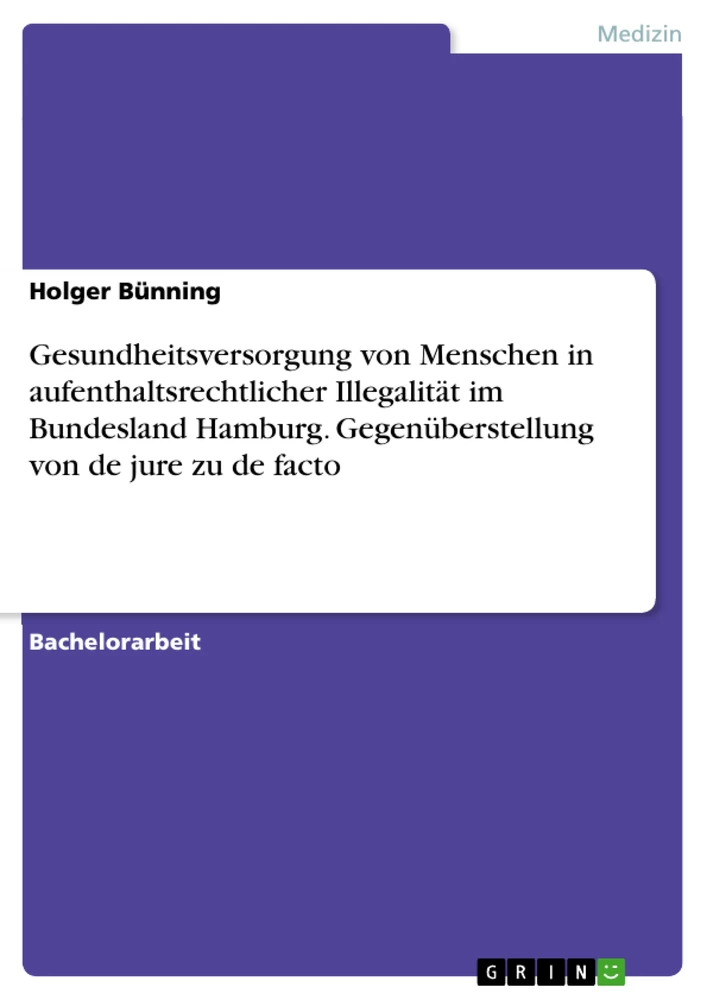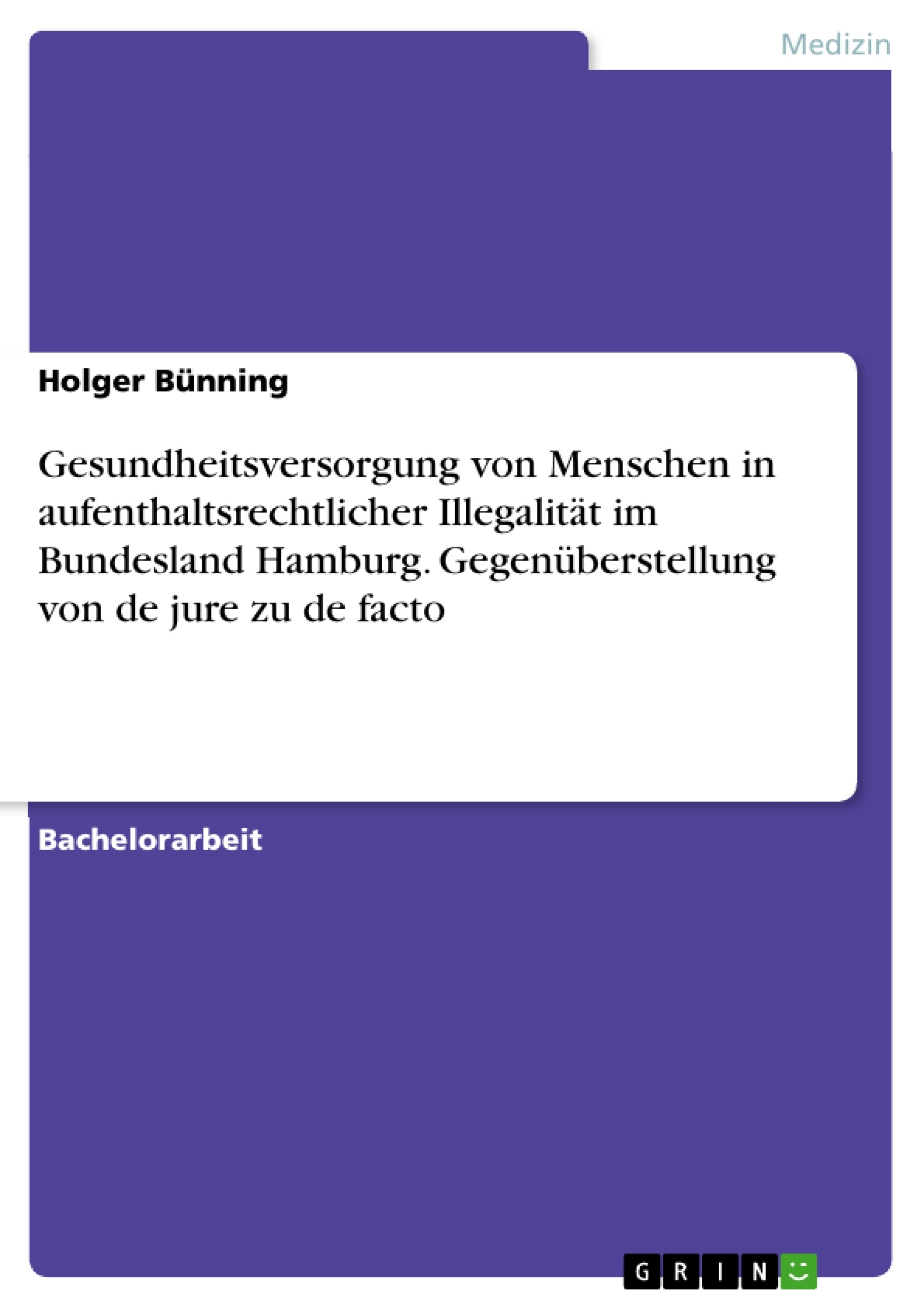Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich, in einer Gegenüberstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen und den Praxisbedingungen, mit der Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität. Denn, wenngleich begrifflich illegalisiert, besitzen die schätzungsweise 100000 bis 400000 Menschen ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus in Deutschland doch einen Anspruch auf eine adäquate Gesundheitsversorgung.
Zielsetzung dieser Arbeit ist besonders relevante Problembereiche in der Versorgung zu identifizieren, die Komplexität des Versorgungssystems zu beleuchten und etwaige Informationsdefizite der unterschiedlichen Akteure auszumachen. Bedingt durch den illegalen Aufenthaltsstatus der thematisierten Bevölkerungsgruppe und der Tatsache, dass es sich sozialempirisch betrachtet um ein junges Forschungsfeld handelt, wurden neben einer grundlegenden Literaturrecherche qualitative Experten-Interviews durchgeführt. Hierfür konnten Experten aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen gewonnen werden.
Auf rechtlicher Ebene konnte herausgestellt werden, dass die Lebenswirklichkeiten der Betroffenen in wesentlichen Punkten nicht mit den Inhalten des Asylbewerberleistungs- beziehungsweise Aufenthaltsgesetzes vereinbar sind. Dies äußert sich insbesondere dadurch, dass die Leistungsinanspruchname häufig durch bürokratische Hürden behindert wird. Als besonders problematisch erwies sich diesbezüglich die medizinische Versorgung chronischer Patienten, Schwangerer und Kinder. Abschließend kommt die Untersuchung zu dem Schluss, dass Menschen ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus ihr individuelles Recht auf Gesundheit, in vielen Fällen nur unter Inkaufnahme von ausländerrechtlichen Konsequenzen geltend machen können.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einführung
- Wissenschaftlicher Hintergrund aufenthaltsrechtlicher Illegalität
- Begriffseingrenzung aufenthaltsrechtlicher Illegalität
- Entstehung aufenthaltsrechtlicher Illegalität
- Betroffene Personengruppe
- Aufenthaltsrechtliche Illegalität und Gesundheit
- Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität: de jure
- Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität: de facto
- Methodisches Vorgehen
- Methodenauswahl
- Interviewleitfaden
- Interviewauswertung und Ergebnisvorstellung
- Diskussion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität in Hamburg, indem sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit der Praxis vergleicht. Ziel ist die Identifizierung relevanter Probleme in der Versorgung, die Beleuchtung der Systemkomplexität und die Aufdeckung von Informationsdefiziten bei verschiedenen Akteuren. Die Studie verwendet qualitative Experteninterviews neben Literaturrecherche.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Aufenthaltsstatus
- Praktische Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung dieser Gruppe
- Identifizierung von Informationsdefiziten bei Akteuren im Versorgungssystem
- Analyse der Auswirkungen bürokratischer Hürden auf die medizinische Versorgung
- Untersuchung spezifischer Problemfelder wie die Versorgung chronisch Kranker, Schwangerer und Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit beginnt mit der Feststellung des Rechts auf Gesundheit gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und stellt die Frage, wie dieses Recht für Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland gewährleistet wird. Sie hebt die praktischen Hürden hervor, die diese Gruppe bei der Inanspruchnahme ihrer Rechte erlebt, und benennt die Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen als einen zentralen Faktor, der den Zugang zur Gesundheitsversorgung behindert. Die Arbeit kündigt die Gegenüberstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen (de jure) mit der tatsächlichen Versorgungssituation (de facto) an, wobei das Asylbewerberleistungsgesetz und das Aufenthaltsgesetz im Mittelpunkt stehen. Die jüngsten Verschärfungen des Asylrechts und die Ausweisung von Ländern als „sichere Herkunftsstaaten“ werden als aktuelle Entwicklungen genannt, die die Thematik unterstreichen.
Schlüsselwörter
Gesundheitsversorgung, aufenthaltsrechtliche Illegalität, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Hamburg, Experteninterviews, bürokratische Hürden, medizinische Versorgung, chronische Krankheiten, Schwangere, Kinder, Menschenrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität in Hamburg
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie untersucht die Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität in Hamburg. Sie vergleicht die rechtlichen Rahmenbedingungen mit der tatsächlichen Versorgungssituation (de jure vs. de facto) und analysiert die Herausforderungen und Probleme in der Versorgung dieser Personengruppe.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet qualitative Experteninterviews, kombiniert mit einer Literaturrecherche, um ein umfassendes Bild der Thematik zu erhalten. Der Interviewleitfaden wurde speziell für diese Untersuchung entwickelt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, relevante Probleme in der Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus zu identifizieren, die Komplexität des Systems zu beleuchten und Informationsdefizite bei verschiedenen Akteuren aufzudecken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Auswirkungen bürokratischer Hürden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung für Menschen ohne Aufenthaltsstatus, die praktischen Herausforderungen in der Versorgung dieser Gruppe, die Identifizierung von Informationsdefiziten, die Auswirkungen bürokratischer Hürden und spezifische Problemfelder wie die Versorgung chronisch Kranker, Schwangerer und Kinder.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Studie konzentriert sich auf das Asylbewerberleistungsgesetz und das Aufenthaltsgesetz, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu analysieren. Die jüngsten Verschärfungen des Asylrechts und die Ausweisung von Ländern als „sichere Herkunftsstaaten“ werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie umfasst Kapitel zu: Abstract, Inhaltsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Einleitung, Wissenschaftlicher Hintergrund aufenthaltsrechtlicher Illegalität, Gesundheitsversorgung (de jure und de facto), Methodisches Vorgehen, Interviewauswertung und Ergebnisvorstellung, Diskussion, Fazit, Literaturverzeichnis und Anhang.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Gesundheitsversorgung, aufenthaltsrechtliche Illegalität, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Hamburg, Experteninterviews, bürokratische Hürden, medizinische Versorgung, chronische Krankheiten, Schwangere, Kinder, Menschenrechte.
Wie wird das Recht auf Gesundheit in der Studie betrachtet?
Die Studie beginnt mit der Feststellung des Rechts auf Gesundheit gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und untersucht, wie dieses Recht für Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland gewährleistet (oder nicht gewährleistet) wird. Die Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen wird als ein zentraler Faktor für den eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung identifiziert.
- Arbeit zitieren
- Holger Bünning (Autor:in), 2016, Gesundheitsversorgung von Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität im Bundesland Hamburg. Gegenüberstellung von de jure zu de facto, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338889