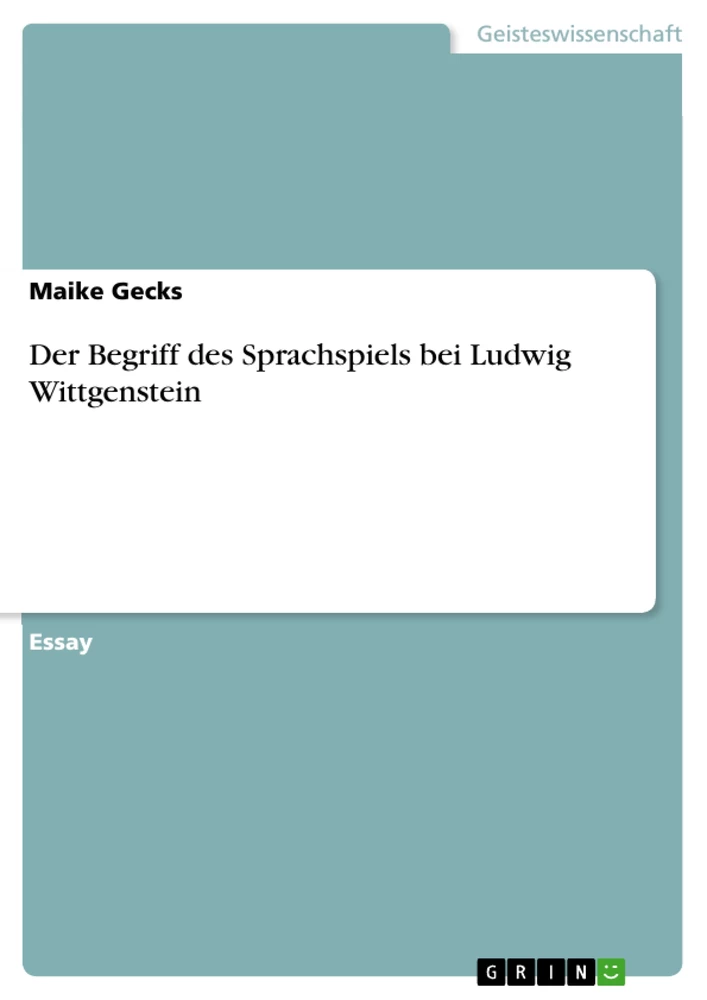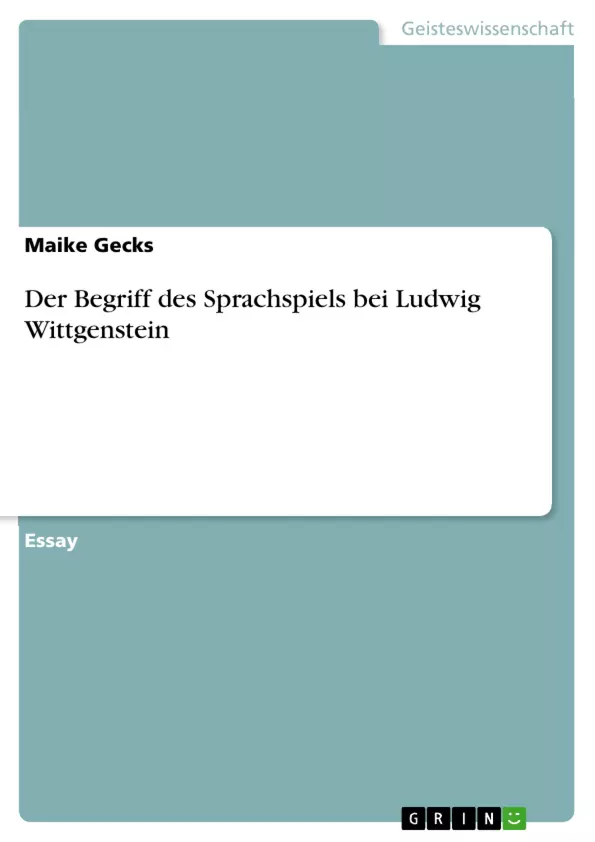Im Folgenden wird der Begriff des Sprachspiels in Ludwig Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen §1-37 und §65-67“ untersucht. Wittgensteins Argumentation zeichnet sich dadurch aus, dass er keine eindeutige Definition des Sprachspiels als Begriff gibt, sondern viele Thesen aufstellt und diese mit Beispielen belegt. Das Sprachspiel beinhaltet viele Abstufungen, die sich nicht mit einer einfachen Definition benennen lassen. Zudem ist die Zahl der Sprachspiele unendlich, dabei werden immer wieder neue dazu genommen und alte verworfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff der Sprachspiele
- Sprachspiele als Tätigkeiten
- Geistige Tätigkeiten
- Familienähnlichkeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Sprachspiels in Ludwig Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen §1-37 und §65-67". Der Fokus liegt darauf, Wittgensteins Argumentation zu analysieren, die sich durch das Fehlen einer eindeutigen Definition des Sprachspiels auszeichnet. Stattdessen präsentiert er zahlreiche Thesen und belegt diese mit Beispielen. Die Arbeit beleuchtet die Vielfältigkeit und Dynamik des Sprachspiels, das sich durch ständige Entwicklung und Veränderung auszeichnet.
- Wittgensteins Kritik an Augustinus' Sprachbild
- Sprachspiele als Tätigkeiten und Lebensformen
- Die Bedeutung des Kontextes und der Situation
- Die Vielfältigkeit und Dynamik von Sprachspielen
- Die Rolle der Kreativität in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Sie beleuchtet Wittgensteins Argumentationsweise, die auf zahlreichen Beispielen und Thesen basiert, ohne eine eindeutige Definition des Sprachspiels zu liefern.
Der Begriff der Sprachspiele
Dieses Kapitel analysiert Wittgensteins Kritik an Augustinus' Sprachbild, das die Bedeutung von Wörtern auf eine hinweisende Definition reduziert. Wittgenstein argumentiert, dass diese Definition nur einen Teil der Sprache erfasst und das Erlernen von Sprache eher einem "Abrichten" als einem "Erklären" ähnelt. Er stellt den Begriff des Sprachspiels vor, der den gesamten Kontext der Sprache und der Tätigkeiten umfasst, mit denen sie verwoben ist. Sprachspiele sind für Wittgenstein dynamisch und vielfältig, wobei neue Spielarten entstehen und alte veralten.
Sprachspiele als Tätigkeiten
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Kontextes und der Situation für das Verständnis von Sprachspielen. Es wird anhand von Beispielen gezeigt, wie Sprachspiele immer auf Tätigkeiten und Lebensformen bezogen sind. Die primitive Sprache des Bauarbeiterbeispiels wird als verkürzte Form der grammatikalischen Sprache dargestellt, ohne jedoch die Gedanken des Sprechers zu verkürzen. Die Vielfalt der Sprachspiele wird betont, wobei neue Arten von Sprachspielen ständig entstehen und alte veralten.
Geistige Tätigkeiten
Dieses Kapitel widmet sich Wittgensteins Kritik an der Annahme, dass man kein Sprachspiel beherrschen muss, um eine hinweisende Definition zu verstehen. Er argumentiert, dass die Interpretation einer hinweisenden Definition immer von der geistigen Tätigkeit des Sprechers abhängt. Die Bedeutung eines Wortes hängt vom Kontext und der Situation ab, in der es verwendet wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff des Sprachspiels bei Ludwig Wittgenstein, insbesondere in seinen "Philosophischen Untersuchungen". Wichtige Themen sind die Kritik an Augustinus' Sprachbild, die Rolle von Tätigkeiten und Lebensformen im Kontext von Sprachspielen, die Vielfältigkeit und Dynamik von Sprachspielen sowie die Bedeutung der Kreativität in der Kommunikation. Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Kontextes und der Situation für das Verständnis von Sprachspielen und beleuchtet die Bedeutung der geistigen Tätigkeit des Sprechers bei der Interpretation von hinweisenden Definitionen.
Häufig gestellte Fragen zu Wittgensteins Sprachspiel
Was ist ein „Sprachspiel“ nach Ludwig Wittgenstein?
Ein Sprachspiel umfasst die Sprache und die Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist. Es gibt keine einfache Definition, da Sprache als dynamische Lebensform verstanden wird.
Warum kritisiert Wittgenstein das Sprachbild von Augustinus?
Augustinus reduziert Sprache auf das Benennen von Objekten. Wittgenstein argumentiert, dass dies nur einen kleinen Teil der Sprache erfasst und den Kontext vernachlässigt.
Was versteht man unter „Familienähnlichkeiten“?
Begriffe haben keine feste Definition, sondern weisen ein Netz von überlappenden Ähnlichkeiten auf, wie die Merkmale einer Familie.
Sind Sprachspiele statisch oder veränderlich?
Sprachspiele sind hochgradig dynamisch; ständig entstehen neue Arten von Sprachspielen, während alte veralten und vergessen werden.
Welche Rolle spielt das „Abrichten“ beim Spracherwerb?
Laut Wittgenstein ähnelt das Erlernen der ersten Sprache eher einem praktischen Abrichten auf Tätigkeiten als einer theoretischen Erklärung von Wortbedeutungen.
- Quote paper
- Maike Gecks (Author), 2011, Der Begriff des Sprachspiels bei Ludwig Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339001