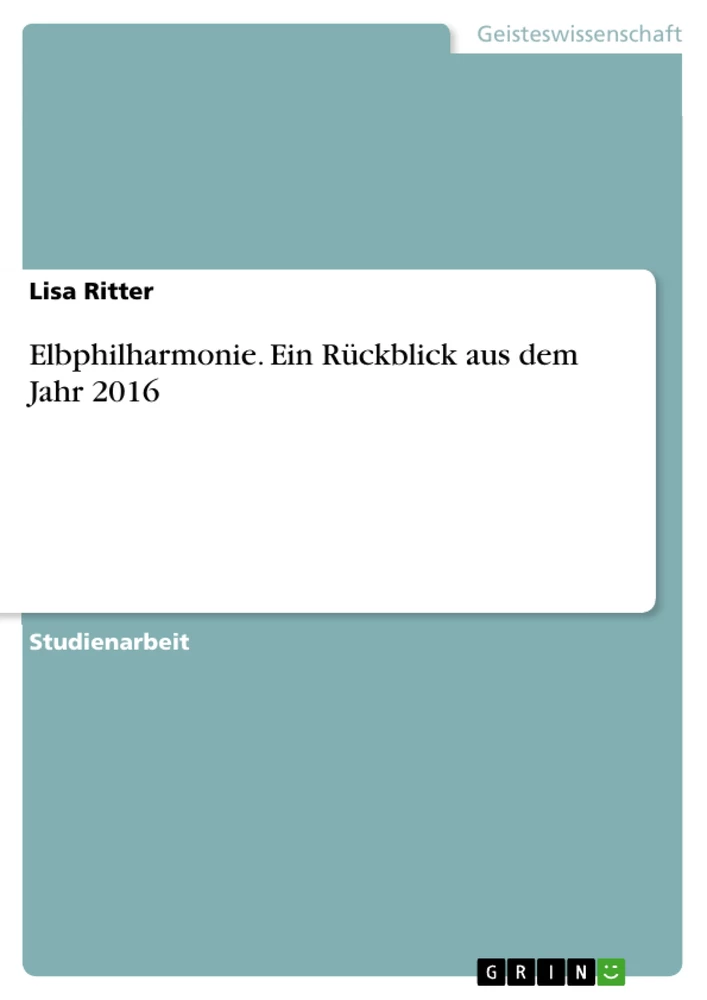Nach der Entscheidung der Hamburger Bürger am 26.Oktober 2005 stand der Entschluss fest, in der Hamburger Hafencity eine neue architektonisch meisterhafte Philharmonie zu erbauen. Die Elbphilharmonie sollte auf dem einst von Architekt Werner Kallmorgen im Jahr 1965 vollendeten Kakaospeicher A in der Speicherstadt erbaut werden. Die eine Seite, die der Unterstützer sahen dies als Chance an, Hamburg in den Wettbewerb der weltweit renommiertesten Musikstädte zu erheben. Die andere Seite, die der Gegner sahen dieses Projekt als ein utopisches, im zu Beginn vorgeschriebenen Finanzierungsrahmen von 186 Millionen Euro unmöglich zu bauende Illusion.
In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, in wieweit das nun fast fertiggestellte Bauprojekt tatsächlich die Hoffnung auf weltweite Bekanntheit und wirtschaftliche Erfolge bringen kann oder ob es lediglich zu einem Investitionsgraben wird, in dem sich ausschließlich die ab der Bürgerlichen Mitte aufwärts lebende Bevölkerung bewegt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Elbphilharmonie
- Einleitung
- Die Ausgangslage 2000-2007
- Die aktuelle Lage 2016
- Das Bauwerk:
- Das Musikhaus Hamburg Musik.
- Die Finanzierung
- Ein neues Wahrzeichen und wirtschaftlicher Aufschwung für Hamburg
- Ein teurer Subventionsgraben und eine Illusion für die Elite
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Elbphilharmonie in Hamburg, einem ambitionierten Bauprojekt, das seit seiner Entstehung kontrovers diskutiert wird. Ziel der Arbeit ist es, die Elbphilharmonie als Chance oder Illusion für Hamburg zu analysieren, indem die Argumente der Befürworter und Gegner des Projekts gegenübergestellt werden.
- Die Elbphilharmonie als architektonisches Meisterwerk und neues Wahrzeichen Hamburgs
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts auf die Stadt
- Die Finanzierung des Projekts und die Frage der öffentlichen Mittel
- Die Bedeutung des Projekts für die kulturelle Entwicklung Hamburgs
- Die soziale Dimension des Projekts und die Frage der Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Elbphilharmonie Dieses Kapitel stellt die Elbphilharmonie als Bauprojekt vor und beleuchtet die Entstehung des Projekts, die Ausgangslage in den Jahren 2000-2007 und die aktuelle Situation im Jahr 2016. Es werden die wichtigsten Akteure und Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Bau der Elbphilharmonie vorgestellt.
- Kapitel 2: Ein neues Wahrzeichen und wirtschaftlicher Aufschwung für Hamburg Dieses Kapitel analysiert die Argumente der Befürworter des Elbphilharmonie-Projekts. Es werden die positiven Auswirkungen des Projekts auf die Stadtentwicklung, den Tourismus und die Wirtschaft beleuchtet. Die Elbphilharmonie wird als ein neues Wahrzeichen und ein Motor für den wirtschaftlichen Aufschwung Hamburgs dargestellt.
- Kapitel 3: Ein teurer Subventionsgraben und eine Illusion für die Elite Dieses Kapitel widmet sich den Argumenten der Gegner des Elbphilharmonie-Projekts. Es werden die hohen Baukosten, die Finanzierung durch öffentliche Mittel und die Frage der sozialen Gerechtigkeit beleuchtet. Die Elbphilharmonie wird als ein teures Prestigeprojekt dargestellt, das vor allem der Eliteschicht zugute kommt und die soziale Ungleichheit in der Stadt verstärkt.
Schlüsselwörter
Elbphilharmonie, Hamburg, Hafencity, Architektur, Kultur, Musik, Wirtschaft, Tourismus, Baukosten, Finanzierung, öffentliche Mittel, soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Elite, Wahrzeichen, Prestigeprojekt, Illusion, Chance.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde der Bau der Elbphilharmonie beschlossen?
Die Entscheidung für den Bau in der Hamburger Hafencity fiel durch die Hamburger Bürger am 26. Oktober 2005.
Auf welchem historischen Gebäude wurde die Elbphilharmonie errichtet?
Das Bauwerk wurde auf dem ehemaligen Kakaospeicher A in der Speicherstadt errichtet, der ursprünglich 1965 von Werner Kallmorgen vollendet wurde.
Was waren die Hauptargumente der Befürworter?
Unterstützer sahen das Projekt als Chance, Hamburg als weltweit renommierte Musikstadt zu etablieren und den Tourismus sowie die Wirtschaft anzukurbeln.
Warum wurde das Projekt von Gegnern kritisiert?
Kritiker bemängelten die explodierenden Baukosten, die Nutzung öffentlicher Mittel für ein „Elite-Projekt“ und sahen darin ein finanzielles Risiko (Investitionsgraben).
Wie hoch war der ursprünglich geplante Finanzrahmen?
Zu Beginn des Projekts war ein Finanzierungsrahmen von 186 Millionen Euro vorgeschrieben.
- Citar trabajo
- Lisa Ritter (Autor), 2016, Elbphilharmonie. Ein Rückblick aus dem Jahr 2016, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339062